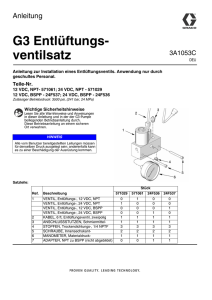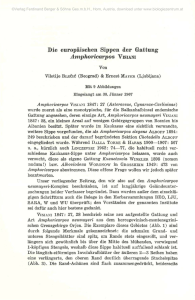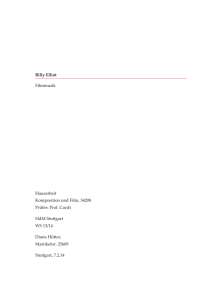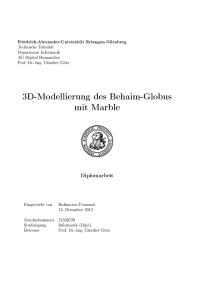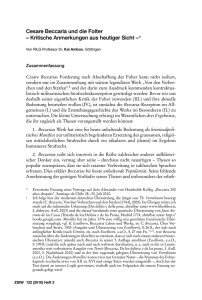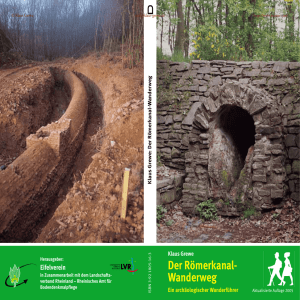(Kultur - Philosophie - Geschichte 10.) Rudolph, Enno Steinfeld, Thomas - Machtwechsel der Bilder Bild und Bildverstehen im Wandel-Orell Füssli (2012)
Anuncio

Machtwechsel der Bilder. Bild und Bildverstehen im Wandel Herausgegeben von Enno Rudolph und Thomas Steinfeld Kultur – Philosophie – Geschichte Reihe des Kulturwissenschaftlichen Instituts Luzern Herausgegeben von Enno Rudolph und Thomas Steinfeld Band 10 Machtwechsel der Bilder Bild und Bildverstehen im Wandel © 2012 Orell Füssli Verlag AG, Zürich www.ofv.ch Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Dadurch begründete Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf andern Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Vervielfältigungen des Werkes oder von Teilen des Werkes sind auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie sind grundsätzlich vergütungspflichtig. Umschlagabbildung: La fenêtre bleue, Henri Matisse. © 2011, Succession H. Matisse / ProLitteris, Zürich. Umschlaggestaltung: Nadja Zela, Zürich Lektorat, Layout und Bildbearbeitung: Tobias Brücker, Luzern Korrektorat: Tobias Brücker und Alessandro Lazzari, Luzern Druck: fgb • freiburger graphische betriebe, Freiburg ISBN 978-3-280-06024-7 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Inhaltsverzeichnis Geleitwort ................................................................................................. 7 Alles ist Bild. Statt einer Einleitung Enno Rudolph ............................................................................................. 9 Verlorene Meisterwerke. Über einen Mythos Bernd Roeck .............................................................................................. 15 Bildverkehr. Über Bilder von Bildern und den Verlust des Originals. Oder: Wie man weiß, wo man ist Thomas Steinfeld ....................................................................................... 45 Komplexe Bilder: Kommunizierte Wahrnehmung Dirk Baecker ............................................................................................. 61 Die Evidenz des Bildes. Einige Anmerkungen zu den semiologischen und epistemologischen Voraussetzungen der Bildsemantik Ludwig Jäger ............................................................................................. 95 Die Physis des Bildes Ludger Schwarte ...................................................................................... 127 Bilderschwund. Forschen mit optischen Datenquellen Christoph Hoffmann ................................................................................ 143 5 Die Identität des Andern. Henri Bergson und die Pariser Weltausstellung 1889 Beat Wyss ................................................................................................ 161 Mediale Konfigurierung eines Ereignisses. Der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 Dietrich Erben ........................................................................................ 179 Narration und (De-)Legitimation: Der zweite Irak-Krieg im Kino Martin Seel ............................................................................................. 213 «Se non è vero, è ben trovato». Geschichtsklitterung in italienischen Doku-Soaps Aram Mattioli ......................................................................................... 229 Der «Hintersinn» der Bilder. Embleme barocker Klosterbibliotheken: Rätsel und Argument Hans-Otto Mühleisen .............................................................................. 245 6 Geleitwort Dieses Buch dokumentiert einen Tagungszyklus, den die Stiftung Lucerna und das Kulturwissenschaftliche Institut der Universität Luzern gemeinsam durchgeführt haben. Die Stiftung hat das Projekt finanziert, begleitet und mitverantwortet. Solche Kooperation ist eher unüblich. Aber sie entspricht den Bestimmungen der Stiftung Lucerna und der Arbeitsweise des Stiftungsrates: Die Stiftung «pflegt den interdisziplinären Diskurs – insbesondere im Bereich der Wissenschaften und Künste – und dessen Vermittlung an eine interessierte Öffentlichkeit». Damit gibt sie sich einen Auftrag, der eigentlich allgemein für die Wissenschaften gilt, nämlich gegebenenfalls die Grenzen der einzelnen Disziplinen zu überschreiten, sei es in der Forschung, in der Lehre oder in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. In diesem Sinn wirkt die Stiftung Lucerna durch jährliche Tagungen oder Workshops in Luzern. Dabei beschließen die Stiftungsräte nicht nur die Themen, sondern unterstützen und begleiten auch den Arbeitsprozess des jeweiligen Projektleiters. Man könnte die Stiftung Lucerna ein kleines, aber wissenschaftlich anspruchsvolles Bildungsinstitut nennen, wie es schon dem Luzerner Bankier Emil Sidler-Brunner vorschwebte, der 1927 die Stiftung gründete, als eine Luzerner Universität noch in ferner Zukunft lag. Heute «hat» Luzern eine Universität. Und die Stiftung hat es sich nicht nehmen lassen, mit ihr Beziehungen anzuknüpfen. Fürs Erste mit dem Kulturwissenschaftlichen Institut, dem sie in mancher Hinsicht nahe steht. Seit 2002 gehört dessen Leiter, Enno Rudolph, auch dem Stiftungsrat an. Aus dieser günstigen Konstellation hat sich das dreijährige Tagungsprojekt ergeben. Im Auftrag des Stiftungsrates hat er es geleitet und zugleich in den Studienbetrieb seines Instituts einbezogen. Es führt mitten in den heute ebenso notwendigen wie lohnenden Diskurs zum Thema «Bild». Ein besonderer Dank gilt Herrn Tobias Brücker und Dr. Alessandro Lazzari für die ebenso kompetente wie geduldige Herstellung des druckfähigen Manuskripts, ohne die der Band nicht hätte zustande kommen können. Für den Stiftungsrat: Rudolf Meyer 7 Alles ist Bild. Statt einer Einleitung Enno Rudolph Im Zeitalter der perfekten Visualisierungstechniken ist es zur totalen Erfassung der Lebensverläufe durch das Bild gekommen. Was im Bild erfasst ist, gilt als wirklich, tatsächlich oder gar wahr. Die Welt ist ihre Visualisierung. «Die Welt ist es, die mittels des Bildes ihr eigenes Selbstporträt macht».1 Dem Bild wird vertraut im Wissen um seine Nachträglichkeit, seine Abhängigkeit und seine Abbildhaftigkeit – gerade letzteres gilt als Authentizitätsbeweis. Ihm wird vertraut wegen seiner über allen Zweifel erhabenen Repräsentationsperfektion – garantiert durch den optimalen Standard der Visualisierungstechniken. Das Bild ist zwar mehr denn je abhängig vom Original, das es bloß vermittelt, aber es ist mehr denn je in der Lage, die Abwesenheit des Originals zu kompensieren, obwohl es dieses nur vermittelt. «Wir schalten jetzt direkt zu….»: die folgenden Bilder «sind» die Welt – in der Wohnstube. Ontologie und Repräsentation fallen zusammen – ein alter Philosophenkonflikt wurde ebenso elegant wie zeitgemäß gelöst, das Trauma von der Unerreichbarkeit der fernen Welt ist überwunden. Die Ambivalenz, dass für jedes Bild schon semantisch seine Defizienz mitgesagt und mitgegeben ist, dass es, wie getreu die Wiedergabe auch immer sein mag, immer «nur» ein Bild bleibt, wird nicht erlebt. Im Gegenteil: das Bild vertritt nicht nur auf authentische Weise das Original – es verdrängt es wie sein Über-Ich. Was Helmuth Plessner einmal generell von jeder Übersetzung behauptete – jede Übersetzung sei ein «Verrat am Original»2 – gilt natürlich gleichermaßen von der bildlichen «Übersetzung» des Originals in sein Abbild: das Original wird um seine Unvertretbarkeit geprellt. Es wird kopiert, es wird 1 2 Baudrillard (2010), 88. Vgl. Plessner (2003), 316. 9 multipliziert, es wird in den Schatten gestellt, sobald die Reproduktionen das erste «Blitzlicht der Welt» erblickt haben, ähnlich wie eine Originalmedizin ersetzt wird durch sein Generikum, das billiger ist, obwohl ihm stets irgendeine wesentliche Eigenschaft fehlt. Niemand merkt es: das ist das Geheimnis des Markterfolgs der nachgeahmten Welt, so wie das des Schattenspiels in Platons Höhle: solange niemand weiß, dass die Figuren Schatten sind, ist die Welt «in Ordnung». Und – ebenfalls wie bei Platon – niemand will es wissen. Darauf setzt die Bilderproduktion: niemand fragt nach dem Original, weil niemand es vermisst. Von dieser Manipulierbarkeit, von jenem Verrat zehrt jede Bildpolitik. Nota bene: es kommt hinzu, dass Platons im besagten Gleichnis erzielte Wirkung einer Sehnsucht nach dem Original, dem ursprünglichen Licht als Symbol des Guten, im Kontext unverständlich scheint: Platons Welt ist nach seinem eigenen Bekunden nämlich ein Bild, erstellt nach einem Original, das überhaupt erst als Bild die Wirkung erhält, die sein Zweck ist: bei Platon ist also das Original abhängig von seinem Abbild; ohne dieses bleibt es defizitär. Nur – dieser philosophische Mythos weiß es sogar: wenn die Welt ein authentischer Lebensraum sein soll, dann darf sie nicht second hand sein. In Platons Bildwelt fallen Original und Bild zusammen. Der Befund von der modernen Welt, die ihre eigene Visualisierung ist, bleibt vor diesem Hintergrund zwiespältig: als Ergebnis der Gegenwartsdiagnose ergibt sich, dass Visualisierung, verstanden als die mit ihrem Bild identisch gewordene Welt, zu einer Methode der Vergleichzeitigung geworden ist. Visualisierung schafft Partizipation aller an allen und allem – Akteure an jedem Teil der Welt können sich ihrer Zuschauer an jedem anderen Teil gewiss sein: frei nach Kant kann ein Unrecht, das an irgendeinem Teil der Welt begangen wird, nunmehr an jedem anderen Teil der Welt gesehen werden – Kant musste noch auf die Solidarität des Gefühls setzen, während im Zeitalter der totalen Visualisierung auf die Augenzeugenschaft gesetzt werden kann: die Welt ist ein panoptisches Subjekt und Objekt in einem. Und noch etwas: nie wurde – philosophisch gesprochen – die Gegenwart so wenig zwischen Vergangenheit und Zukunft zerrieben, wie «gegenwärtig». Das dem Auge vermittelte Geschehen bedarf nicht nachträglicher Beglaubigung ungebrochener Gültigkeit; als Nachricht über das Jetzige im Jetzt kennt es kein Verfallsdatum. Geschichte wird vor ihrer Vergänglichkeit bewahrt, 10 Vergangenheit von der Gegenwart überboten, Zukunft von der Gegenwart eingeholt. «Visionen» sind nicht mehr Sache prophetischer Spezialkompetenzen, sondern Alltagsbeschäftigung von jedermann. Wer in der Gegenwart lebt, ist sorglos; Sorgen rechnen mit Zukunft. Alles bis hierhin Gesagte gilt allerdings nur von einem einzigen Bildtyp und beansprucht von daher lediglich eine eingeschränkte Bedeutung: es gilt vom Bild als Zeichen für eine bildlich externe Wirklichkeit, nach der allerdings, der raffinierten Vergleichzeitigungstechnik wegen, nicht mehr gefragt wird. Dennoch: diese versteckte und verdrängte Abhängigkeit sorgt dafür, dass diese Bilder die Welt niemals um Ereignisse bereichern, die nicht schon die Welt sind. Sie sind weder innovativ, noch – als Bilder – überraschend, mögen die Ereignisse, für die sie stehen, es noch so sehr sein. Es bleibt dabei – sie zeigen immer nur auf etwas, was origineller ist als sie, auch wenn ihre Betrachter das Medium mit dem Mediatisierten identifizieren. In der Konkurrenz mit Bildern, die kein Ereignis «illustrieren», sondern die «selbst» ein Ereignis herstellen,3 besser: ein Ereignis «sind», können sie nicht bestehen. Ihnen bleibt auch hier nur der eher peinliche Versuch, sich als das wohlfeilere Double zu empfehlen. Bilder, angesichts derer niemand auf den Gedanken käme, zu fragen, was sie darstellen, sind solche, die die Frage nach einem Original kraft ihrer Originalität obsolet machen. Wer immer ein solches Bild schafft, ist ein Künstler; wann immer sich einer Künstler nennt, verpflichtet er sich, ein solches Werk zu schaffen. Ein Bild, das die Frage nach seiner Legitimation durch ein Original erübrigt, ist autonom. Es zeigt auf sich, nicht auf anderes,4 es ist in diesem Sinne intransparent,5 vor allem aber ist es ein «Ereignis» im strengen Sinne des Wortes: keines nämlich lediglich «in» der Welt, wie diejenigen, die die Welt sind, indem sie auf sie zeigen, sondern Ereignis «von» Welt. Man hat aufgehört, zu definieren, was Kunst ist, lange bevor durch Hegel oder Danto deren «Ende» ausgerufen wurde. Kant, unentbehrlich für alle diejenigen, die, wie Adorno oder Heidegger, einen Projektionsschirm benötigen, um zu sagen, was sie ablehnen, hat das Kunstwerk definiert als eines, 3 4 5 Vgl. Baudrillard (2010), 85. Vgl. Boehm (1995), 16, 30. Vgl. Wiesing (1996), 269. 11 das durch seine Existenz neue Maßstäbe setzt für… die Kunst.6 Aber wer war der erste Künstler? Und – Maßstäbe nur für die Kunst und ihre Produzenten? Oder auch für ihre Betrachter und Konsumenten? Wenn ja, wer entscheidet, wann und durch wen die alten Maßstäbe durch die neuen annulliert werden? Diese Fragen lassen sich nicht befriedigend beantworten. Kant hat sie im Übrigen selbst wieder dementiert, indem er eine Hermeneutik des Kunstwerks mitgeliefert hat, die verdeutlicht, wie ein Kunstwerk, gerade auch ein Bild, sich als Kunst erweist, nämlich durch eine unnachahmliche Wirkung: Kunst befreit. Sie befreit von der Welt durch Schaffung einer neuen, die sie ist. Das können keine transparenten Bilder, das können nur Bilder ohne Referenz – und Legitimationsbedarf. Das können nur die Bilder, deren Betrachtung einer Entdeckungsreise gleichkommt, die das ganze Leben kostet. Ein solches Bild ist von der Evidenzqualität einer Metapher, deren Originalität nicht in dem Bild zu suchen ist, das sie versprachlicht, sondern in der Verknüpfung mit einer Bedeutung, die sie visualisiert. Die Metapher gibt ein Exempel für das, was ein autonomes Bild leistet: Erzeugung von Faszination davon, wie mit Bekanntem, nämlich Farben, Flächen, Figuren, Unbekanntes sichtbar geschaffen werden kann, keine sekundäre Visualisierung, sondern visualisierte Originalität. Goyas schlafende Vernunft zum Beispiel demonstriert pars pro toto, wie die vertrauten Dimensionen des Lebens um unvertraute komplementiert werden. Der Blick auf das Bild perzipiert dies im Nu: wie die Metapher im Allgemeinen, sofern sie nicht zum Arsenal der «toten Metaphern» gehört, so wirken die autonomen Bilder im Besonderen durch Evidenz des Neuen, Unerhörten, Unnachahmlichen und Unerschöpflichen. Jedes solcher Bilder ist sich selbst genug; jedes solcher Bilder kann nur über die Sicht zur Einsicht führen; jedes solcher Bilder wird von keiner Einsicht endgültig erschlossen. Es gibt sie noch, die autonomen Bilder, nicht nur in den eigens für sie reservierten Ghettos. Es gibt sie immer wieder und überall. Anders als die Weltvisualisierungen müssen sie sich ihre Räume immer wieder neu erobern. Seit dem definitiven «Machtwechsel» vom Bild zum «Bild von» – und um seinen 6 12 Vgl. Kant (2009), § 46. Nachvollzug geht es in diesem Band – von der Kunst zur technischen Reproduktion, sind die Chancen dafür allerdings nur noch minimal: weil die Welt satt ist von Bildern, satt von der permanent selbst produzierten Konfrontation mit ihrem Selbstporträt, und sie ist deren ebenso überdrüssig, wie ihr verfallen. Der Blick für die Sicht auf ein autonomes Bild ist verstellt, nicht, wie es Adornos Gebetsmühle seinen Lesern unaufhörlich einhämmert, weil «die Gesellschaft» in Form tragischer Selbstverleugnung ihre Autonomie verrät – «die Gesellschaft» als Akteur gibt es nicht –, sondern weil wir neidisch sind auf das Genie, auf seine Energie und seine Freiheit, und weil wir ihm deshalb unter dem Schein der Großzügigkeit lediglich das Menschenrecht auf die Ausnahme zubilligen. Das Bild im «Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit»7 triumphiert nachhaltig über das Bild aus den Zeitaltern seiner künstlerischen Produzierbarkeit. Das erstere will etwas bedeuten, indem es auf etwas deutet; das letztere will nichts bedeuten müssen – «es will etwas sein»: Autonome Bilder «wollen nicht Gebrauchsanweisungen für Illusionen, Eröffnungen der Sichtbarkeit für anderes sein; sie wollen selbst das und nichts weiter als das sein, als was sie ‹sich› darstellen»8 – und nicht «was» sie darstellen. «Damit uns sein Inhalt anspricht, muss das Bild durch sich selbst existieren, uns seine ursprüngliche Sprache auferlegen».9 Es sind die Maler selbst, die entscheiden, was sie machen. Magrittes Ceci n’est pas une pipe pfeift den Betrachter zurück, ehe er versucht ist, das Bild mit einem Photo zu verwechseln: dies ist keine Pfeife, «dies ist ein Magritte» (Stoichita). Und noch einer musste es wissen: Henri Matisse, der berichtet, wie er zum ersten Mal ein Fresko Giottos sah, ohne zu wissen, um welche Szene aus dem Leben Christi es sich handelte: «Une œuvre doit porter en elle-même sa signification entière et l’imposer au spectateur avant même qu’il en connaisse le sujet. (...) tout de suite, je comprends le sentiment qui s’en dégage, car il est dans les lignes, dans la composition, dans la couleur, et le titre ne fera que confirmer mon impression».10 7 8 9 10 Benjamin (1963). Blumenberg (2001), 117. Baudrillard (2010), 80. Matisse (1972), 49f. 13 Das Luzerner Projekt war von der Diastase zwischen autonomen und heteronomen Bildern ausgegangen, ohne diesen Befund als Kulturdefizit zu diagnostizieren. Im Gegenteil: Das fröhliche Durcheinander von Kunst, Technik und affektiver Improvisation ist ein Spiel der Zeit mit sich selbst, nach dessen Freiheit sich spätere Generationen noch einmal zurücksehnen könnten. Das Buch spiegelt diese Lage wieder – bewusst. Es bietet allen etwas – den Autonomen, den Konformisten, den Pluralisten. Es ist das unzensierte Dokument einer vorläufigen Bilanz aus der diskursiven Perspektive betroffener und weniger betroffener Disziplinen. Literatur Baudrillard, Jean. Die Intelligenz des Bösen, Wien 2010. Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt a.M. 1963. Blumenberg, Hans. Ästhetische und metaphorologische Schriften, Frankfurt a.M. 2001. Boehm, Gottfried. «Bildbeschreibung. Über die Grenzen von Bild und Sprache». In: Ders. / Helmut Pfotenhauer. Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung, München 1995, S. 11–38. Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft, Hamburg 2009. Matisse, Henri. Écrits et propos sur l’art, Paris 1972. Plessner, Helmuth. «Der Mensch als Lebewesen. Adolf Portmann zum 70. Geburtstag (1967)». In: Ders. Conditio Humana. Gesammelte Schriften VIII, Frankfurt a.M. 2003, S. 314–327. Wiesing, Lambert. «Phänomenologie des Bildes nach Husserl und Sartre». In: Phänomenologische Forschungen 30 (1996), S. 255–281. 14 Verlorene Meisterwerke. Über einen Mythos1 Bernd Roeck I. Holzer 1738 bemalte der junge Tiroler Johann Evangelist Holzer die Fassade eines Wirtshauses in Augsburgs Altstadt, damals einem Handwerkerviertel, mit Fresken, die Bauernburschen und ihre Mädchen beim Tanz zeigten.2 Die Bilder, schon im 18. Jahrhundert verblasst und heute ganz verschwunden, machten den unscheinbaren Bau zum Anziehungspunkt für kunstliebende Reisende wie den in bayerischen Diensten stehenden Arzt Bianconi.3 Auch nachmals berühmte Leute waren darunter, etwa der italienische Aufklärer Francesco Algarotti und Goethe. Letzterer – er war auf der Durchreise nach Italien – meinte 1790, Holzers verloschene Bilder seien ihm lieber «als ein ganzes Lokal mit wohlkonservierten Gemälden, außerdem die Fröhlichkeit und Freiheit vergleicht sich mit nichts und um ein Haar, so könnte ein reiner Geschmack dennoch dadurch befriedigt und der Teufel hole den Geschmack, der ernst und traurig ist». Und er schloss: «Augsburg dagegen im Sonnenschein».4 Holzers Ruhm strahlte hell schon kurz nach seinem frühen Tod, der ihn 1740, als erst 31jährigen, ereilte.5 Mit Johann Georg Christoph Kilian fand er einen Biographen; der Spross einer renommierten Kupferstechersippe widmete ihm 1765 ein «Kunst- und Ehrengedächtnis».6 Die Kunstkritik rühmte den 1 2 3 4 5 6 Eine Kurzfassung dieses Beitrages erschien unter dem Titel «Das verlorene Meisterwerk. Übermalt, gestohlen, versunken: Kunst wird interessant, wenn sie verschwindet. Über die Magie des blinden Flecks» in der Süddeutschen Zeitung vom 20.08.2011, S. 14. Das Folgende nach Roeck (2010a). Vgl. Bianconi (1964), 82f. Goethe (1900), Abt. 1, 49, 277. Eine Übersicht über den Nachruhm Holzers: Lamb (1955); Mick (1984), 7; Wagner (1991), 45–54, 372f. Kilian (1756). Vgl. Herre (1951), 45. 15 Abb. 1: Johann Evangelist Holzer, Entwurf für die Freskenbemalung der Fassade des Gasthauses «Zum Bauerntanz» © Städtische Kunstsammlungen Augsburg 1709 geborenen Sohn eines wohlhabenden Vintschgauer Müllers als «groß», als «genialen Maler», «pictor ingeniosus»,7 «Genie»,8 «frühvollendetes Malergenie» oder – das passt zu Goethes Sonnenschein – als «helles Licht der Barock­ malerei».9 Noch die neuere Kunstgeschichte stilisiert ihn zur Ausnahmegestalt. So steht Holzer in der Geschichte der Spätbarockmalerei ziemlich einzigartig da. Die Gründe sind allerdings nicht einfach zu erklären. Holzer war zwar tatsächlich ein hervorragender Freskant. Selbst Johann Joachim Winckelmann hat ihn als «würdigen Künstler» akzeptiert.10 Holzers bedeutendstes erhaltenes Werk ist ein um 1736 entstandenes Deckenfresko in der Wallfahrtskirche St. Anna in Partenkirchen. Der größte Teil seines Werks ist aber verloren oder, wie eine Arbeit in der Sommerresidenz der Eichstätter Fürstbischöfe, schlecht erhalten. Sonst ist nur wenig seiner Hand überkommen, vergangen wie die Fassadenfresken am «Bauerntanz». 7 8 9 10 16 Hascher (1996), 95. Vgl. Lamb (1955). Wagner (1991). Lamb (1955), 382; Krämer (1998), 515. Auch andere Fassadenmalereien sind zerstört, ebenso Holzers Hauptwerk, die Kuppelfresken der Klosterkirche Münsterschwarzach am Main, die 1821 abgerissen wurde.11 Auch sie, «Holzer’s masterpiece», wie ein englischer Zeitgenosse beklagte,12 inzwischen eben ein Nichts, wurden zu mythischen Meisterwerken: Keinem anderen barocken Freskenzyklus sei, wie Bruno Bushart urteilt, ein «so lebhafter Nachruhm» beschieden gewesen wie dieser 1737 – 1739 geschaffenen Ausmalung. So haben sich die Urteile auf einige Zeichnungen, Stiche und Ölbilder zu gründen; auch von den BauerntanzFresken sind nur Nachstiche und eine aquarellierte Zeichnung (Abb. 1) überkommen. Die fragmentarische Überlieferung zeigt Holzer zweifellos als Könner; doch kann seine Malerei mit den Werken der internationalen Elite von Watteau und Chardin bis zu Tiepolo nicht mithalten. Die Vermutung liegt daher nahe, dass Holzers außerordentlicher Nachruhm Gründe hat, die nicht allein in der Qualität der Werke zu suchen sind. Die Suche danach führt auf die Geschichte des «verlorenen Meisterwerks». II. Verblasst, verschwunden, vernichtet Das unsichtbare Meisterwerk ist der Spezialfall unsichtbarer Kunst und ein Paradox.13 Ihr Gegenstand ist etwas Fehlendes, ein Nichts. Texte und Abbildungen feiern einen Gegenstand, der sich gleichsam ins Transzendente verflüchtigt hat. Das konkrete Ding ist zur Idee geworden. Der Verlust mag ein Grund zur Trauer sein; Jacob Burckhardt weist darauf hin, dass Verluste auch positive Wirkungen zeitigen könnten: Wenn z.B. im 15. Jahrhundert plötzlich große Massen wohlerhaltener griechischer Skulpturen und Malereien wären gefunden worden, so hätten Lionardo, Michelangelo, Raffael, Tizian und Correggio nicht schaffen können, was sie geschaffen haben, während sie mit dem von den Römern ererbten wetteifern konnten. 11 Vgl. Lamb (1955), 373; Schütz (1986), 94. 12 Bushart (1967), 102. 13 Vgl. Belting (1998). 17 (…) Freilich würde wohl nach einigen Jahrzehnten der Störung, nach dem ersten Erstaunen das massenhaft vorgefundene Alte mit dem Neuen sich auseinandergesetzt und das Neue seine eigenen Wege gefunden haben, – allein der entscheidende Augenblick des Vermögens der Blüte, welcher nicht mehr in seiner vollen Höhe wiederkehrt, wäre vorüber gewesen.14 So aber sei genug Altes vorhanden gewesen, «um anzuregen, und nicht so viel, um zu erdrücken».15 Die Sehnsucht nach dem Untergegangenen habe, so resümiert er, auch Vorteile: «Ihr allein verdankt man es, dass noch so viele Bruchstücke gerettet und durch eine rastlose Wissenschaft in Zusammenhang gesetzt worden sind; ja Verehrung der Reste der Kunst und unermüdliche Kombination der Reste der Überlieferung machen einen Teil der heutigen Religion aus».16 In der Tat, die Kunstgeschichte hat mit jenem Vakuum ein weites Forschungsfeld. Die Menge verlorener Werke übertrifft das Erhaltene um ein Vielfaches. Materie ist eben vergänglich; Mensch und Natur neigen gelegentlich dazu, ihren Untergang noch zu beschleunigen. Ein imaginäres Museum unsichtbarer Meisterwerke bewahrte Schätze ohnegleichen, Unmengen übermalter, verbrannter, im Meer versunkener oder zerbombter Kunst, angefangen mit dem Tempel Salomons und sechs der sieben Weltwunder der Antike. Zu sehen wären Bilder der legendären griechischen Maler Zeuxis, Parrhasios und Apelles, von denen kein Pinselstrich überkommen ist, die gleichwohl – oder gerade deshalb – den Meistern der Renaissance als unerreichbare Ideale vor Augen schwebten. Antike, mit den Galeeren, die sie transportierten, im Meer versunkene oder in Roms Kalkmühlen zermahlene Figuren wären zu sehen, dazu auch unzählige mittelalterliche, von Bilderstürmern der Reformationszeit oder während der Französischen Revolution zerstückelte Plastiken und Altarbilder. Wir sähen vielleicht Piero della Francescas Fresken in Ferrara oder im Vatikan, dazu gestohlene Kunstwerke; Raffaels einst in Warschau befindliches Porträt eines jungen Mannes, Vermeers Bostoner Konzert, 14 Burckhardt (1929), 207. 15 Ebd. 16 Ebd., 206. 18 Abb. 2: Leerstelle der gestohlenen Mona Lisa, Fotografie, 22. August 1911 © Süddeutsche Zeitung Foto / Rue des Archives 19 Caravaggios Geburt Christi. Die Abteilung «18. Jahrhundert» hätte im Bernsteinzimmer ein Glanzlicht, die Moderne erhielte mit Tracey Emins Lotterbett, das 2004 durch Brand zerstört wurde, ihren sensationellen Schlusspunkt. Die blinden Flecken, die gestohlene oder vernichtete Kunst hinterlässt, können sehr augenfällig sein – etwa im Fall der Nischen, die bis 2001 die von den Taliban in die Luft gesprengten Buddhas von Bunjian beherbergt hatten oder der leeren Vitrine in Wiens Kunsthistorischem Museum, in der das 2003 gestohlene (inzwischen wiedergefundene) Salzfass Cellinis aufbewahrt wurde. Durch den dreisten Raub wurde die Salina noch berühmter, als sie ohnedies schon gewesen war. Die berühmteste Leerstelle der Kunstgeschichte öffnete sich vor einem Jahrhundert, am frühen Nachmittag des 21. August 1911, nachdem der Anstreicher Vincenzo Peruggia und zwei Komplizen die Mona Lisa aus dem Salon Carré des Louvre entführt hatten.17 Bald drängte sich das Publikum vor dem blinden Fleck der nackten Wand, aus der vier verwaiste Nägel ragten (Abb. 2). Damals erklomm die Gioconda den Gipfel ihres Ruhmes. Erst 1913 wurde sie in einem Florentiner Hotel aufgespürt, als ihr Dieb sie zu Geld machen wollte. Der eigentliche Grund für den einzigartigen Ruhm der Gioconda liegt erneut in blinden Flecken. Diesmal klaffen sie im Kontext. Die Menge Erörterungen, die über das Bild geschüttet wurden, ist der Ausdehnung der Leerstellen in der Überlieferung zu seinen Entstehungsumständen indirekt proportional. Das Schweigen der Quellen und die Zweideutigkeiten der Kunst werden vielfach zum Stimulans für die Genese und Häufung von «Kontexten». Das Fehlen von Dokumenten befreit die Flüge der Phantasie. Die blinden Flecken gewährleisten, dass das Mysterium des Meisterwerks unbeschädigt bleibt. Spektakuläre Episoden in der «Biografie» eines Kunstwerks – der Raub der Saliera oder der Mona Lisa, der Diebstahl von Piero della Francescas Flagellazione – bereichern jene semantischen Passepartouts, die wesentlich für jedes Kunstwerk sind, es oft als Kunstwerk überhaupt erst wahrnehmbar machen. 17 Vgl. Reit (1981); Sassoon (2006). 20 III. Kunstwerke und Kontexte Was ein «Meisterwerk» sein soll, lässt sich notwendig nur aus historischen Bezügen bestimmen. Alle Kunst hat ja ihren Ort in Traditionen und Genea­ logien; nur die Rekonstruktion größerer historischer Zusammenhänge kann zeigen, dass, was seine Autorin oder sein Autor schuf, zuvor noch nie dagewesen war. Lassen wir diesen Punkt als Selbstverständlichkeit beiseite; jedes wirklich bedeutende Kunstwerk bietet etwas Neues, ist originelle intellektuelle oder wenigstens innovative technische Leistung. «Nachfolgen», erst recht Kopien haben natürlich keine Chance, den Olymp der Kunstgeschichte zu erklimmen. Aber was macht das «mythische» Meisterwerk aus? Jede Epoche, jede Kultur hat ihren eigenen Begriff davon, hat ihre eigene Galerie mythischer Kunstwerke. Im Wort klingen Vorstellungen an von Ruhm, von Legende; ein Element des Vagen, Unbestimmten auch und somit ein Geheimnis, das fasziniert, herausfordert und zur Entschlüsselung anhält. Sie wird, ja sie darf niemals ganz gelingen, weil mit der Auflösung auch der Mythos zerstört wäre: Der dingfest gemachte Gott verliert seinen überirdischen Nimbus und ist kein Gott mehr. Sind die Ursprünge eines Kunstwerks mit Dokumenten rekon­ struiert, verschwindet im grellen Scheinwerferlicht der Hermeneutik das märchenhafte Zwielicht, in dem er bis dahin verborgen war. Die «ganze Wahrheit» ist womöglich banal und sie wird, sobald man sie kennt, langweilig. Die Leerstelle,18 womöglich das Nichts ist deshalb überhaupt konstitutiv für das mythische Meisterwerk. Es dürfte allerdings kein Kunstwerk geben, das solche Zonen des Unbestimmten, ja des Unbestimmbaren nicht aufweist. Nicht alles zu sagen, die Dinge nicht 1:1 mitzuteilen, gehört im Zeitalter der Kunst zu deren Wesen – spätestens in dem Moment, in dem das mimetische Ideal seine absolute Geltung einbüßt. Das ist mit den ersten kunsttheoretischen Reflexionen der Neuzeit der Fall. Cennino Cennini konzediert am Ende des 14. Jahrhunderts, die Malerei könne Dinge, die nicht sind, zeigen, als wären sie wirklich; das heißt, er gewährt der Einbildungskraft eine Funktion bei der Entstehung des Kunstwerks, das eben nicht einfach die Dinge so 18 Literaturtheoretische Parallele: Vgl. Stierle (1997), 312. 21 widerzuspiegeln hat, wie sie sich dem Auge darstellen.19 Alberti konstatiert zwar trocken, das Unsichtbare ginge den Maler nichts an; gleichwohl verlangt er in seinem Malereitraktat vom Maler beispielsweise, Figuren gemäß ästhetischen Kriterien zu arrangieren oder auf harmonisches Kolorit zu achten; seine Ästhetik folgt im Übrigen rhetorischen Kategorien.20 Im 15. Jahrhundert ist selbst das fromme Kunstwerk, im Speziellen das Bild, längst nicht mehr Reliquie. Doch soll es auch nicht einfach Replik der Wirklichkeit sein und damit ein Gegenstand, dessen Herstellung allein handwerkliches Geschick erfordert. Es wird geistige Leistung; die Phantasie mit ihren Unwägbarkeiten schiebt sich zwischen Natur und realisiertes Werk. Die Imagination gewinnt an Bedeutung, was sich auch in der Theorie niederschlägt. Wiederum schon Cennini hat diesen Gedanken.21 Dürer meint, der Maler bilde Neues aus den Bildern, die er im Herzen gesammelt habe; ein guter Maler ist denn auch, wie es in seiner berühmten Formulierung heißt, «jndwendig voller vigur».22 Würde er ewig leben, «so het er aws den jnneren ideen, do van Plato schreibt, albeg etwas news durch die werck aws tzwgissen».23 Damit wird auch der Concetto immer wichtiger. Michelangelo bringt den Gedanken um 1544 in einem berühmten Sonett zum Ausdruck: «Non ha l’ottimo artista alcun concetto / c’un marmo solo in sé non circonscriva / col suo superchio, e solo a quello arriva / la man che ubbidisce all’intelletto» (Der beste Künstler selbst hat niemals einen Plan, / den nicht der Marmor schon in seiner Fülle schlösse ein; / und hin zum Werk gelangt allein / die Hand, die seinem Geist ist untertan).24 Damit gewinnt die Zeichnung als sein materieller Niederschlag immer größere Dignität; bald avanciert sie zum als Preziose geschätzten Sammlerstück. Parallel zur neuzeitlichen Säkularisierung vollziehen sich merkwürdige Inversionen. Selbst das religiöse Kunstwerk ist immer weniger nur Andachtsinstrument, Accessoire der Liturgie oder gar magischer Fetisch; es kann 19 Pfisterer (2001), 315. 20 Vgl. Baxandall (1977), 129f.; Hulse (1990), 60–65; Hope (2000); Rosand (1987), 153–157. 21 Cennini (2001), 15. 22 Dürer (1969), 287. 23 Vgl. Panofsky (1982), 69–71. 24 Buonarroti (1960), 151. 22 Sammlungsgegenstand werden, seit dem späteren 17. Jahrhundert selbst in calvinistischen Gesellschaften.25 Früher schon wird der Verlust an Sakralität durch eine Metamorphose der magischen Aura um das große, wenn man will: mythische Kunstwerk substituiert. Es wird zur Reliquie eines neuen Heiligen, des Künstlers. Schon im 15. Jahrhundert, bei Alberti, wird er, der sein Werk nicht einfach mit dem Geschick seiner Hände schafft, sondern kraft des Logos, zum göttergleichen Demiurgen.26 Michelangelo ist der erste, dem das Epitheton des divino beigegeben wird; Ariost verleiht es ihm in der dritten Ausgabe seines Orlando furioso (1532).27 Andere, namentlich Vasari und im Norden dann Karel van Mander spinnen am Gewebe des Künstler-Mythos weiter; dass die Einsicht in die intellektuellen Voraussetzungen von Kunst für diese Konstruktion von wesentlicher Bedeutung ist, liegt auf der Hand. Ist das Kunstwerk nicht mehr einfach Handwerksprodukt, sondern geistige Leistung, gewinnen sein Autor oder seine Autorin an Bedeutung; diese Entwicklung vollzieht sich zwischen dem ausgehenden Mittelalter und der Gegenwart. Indem das Kunstwerk Bedeutung vor allem als Hervorbringung eines bestimmten Individuums gewinnt, werden sein historischer Ort und damit überhaupt seine Geschichte wichtig, auch für seine Ästhetik. Kontexte, Paratexte – Signaturen, Etiketten, Dokumente, auch Anekdoten, mithin Geschichten und Geschichte – gewinnen an Relevanz; der Ort, an dem sich ein Kunstwerk befindet, der Sockel, auf dem es steht, die Vitrine, die es birgt, gewinnen entscheidende Bedeutung in jenem semantischen Komplex, weil dadurch sein Status, seine Position in der Zeit auch, definiert werden. Duchamps Readymades, Beuys’ Fettecke oder ein Haufen aus Videogeräten, wie ihn Nam June Paik aufzutürmen liebt, werden allein durch ihre Platzierung in der Galerie und ihre Paratexte zu Kunst. Ihre Ästhetik hat ihren Grund darin und in ihrer Geschichte. Sie sind Kunstwerke, weil sie eben von Marcel Duchamp, Joseph Beuys und Nam June Paik sind, Produkte ihres Geistes; in vielen Fällen – man denke an Jeff Koons’ Plastik-Arrangements – spielt die Hand des Meisters nur noch eine Rolle, wenn das Projekt zu skizzieren ist; die Ausführung übernehmen versierte Techniker. Das Objekt ist primär eine intellektuelle Schöpfung; seine Materi25 Vgl. Loughman / Michael (2000), 48f. 26 Mit der Quellenangabe Roeck (2010b), 156. 27 Soussloff (1997), 34–37. 23 alisierung dient allein der Kommunikation des unsichtbaren Gedankens. Nun braucht der Künstler wirklich keine Hände mehr.28 Was sich geändert hat, mag ein Bild wie Klimts Goldene Adele im Vergleich mit Malerei der Renaissance demonstrieren: Während erstere im Juni 2006 für 135 Millionen US-Dollar versteigert wurde, machte das für Altarbilder der Zeit zwischen 1400 und 1475 verwendete Blattgold gewöhnlich zwischen 30 und 40 Prozent der Gesamtkosten aus;29 der entsprechende Kostenanteil des von Klimt verwendeten Edelmetalls lässt sich vermutlich nicht einmal in Promillewerten beziffern. Erst recht unbedeutend sind die Kosten von Material und die Relevanz der Handwerkskunst an Werken von «Renaissance-Superstars» wie Leonardo, auch wenn man staunend die Unzahl der Lasuren registrieren wird, vermittels derer es dem Mann aus Vinci gelang, das Inkarnat seiner Mona Lisa zu modellieren, zarte Schattierungen und Übergänge zu schaffen, den Hintergrund mit seinem berühmten Sfumato zu zelebrieren. Eine Digitalkamera bringt dergleichen heute in Sekundenbruchteilen zustande. Zudem entspricht das Aussehen der geheimnisvollen Florentinerin einem modernen Schönheitsideal nur in Maßen. Nein, die Mona Lisa wird als Werk des beginnenden 16. Jahrhunderts und als «Reliquie» des nicht minder geheimnisvollen Leonardo da Vinci zum Bild aller Bilder. Es ist gleichsam von einem doppelten Mysterium umgebener Überrest eines modernen Ersatzgottes. Ähnlich verhält es sich, mutatis mutandis, bei anderen Kunstwerken. Immer gilt: Kein Kunstwerk ist jenseits seiner Zeit, jenseits der Geschichte, erfahrbar. Die furiose Attacke, die Susan Sontag gegen das «Geschwätz der Interpreten» vorträgt,30 gründet allein in der romantischen Illusion, die Begegnung mit Kunst könne den Charakter einer unio mystica haben, die sich in reinem Schweigen vollzieht, wie Sontag in ihrem Essay The Aesthetics of Silence meint. Reine Kunsterfahrung, ohne Historie, ohne Kontexte, zu gewinnen in «ästhetischer Unschuld»31 ist, wenn, dann nur für den 28 29 30 31 24 Zur Geschichte dieses Topos: Beyer (1996). Kubersky-Piredda (2005), 105. Vgl. Sontag (1968); Wohlfahrt (1995). Kuhn (1960), 35. Augenblick denkbar: Da mag sich der Realitätsbruch vollziehen,32 das, was die Medientheorie presence nennt. Aber selbst jener Moment unmittelbarer Evidenz erfolgt nicht ohne Vorgeschichte, ohne Wissen um Ort, Zeit, um Etiketten, Signaturen und andere Texte. Dass Bestimmungen historischer Umstände für das ästhetische Erlebnis – und den materiellen Wert eines Kunstwerks – von zentraler Bedeutung sind, ist klar; Kunst wird ja immer primär als Produkt einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Künstlers oder einer Künstlerin erfahrbar. Im Museum gilt der zweite Blick nach der Wahrnehmung des Werks gewöhnlich dem Etikett, der dritte Signatur und Jahreszahl, mithin dem unmittelbarsten Kontext. Wie sehr Lücken darin die Werke verändern können, deutet das Schicksal des Mannes mit dem Goldhelm an, der inzwischen vom gefeierten «Rembrandt» zum mutmaßlichen Werk eines Augsburger Malers, der ausgerechnet den Allerweltsnamen «Mayr» trägt, mutiert ist. Ebenso wurde die Madonna Litta der Petersburger Ermitage zu einem anderen Bild, seit ihr Schöpfer nicht mehr der mythische Leonardo ist, sondern Angelo Boltraffio, der vielleicht nach einem Entwurf des Giganten arbeitete. Ein schlechteres Bild ist sie deshalb ebensowenig wie Mayrs Behelmter; beiläufig bemerkt, schlägt sie ihr Gegenüber, die Madonna Benoit – die zweifelsfrei von Leonardos Hand ist – um Längen: das Frühwerk des Meisters zeigt ein Baby mit übergroßem, unförmigem Schädel, Maria ist außerdem für eine Mutter reichlich jung. Das Werk ist aber, obwohl einer ordentlichen Madonna, etwa Correggios, weit unterlegen, eben von Leonardo und deshalb der Rede wert. Im Bestreben, «das Phänomen zu retten», führt die Kunstgeschichte in diesem und ähnlichen Fällen dann alle möglichen Hilfshypothesen ein, etwa, dass die Jugend der Madonna auf deren Jungfräulichkeit anspiele und dergleichen mehr. Wäre die Madonna Benoit nicht von Leonardo – es gäbe wohl wenig Lärm um sie zu machen. Die Mitteilung von Zeit, Ort und Schicksalen eines Werkes umfasst Aufschlüsse über seine Zeugenschaften: zunächst das Wissen um seine Präsenz in der längst zerfallenen Welt, der es entstammt,33 auch den ebenso zerfallenen 32 Vgl. Gehlen (1986), 11f.; aus ontologischer Sicht: Brandt (1999), 126f. 33 Vgl. Heidegger (1997), 36. 25 Welten, die es im Lauf seiner Biographie umgaben. Wäre Cellinis Saliera, kennten wir nicht die abenteuerliche Autobiographie ihres eitlen Schöpfers, ein rechtes Mantel- und Degenstück?34 Wären Velázquez’ Meninas dieselben, hätte nicht Foucault eine der berühmtesten Ekphraseis des 20. Jahrhunderts vor ihnen niedergeschrieben?35 Auch die Mona Lisa erklomm in der Zeit ihrer Abwesenheit einen Gipfel ihres Ruhmes. Der Öffentlichkeit scheint jetzt erst wirklich bewusst geworden zu sein, was da verloren schien: die wohl teuersten Quadratzentimeter der Welt. Ein schöner Beleg aus neuerer Zeit ist ein Siebdruck Andy Warhols, der sich im Nachlass des Schauspielers und Regisseurs Dennis Hopper befand, ein Porträt Mao Zedongs: Das Werk weist Einschusslöcher von Pistolenschüssen auf, die sein Besitzer Anfang der Siebziger Jahre aus welchen Gründen auch immer auf die Ikone abfeuerte; Warhol selbst kritzelte daraufhin die Worte warning shot und bullet hole neben die Beschädigungen (Abb. 3). In der Auktion bei Christie’s am 11. Januar 2011 kletterte das Bild von ursprünglich veranschlagten 30.000 Dollar auf über das Zehnfache seines Schätzpreises. Es war jetzt sozusagen ein verdoppelter Warhol und zudem ein Hopper, in jedem Fall ein Unikat. Und es war zum Zeugen einer Geschichte geworden, die sich über Internet und Nachrichtenagenturen samt Reproduktionen in alle Welt verbreitete. Reden, Schreiben, übrigens auch Rechnen – Essays, kunsthistorische Texte, die signifikanten Zahlen der Auktionskataloge – kurz, das große, niemals verstummende Geräusch innerhalb der Art world,36 sind entscheidend für die Bestimmung der Qualität eines Werkes. Einen absoluten Maßstab dafür gibt es nicht; es ist der Diskurs, der, womöglich nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten, darüber befindet, der auch die Pforten zum Walhall des Kanons «unsterblicher» Werke öffnet. Die Mona Lisa lässt sich ebensowenig als zeitlose Schönheit erfahren wie die Fettecke von Beuys oder eine Installation von Matthew Barney. Besondere Bedeutung auch für die Genese mythischer Werke kommt dabei der Reproduktion zu. Ist es wirklich so, dass die technische Reproduktion das Hier und Jetzt des «echten» Kunstwerks entwertet? Walter 34 Über Cellini: Cole (2002). 35 Vgl. Foucault (1997), Kap. 2. 36 Danto (1964). 26 Abb. 3: Andy Warhol, Mao Zedong © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 2011, ProLitteris, Zurich Benjamin argumentiert, was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmere, sei seine Aura.37 Insofern das Foto einigermaßen zuverlässige Vorstellungen selbst vom zerstörten, verlorenen Werk vermittelt – man denke nur an Mantegnas Fresken in der Eremitani-Kapelle zu Padua – kann es tatsächlich zum «Mythenkiller» werden; schon Ruskin und Burckhardt übrigens erkannten jene bewahrende Funktion der Daguerreotypie und der Fotografie.38 Meist aber gleicht der Mechanismus dem, der 37 Vgl. Benjamin (1970), 16. 38 Vgl. Kemp (1983), 148; Burckhardt (1967), 23, Nr. 670, Brief vom 5.4.1875 an Max Alioth. 27 den Star generiert. Auch sein Bild wird wieder und wieder reproduziert, daraus kommt sein Ruhm. Der brennende Wunsch, ihm in Fleisch und Blut gegenüberzustehen, womöglich gar eine flüchtige Berührung gewährt zu erhalten, wird zur Obsession des Publikums; die Begegnung mit dem Original des zuvor schon tausendfach über Reproduktionen vertrauten Werkes mag in weniger ekstatischer Form vonstattengehen und gleicht doch jener weltlichen Epiphanie. Der Gedanke ließe sich mit einem Blick auf das Original der Mona Lisa illustrieren, falls er denn möglich ist: Geschützt von Panzerglas, aufs Angenehmste klimatisiert und von Bodyguards bewacht, wird sie in ihrem Gemach im Louvre gewöhnlich von einer blitzlichtfeuernden Menschenmenge umstanden und ist so dem Auge nahezu entzogen. Ähnliche Pulks bildeten sich, zeigten sich Angelina Jolie oder George Clooney an ihrer Stelle. Wie die Stars, über deren Affären und Schicksale die Regenbogenpresse orientiert, mehren die Schicksale der Meisterwerke ihren Ruhm; im Fall der Gioconda zählt etwa der Umstand dazu, dass Franz I.’ Blick auf ihr ruhte und dass sie mit Herrn Peruggia ein Florentiner Hotelzimmer teilte. Marcel Duchamp malte einer «Postkarten-Mona Lisa» einen Bart auf, nahm ihr so Geschlecht, Schönheit und Jugend und signierte das Ganze: So persiflierte das Bild die bizarre Vielfalt der Deutungsangebote und warf, wie Hans Belting zeigt, die Frage nach der Idee auf, die hinter Leonardos Bild stand.39 Andy Warhol dann machte durch seine bunten Siebdrucke die Gioconda zum Popstar.40 Sie wurde als Mediengestalt gezeigt, die als Abziehbild und damit Ware für jedermann verfügbar wurde. Die ungewollte Kehrseite dieser Dekuvrierung war, dass sie dazu beitrug, die magische Wirkung des Originals weiter zu steigern. Die subversiven Kommentare Duchamps und Warhols sind ihrerseits längst zu Meisterwerken mit erheblichem Marktwert geworden. Durch die Fülle der Texte, Reproduktionen und Persiflagen, die sie anregte, gewann Mona Lisas Ruhm einen festen Grund, bis heute. Die fünfhundertjährige Florentinerin ist längst zur globalen Ikone geworden. 39 Vgl. Belting (1998), 324–332. 40 Ebd., 331. 28 Als Fazit bleibt so erneut ein widersprüchlicher Befund. Einerseits trifft wohl zu: Je üppiger und ausführlicher die «Kontexte» sind, je prunkvoller die Leerstelle, die sie umspinnt, so größer bläht sich das Vakuum, das sie umgibt, wird immer herrlicher, zu einem geheimnisvoll funkelnden, unsagbar schönen Gebilde. Sie machen, was an Materie da ist, dramatisch sichtbar, und sie füllen die Leere mit Möglichkeiten. Es sind aber vor allem die Leerstellen im «primären» Kontext des Werkes, den Resten seiner – mit Heidegger – insgesamt irreversibel «zerfallenen»41 Ursprungswelt, die eine Vermehrung der «sekundären» Kontexte zur Folge haben: nämlich die Lösungsversuche des Rätsels. Beides, das Mysterium und der gerade daraus herrührende Überschuss an Erörterungen und, en passant, Reproduktionen, werden zu Motoren des Mythos. IV. Leerstellen im Kontext Worauf es uns ankommt ist hier: Kunst ist ohne Kontexte nicht erfahrbar; sie zum Verschwinden zu bringen, ist praktisch unmöglich. Sie ziehen Autor oder Autorin zurück ins Werk und seine Geschichtlichkeit. Sie mischen sich in den schöpferischen Prozess, der bei der Betrachtung dem Werk im Kopf zu seiner einzig «realen» Gestalt verhilft. Eine «strenge Kunstgeschichte» mag sich noch so schmallippig um Analysen der Form bemühen, nie und nimmer wird sie die Geschichte, in der ein Werk steht, eliminieren können; die Urheber, die Autorinnen des Werks sind ungeachtet postmodernen Exorzismen zähe Revenants. Ihre Spuren und die Kontexte sind mit dem Werk gleich welcher Gattung untrennbar verschmolzen wie bei Ölgemälden die Pigmente mit dem Bindemittel oder der Firnis. Die Erfahrung des Werks und das Wissen um seine Kontexte bestimmen gleichermaßen das ästhetische Erlebnis, wobei es weniger darauf ankommt, wie «richtig» oder «falsch» die das Objekt der Bewunderung umspinnenden Bedeutungsgewebe sind. Sich ihnen zu entwinden, das «Geschwätz der Interpreten» zu ignorieren, sich hinwegzusetzen über das Geplapper der Reiseführer, die Erwägungen der Kunsthistorikerinnen 41 Vgl. Herrmann (1994), 148–150. 29 und Kunsthistoriker, die Prosa und Poesie der Feuilletons ist unmöglich. Sie haben bezwingende Macht. Aus jener Einheit von Werk und Kontext folgt, dass die Suche nach Leerstellen beides, Geist und Materie, zu berücksichtigen hat: das fehlende, zerstörte Werk oder auch die «blinden Flecken» ebenso wie die verlorene Überlieferung, die zerfallenen Welten des Werkes. Gleichermaßen nähren sie den Mythos, da der Mythos notwendig mit dem Unbekannten zu tun hat. Piero della Francescas Geißelung in der Nationalgalerie der Marken in Urbino war allein in den letzten Jahren Gegenstand mehrerer Monographien. Die Suche nach den zerfallenen Ursprungswelten von Giorgiones geheimnisvoller Tempesta, oder von Botticellis Primavera (oder wie immer man das berühmte Gemälde nennen soll) haben nicht minder zahlreiche Federn inspiriert. Wäre Genaues über die Entstehungsbedingungen der Mona Lisa bekannt, womöglich eine Zahlungsanweisung ihres Auftraggebers oder ein Briefwechsel mit Leonardo, wären niemals Hekatomben von Papier mit Spekulationen darüber bedruckt worden. Und gäbe es zu Leben und Denken Leonardo da Vincis wohlgeordnete, ausführliche Quellenbestände, wäre er zwar immer noch ein Maler der Extraklasse; sein Mythos aber hätte sich niemals zu ähnlich sagenhafter Dimension entwickelt. Die Auflösungen des Rätsels wären womöglich banal. Angesichts der Leerstellen im Kontext bleiben Fragen über Fragen. Wer ist die Dargestellte, warum lächelt die schöne Frau, worüber und gegenüber wem? Warum gelangte das Bild in den Besitz Franz I.’ von Frankreich und verblieb nicht beim Auftraggeber? Auch dank der riesigen Lücken, die in der Überlieferung klaffen, vervielfachte Mona Lisa ihre Identität. An der Konstruktion ihrer multiplen Identitäten waren berühmte Autoren beteiligt, die damit zu Mitschöpfern ebenso zahlreicher Giocondas wurden: Theophile Gautier, Sigmund Freud oder, zuletzt, Roberto Zapperi.42 Walter Pater lieferte die bis dato wohl monströseste und zugleich poetischste Deutung des Porträts, die sich gerade deshalb tief ins Unbewusste wenigstens eines gebildeten Publikums einprägte; es ist eine Passage der Renaissance, die zugleich erklärt, wie Pater zum Gott des modernitätsmüden, nach Mythen dürstenden viktorianischen Publikums werden konnte: 42 Vgl. Zapperi (2010). 30 Alle Gedanken und Erfahrungen der Welt haben sich hier eingegraben, eingeschrieben (…), die Sinnlichkeit Griechenlands, die Wollust Roms, der Mystizismus des Mittelalters, die Rückkehr der heidnischen Welt, die Sünden der Borgia. Sie ist älter als die Felsen zwischen denen sie sitzt; wie der Vampir, ist sie viele Male tot gewesen und hat die Geheimnisse des Grabes erlernt; sie war ein Taucher in tiefen Seen, und bewahrt ihren versunkenen Tag um sich, und handelt um seltsame Gespinste mit Kaufleuten aus dem Osten; und, als Leda, war sie die Mutter Helenas von Troia, und, als St. Anna, die Mutter Marias; und all das war um sie nur als der Klang von Leiern und Flöten, und lebt nur in der Zartheit, mit der die wechselnden Gesichtszüge geformt, die Augenlider und die Hände geformt sind. Die Phantasie eines ewigen Lebens, die hier zehntausend Erfahrungen zusammenfegt, ist alt; und die moderne Philosophie hat die Idee der Menschheit erdacht, wie sie eingegraben ist in sie, und sie fasst in sich alle Arten des Denkens und des Lebens. Gewiss könnte Lady Lisa für die Verkörperung der alten Träumerei und der modernen Idee stehen.43 Die Liste der mythischen Rätselbilder ist unendlich lang, und die Texte über sie füllen Bibliotheken: Boschs Garten der Lüste und Tizians Irdische und himmlische Liebe wäre darauf zu finden, Savoldos Gaston de Foix oder Velázquez’ Meninas oder Watteaus Einschiffung nach – oder Abfahrt von? – Kythera. Und wie wohl würden wir Cy Twomblys Kunst erfahren, hätte der notorische Schweiger sich wortreich dazu geäußert; es war nicht seine Art. Dass er es bei kryptischen Hinweisen – Lepanto, Hero und Leander – beließ, war Absicht, von ästhetischen Erwägungen bestimmt. In einem Interview hat er kurz vor seinem Tod ausdrücklich bekannt, er wolle damit den Gedanken der Betrachterinnen und Betrachter die Chance zum Spiel eröffnen, sie keineswegs dazu bringen, den Code eines fest stringenten Systems zu erschließen.44 Twomblys Rätsel, auch die Leonardos, Giorgiones, Piero della Francescas 43 Vom Autor übersetzt nach Pater (1986), 80. 44 Vgl. Roeck (2008). 31 und anderer bleiben ungeachtet der Heerscharen von Exegeten, die sich an ihrer Auflösung abmühten, unbeschädigt. Der Effekt der Mythenbildung aus der Leere zeigt sich besonders spektakulär, wenn das Werk selbst ganz verloren ist, die Diskurse um eine leere Mitte kreisen; mehr noch, wenn ein Nichts im Verdacht steht, bedeutend gewesen zu sein, es einst eine berühmte Autorschaft gab. Das Mysterium verdoppelt sich gewissermaßen, wenn sich zum Vakuum, den das Verlorene hinterlassen hat, Leerstellen in der Dokumentation gesellen. Die Bilder der Zeuxis, Parrhasios oder Apelles geben die wirkungsmächtigsten Exempel: Weder gibt es die Werke, noch Dokumente aus ihrer Entstehungszeit, die ihr Aussehen verrieten. So avancierten sie zu faszinierenden «Überkunstwerken» von sagenhafter Vollkommenheit; wenigstens das Aussehen der Verleumdung des Apelles schien nach einer Lukian-Stelle rekonstruierbar. Botticelli hat sich an einer Umsetzung versucht.45 Aber wie sahen die verwitterten Malereien des rätselhaften Giorgione und des nicht minder mythischen Tizian auf der Fassade des Fondaco dei Tedeschi in Venedig aus?46 Welches Bild boten die Fresken, die von Leonardo und Michelangelo auf die Wände der Sala dei Cinquecento des Florentiner Palazzo Vecchio gebracht wurden – die Schlachten von Cascina und, vor allem, die legendenumwobene Anghiari-Schlacht, auch sie Hauptstücke im Museum verlorener Kunst? Sie begann ihre Reise ins Unsichtbare bereits während des Entstehungsprozesses, zwischen 1504 und 1506; erst verzweifelt, dann zunehmend mut- oder lustlos scheint Leonardo, von der Signoria immer wieder gedrängt und gemahnt, mit technischen Problemen gekämpft zu haben.47 Vermutlich hat Vasari bei allem Respekt vor dem berühmten Meister dann das, was davon übrig war, mit seinen monumentalen Fresken übermalt. Zeichnungen und spätere Kopien, darunter eine von Rubens, überliefern Details und ein grobes Konzept der Gesamtkomposition. Kurioserweise machte jenes Nichts aus einem belanglosen Gefecht im Jahr 1440 eine der bekanntesten Schlachten der Renaissance. Das Tref­fen zwischen Söldnerhaufen Mailands und Florenz’ wäre längst vergessen, gäbe es nicht den Mythos eines Bildes, das nicht einmal erhalten ist. 45 Vgl. Cast (1981); auch Gombrich (1976). 46 Vgl. Schweikhart (1993). 47 Zuletzt Zöllner (2007), 162–174; Ders. (1998). 32 Ähnlich verhält es sich mit Leonardos Entwürfen für Reiterstandbildnisse für Ludovico Sforza und Giangiacomo Trivulzio; von ersterem, einem dramatisch, «barock» sich aufbäumendem Pferd samt Reiter, wurde ein sieben Meter hohes Tonmodell Wirklichkeit.48 Während der Guss an technischen Problemen (und wohl auch an Geldmangel) scheiterte, war das Modell noch bis 1499 zu sehen. Nach dem Einmarsch der französischen Armee in Mailand diente es Landsknechten als Zielscheibe für Schießübungen mit Pfeil und Bogen; die Reste wanderten wohl auf den Schuttplatz. V. Ungeschaffene Meisterwerke Leonardos Pferd blieb also im Arsenal des Ungeschaffenen, der geplanten, aber nicht ausgeführten Werke, wenngleich findige Tourismus-Manager inzwischen eine Ausführung in der Nähe eines Mailänder Stadions aufstellten (Abb. 4). Es ist ebenso wie das Museum des Verlorenen mit erstrangiger Kunst bestückt, wobei von den Kopfgebilden der Maler, Bildhauer und Architekten, die keine Spuren in den Schriftquellen hinterließen, notgedrungen zu schweigen ist: Michelangelos Grabmal Julius II.’ ragt darin ebenso hervor wie der größte Teil der Kathedrale von Beauvais oder Sienas Neuer Dom, über den Jacob Burckhardt angesichts der erhaltenen Teile urteilte, er wäre im Fall der Fertigstellung das bei weitem schönste gotische Gebäude Italiens geworden und ein Wunder der Welt.49 Merkwürdig, wie gerade nicht oder nur unvollständig realisierte Projekte die Phantasie der Nachgeborenen stimulieren und zu enthusiastischen Urteilen bringen, etwa Balthasar Neumanns nur in «Knechtsgestalt» in die Wirklichkeit getretene Abteikirche von Neresheim, die, mit Georg Dehio, gleichwohl ein Raumerlebnis von «erschütternder Großartigkeit» gewährt.50 Bleiben wir noch einen Moment bei dem Meisterbaumeister aus Eger, der 1746/47 – es wäre der Gipfel seiner Karriere gewesen – mit Planungen für einen Umbau der Wiener Hofburg beschäftigt war. Wegen der «verderb48 Vgl. Zöllner (2007), 85–93, 194f. mit weiterer Literatur. 49 Vgl. Burckhardt (1878), 130. 50 Dehio (1925), 337. 33 Abb. 4: Nina Akamu, Kolossalpferd für ein Reiterstandbild Francesco Sforzas nach Zeichnungen Leonardo da Vincis, 1999. Bronzeguss, Mailand, Hippodrom San Siro © 2011 Trista B., Creative Commons lichen Kriegszeithen», so sein Patron Graf Silva Tarouca in einem Brief an Neumann, musste auf die Umsetzung der Pläne verzichtet werden. Die Regel, dass dergleichen Luftgebilde ungebremste Begeisterung stimulieren, gilt auch für diesen Fall. Der Kunsthistoriker macht sich auf eine geistige Wanderung durch die Pläne, durchschreitet das Treppenhaus («Neumann fasste hier seine ganze Gestaltungskraft zu höchster Wirkung zusammen») und findet zu einem begeisterten Gesamturteil: Beim Projekt für die kaiserliche Hofburg habe er viele seiner früheren Lösungen zu kluger Synthese gebracht, alles früher Dagewesene übersteigert «zu einer so gewaltigen Macht der Erscheinung, dass die Hofburg weltweit als das absolut Höchste erscheinen musste, das der Schloßbau hervorbringen konnte, als der unüberbietbare Zenit einer langen Entwicklung».51 51 Schütz (1986), 79f. 34 Noch mehr ins Imaginäre verflüchtigen sich Werke, die nicht entstanden, weil ihr potentieller Schöpfer «vor der Zeit» starb. Junge Tote von Raffael – mit dem Holzer schon von seinem ersten Biographen verglichen wurde – bis Mozart inspirierten von jeher die Phantasie. Welches reife Alterswerk mag der Nachwelt entgangen sein? Der «vorzeitige» Tod (der in Wahrheit ja alles andere als frühe «Vollendung» sein kann), versieht das, was die Dahingeschiedenen hinterlassen haben, mit dem Siegel der Endgültigkeit: Kein Spätwerk kann das Frühere relativieren, alles ist letztes Wort; dazu kommt die ungewisse Vermutung, die Menschheit sei so um einige große, absolute Meisterwerke gebracht worden. Man stelle sich vor, Mozart wäre so alt geworden wie Haydn und hätte noch fünfzig Symphonien und ein paar Opern schreiben können – oder Raffael hätte den Auftrag erhalten, den Petersdom auszumalen, und ihn ausgeführt! Das Staunen vor dem, was am Ende vom schmalen Œuvre eines jung Gestorbenen erhalten blieb, wird so durch das Wissen verstärkt, dass man eben vor Unvollendetem steht. Es fehlt das Zerstörte ebenso wie das Ungeschaffene. Muss nicht die Klosterkirche von Münsterschwarzach, ein Bau des bedeutendsten deutschen Architekten der Epoche, ausgemalt von ihrem grössten Freskanten, ein Wunder gewesen sein, das sich der Vorstellungskraft entzieht? Die Entwürfe Holzers geben eine Idee, nicht mehr; es verhält sich ähnlich wie mit anderen zerstörten oder unvollendeten Meisterwerken. Allenfalls vorhandene Bozzetti, die Nachstiche, die Kommentare sind bloße Umschreibungen einer Hauptsache, die nicht mehr vorhanden ist. Auch der Ruhm Johann Holzers hat gewiss nicht nur mit dem unglücklichen Schicksal seiner Hauptwerke, sondern auch mit seinem frühen Tod zu tun. So konnte nicht geschaffen werden, was womöglich noch vollkommener gewesen wäre, als das, was überliefert ist. Der Umstand, dass Holzer als Kandidat für den Auftrag, die Würzburger Residenz zu freskieren, in Aussicht genommen worden zu sein scheint, mag in der Tat melancholisch stimmen; die Trauer wird indes gedämpft, wenn man bedenkt, dass so Giambattista Tiepolo zum Zuge kam. 35 Gerade das Unvollendete oder Zerstörte treibt die Phantasie an, sich etwas unsagbar Schönes zu denken, ohne dass die Chance besteht, sich seiner ganz zu versichern. Die Faszination, die vom Torso ausgeht, überhaupt vom Unvollendeten hat darin ihren Grund,52 auch wenn die Unvollständigkeit banale, erdennahe Ursachen hat. Der Torso von Belvedere ist gewiss ohne Absicht ohne Gliedmaßen und Kopf überkommen; Schubert kam schlicht wegen anderer Arbeiten nicht dazu, seine «Unvollendete» – die ja keineswegs sein letztes Werk war, vielmehr einfach «in der Schublade» liegenblieb – fertigzustellen. Und Mozarts früher Tod war alles andere als ein Ausdruck von Götterliebe; er fügt sich vielmehr vollkommen in demographische Muster der frühen Neuzeit. Als ihm für immer die Feder entglitt, war er an der Schwelle zum großen Ruhm und gewiss zu Aufträgen, aus denen Werke von atemberaubender Qualität geworden wären. VI. Orte des Absoluten Die magische Wirkung des Verlorenen und dessen, was nicht entstehen konnte, weil der Tod oder bestimmte Umstände es verhinderten, resultiert indes nicht nur aus dem Rätsel. Die Leerstelle öffnet sich zum Absoluten.53 Jenes Absolute verweigert sich notwendig der Ausführung; im «blinden Fleck» hat die Phantasie den Raum, sich dem Vollkommenen zu nähern. Die Ästhetik des Torso hat das zum Grund,54 ebenso die Schönheit des non finito. Die «Ränder», dort, wo die gestaltete Materie endet, deuten an, wie es weitergehen könnte, ohne dass ein letztes Wort gesprochen würde. Sie legen Spuren, die zur Imagination des Absoluten zu führen scheinen.55 Viele Bilder Cézannes geben Ahnungen von Vollkommenheit, gerade weil Partien der Leinwand, absichtlich oder nicht, roh blieben.56 Die Wirkung kann atemberaubend sein, jedenfalls für den am offenen Werk der 52 53 54 55 56 36 Vgl. Brückle (2001). Vgl. Belting (1998), 324–332. Vgl. Brückle (2001). Vgl. Boehm (2000). Vgl. Baumann / Bach (2000). Moderne geschulten Blick. Ein Virtuose des unvollkommenen Vollendeten war Auguste Rodin: Er beließ es ja oft beim Torso oder rückte gestaltete, polierte Formen dadurch in den Blick, dass er sie mit unbearbeiteter Materie konfrontierte. Der Fragmentarist Rodin lehrt, den Marmor zu sehen. Er regt dazu an, Unfertiges weiterzudenken, und er schärft unser modernes Auge, das nun beispielsweise in Michelangelos Matthäus oder seinem Atlas-Sklaven zwei der großartigsten Skulpturen der Neuzeit erkennt. Im non finito begegnet keine defizitäre, sondern eine vollkommene Ausdrucksform.57 So kann die Phantasie aus dem völlig verlorenen Werk Vollkommenes zusammenfügen. Es wird schemenhafte Wirklichkeit dort, wo jedes Kunstwerk seinen letzten Ort hat: im Körpermedium.58 Die Stanzen des Vatikan kann die Phantasie in Piero della Francescas kaltes Licht tauchen; auf Venedigs Fondaco dei Tedeschi vermag sie Tizians glühendes Kolorit zu bringen, und aus Holzers verlorenen Fresken werden Wunderwerke der Malerei. Die Phantasie versteht, aus den verwehten Spuren der Anghiari-Schlacht die herrlichste Reiterbataille des 16. Jahrhunderts zu fertigen, ein Bild ohnegleichen. «Die beiden (…) Bilder», so schreibt ein moderner Kunsthistoriker über die verlorenen Fresken Leonardos und Michelangelos in der Sala dei Cinquecento, «wären die beeindruckendste malerische Gestaltung eines öffentlichen Innenraums des frühen 16. Jahrhunderts gewesen».59 Leonardos Pferde-Modell wird durch den Mailänder Hofdichter Baldassarre Taccone ein Werk, das sich in höchsten Tönen rühmen lässt. Das Talent des Künstlers erschien als vom Himmel gesandt, Griechenland und Rom hätten nie ein größeres Kunstwerk gesehen: Wenn man ihn mit Phidias vergleiche, «mit Myron, Skopas und Praxiteles», schreibt er, «muss man sagen: Nie war ein Werk auf Erden schöner».60 Das Verlorene wird ebenso zum Ort des imaginären Absoluten wie die Leerstelle – oder Malevitchs Schwarzes Quadrat, das vollkommen dem schwarzen Quadrat gleicht, mit dem der spleenige Naturphilosoph Robert Fludd im 17. Jahrhundert das Nichts, wie es sich vor der Schöpfung 57 58 59 60 Vgl. Boehm (2000), 39. Vgl. Belting (2011). Zöllner (2007), 164. Ebd., 90f. 37 Abb. 5: Robert Fludd, Nihil ad infinitum,61 Holzschnitt © Wellcome Photo Li­b­rary, London «zeigte», darstellte (Abb. 5 und 6).62 Sie erfüllt jene Sehnsucht nach etwas nicht Definierbarem, die Wolfgang Hildesheimers melancholischen Ästhetiker Sir Andrew Marbot beim Blick auf das Land Raffaels, auf die im Dunst verschwimmenden Hügel um Urbino, auf Konturen und Überschneidungen, befällt.63 Ist die Sache bestimmt, hat sie feste Umrisse und erzählt wortreich von sich selbst, bleibt dem Traum vom Vollkommenen nur wenig Platz. Die Landschaft im scharfen Sonnenlicht des Spätherbsts ist etwas für Klassiker, 61 In: Fludd (1617–21). 62 Vgl. Westman (1984), 194–196. 63 Vgl. Hildesheimer (1984), 229. 38 Abb. 6: Kasimir Malewitsch, Schwarzes Quadrat auf weissem Grund, 1915. Öl auf Leinwand, 79 x 79 cm; Moskau, Tretjakow-Galerie nicht für Romantiker. Die Kunst der Moderne, die von der Leerstelle im Werk und im Kontext lebt, ist in dieser Hinsicht romantisch. Das «Fehlende, das nicht fehlt», das «Verlorene, das niemals da war», erscheint als ihr Prinzip.64 Der blinde Fleck wird zur Öffnung ins Ich; die Suche nach dem absoluten Schönen ist ja immer eine Seelenreise, die den, der sie unternimmt, verwandelt. Indem wir Kunst betrachten, etwas «schön» nennen, finden wir ja immer ein Stück unserer selbst. Dabei entfaltet sich eine schwer beschreib­bare Gefühlsbeziehung zwischen Farben, Formen und Erinnerungen an Texte. 64 Dazu Moser-Ernst (2010); auch Gehring (2011). 39 Das Problem der Unmöglichkeit, das Absolute zu realisieren, hat Henry James in seiner Erzählung The Madonna of the Future – dem weniger bekannten Pendant zu Balzacs Das unbekannte Meisterwerk – in eine Parabel gefasst.65 Der Maler Theobald will die schönste aller Madonnen malen, ein Meisterwerk, das alle bisherigen Porträts der Gottesmutter einschließlich der Madonna della sedia Raffaels, übertreffen soll; ihr Vorbild steht ihm schon lange vor Augen. Es ist die schönste Frau Italiens, die zugleich von innerer Schönheit leuchtet. Sie mag jener Kunstfigur gleichen, von der schon Alberti in seinem Malereitraktat und auch in De statua redet: Zeuxis soll, nach der bekannten, von Cicero überlieferten Anekdote, die fünf schönsten Mädchen Krotons ausgewählt und aus ihnen die Schönheit der Frau gebildet haben.66 Das Verfahren, auf diese Weise Wirklichkeit zu arrangieren und zur Idee vorzudringen, wird dann immer wieder propagiert, so von Raffael, Michelangelo, Dürer, Pino und Cellini.67 Was James’ Maler betrifft, so zeigt er dem gespannten Besucher am Ende nur weiße Leinwand. Das schönste aller Bilder entzieht sich der Umsetzung in Materie. Es bleibt reine Idee, aufgehoben im Denken. Deshalb auch hat das verlorene Werk seine besondere Chance, zum mythischen Werk zu werden – in einer Zeit, die, mit Barnett Newman, eine Zeit «ohne Legenden oder Mythos» ist.68 Literatur Alberti, Leon Battista. Das Standbild. Die Malkunst. Die Grundlagen der Malerei, Darmstadt 2000. Baumann, Felix / Teja Friedrich Bach. Cézanne, Ostfildern, 2000. Baxandall, Michael. Die Wirklichkeit der Bilder. Malerei und Erfahrung im Italien des 15. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 1977. Belting, Hans. Das unsichtbare Meisterwerk. Die modernen Mythen der Kunst, München 1998. 65 66 67 68 40 Vgl. Belting (1998), 164–166. Vgl. Alberti (2000), 56. Vgl. Jäger (1990), 41. Vgl. Moser-Ernst (2010), 120. Belting, Hans. Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München 2011. Benjamin, Walter. «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit». In: Ders. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt a.M. 1970, S. 7–64. Beyer, Andreas. «Künstler ohne Hände – Fastenzeit der Augen? Ein Beitrag zur Ikonologie des Unsichtbaren». In: Jürgen Stöhr (Hg.). Ästhetische Erfahrung heute, Köln 1996, S. 340–359. Bianconi, Gian Lodovico. Briefe an den Marchese Hercolani über die Merkwürdigkeiten Bayerns und anderer Länder, Mainz / Berlin 1964. Boehm, Gottfried. «Prekäre Balance. Cézanne und das Unvollendete». In: Felix Baumann u.a. (Hg.). Cézanne. Vollendet – Unvollendet, Ostfildern 2000, S. 29–39. Brandt, Reinhard. Die Wirklichkeit des Bildes. Sehen und Erkennen – vom Spiegel zum Kunstbild, München 1999. Brückle, Wolfgang. Von Rodin bis Baselitz. Der Torso in der Kunst der Moderne, Ostfildern 2001. Buonarroti, Michelangelo. Rime, Bari 1960. Burckhardt, Jacob. Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens, Stuttgart 1878. Burckhardt, Jacob. Weltgeschichtliche Betrachtungen. Historische Fragmente aus dem Nachlass, Berlin / Leipzig 1929. Burckhardt, Jacob. Briefe, Bd. VI, Basel / Stuttgart 1967. Bushart, Bruno. Kostbarkeiten aus den Kunstsammlungen der Stadt Augsburg, Augsburg 1967. Cast, David. The Calumny of Apelles. A Study in the Humanistic Tradition, New Haven / London 1981. Cennini, Cennino. Il libro dell’arte, Vicenza 2001. Cole, Michael W. Cellini and the Principles of Sculpture, Cambridge (MA) 2002. Danto, Arthur C. «The Artworld». In: Journal of Philosophy 61 (1964), S. 571–584. Dehio, Georg. Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Bd. 3, Berlin 1925. 41 Dürer, Albrecht. Schriftlicher Nachlass, Bd. 3, Berlin 1969. Fludd, Robert. Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia, Oppenheim 1617–21. Foucault, Michel. Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften (1966), Frankfurt a.M. 1997. Gehlen, Arnold. Zeit – Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei, Frankfurt a.M. 1986. Gehring, Ulrike. «Editorial. Semantik der Absenz. The Making and Meaning of the Void». In: kritische berichte 39 (2011), Heft 2, S. 3–6. Goethe, Johann Wolfgang. Werke. Weimarer Ausgabe, Weimar 1900. Gombrich, Ernst H. The Heritage of Apelles, London 1976. Hascher, Doris. Fassadenmalerei in Augsburg vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Dissertation, Bonn 1996. Heidegger, Martin. Der Ursprung des Kunstwerkes (1936), Stuttgart 1997. Herre, Franz. Das Augsburger Bürgertum im Zeitalter der Aufklärung, Augsburg 1951. Herrmann, Friedrich-Wilhelm von. Heideggers Philosophie der Kunst. Eine systematische Interpretation der Holzwege-Abhandlung ‹Der Ursprung des Kunstwerkes›, Frankfurt a.M. 1994. Hildesheimer, Wolfgang. Marbot. Eine Biographie, Frankfurt a.M. 1984. Hope, Charles. «‹Composition› from Cennini and Alberti to Vasari». In: Paul Taylor (Hg.). Pictorial Composition from Medieval to Modern Art, London 2000, S. 27–44. Hulse, Clark. The Rule of Art. Literature and Painting in the Renaissance, Chicago / London 1990. Jäger, Michael. Die Theorie des Schönen in der Renaissance, Köln 1990. Kemp, Wolfgang. John Ruskin. Leben und Werk. München / Wien 1983. Kilian, Johann Georg Christoph. Kunst- und Ehrengedächtnis Herrn Johann Holzers, weit berühmten und hoch schätzbaren Historien- und Fresco-Malers in Augsburg, Augsburg 1756. Krämer, Gode. «Holzer, Johann Evangelist». In: Günther Grünsteudel u.a. (Hg.). Augsburger Stadtlexikon, Augsburg 1998. Kubersky-Piredda, Susanne. Kunstwerke – Kunstwerte. Die Florentiner Malerei der Renaissance und der Kunstmarkt ihrer Zeit, Norderstedt 2005. 42 Kuhn, Helmut. Wesen und Wirken des Kunstwerks, München 1960. Lamb, Carl. «Johann Evangelist Holzer. Das Genie der Freskomaler des süddeutschen Rokokos». In: Augusta: 955–1955, Augsburg 1955, S. 371–391. Loughman, John / John Michael. Montias, Public and Private Spaces. Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses, Zwolle 2000. Mick, Ernst Wolfgang. Johann Evangelist Holzer (1709-1740). Ein frühvollendetes Malergenie des 18. Jahrhunderts, München / Zürich 1984. Moser-Ernst, Sibylle. «Res artificiosa. Vermag die Kunst, das Leben zu ändern? Sudelbuchgedanken zu Sloterdijks Imperativ und über die Kunst-Geschichte». In: Lukas Madersbacher / Thomas Steppan (Hg.). De re artificiosa. Festschrift für Paul von Naredi-Rainer zu seinem 60. Geburtstag, Regensburg 2010, S. 109–122. Panofsky, Erwin. Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie (1924), Berlin 1982. Pater, Walter. The Renaissance. Studies in Art and Poetry, Oxford / New York 1986. Pfisterer, Ulrich. «Künstlerliebe. Der Narcissus-Mythos bei Leon Battista Alberti und die Aristoteles-Lektüre der Frührenaissance». In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 64 (2001), S. 305–330. Reit, Seymour V. The Day they stole the Mona Lisa, New York 1981. Roeck, Bernd. «Die Kunst zu verschwinden. Cy Twombly». In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. August 2008, S. Z4. Roeck, Bernd. «Maler, Märkte und Mäzene. Das ‹Genie› Holzer und die Kunstwelt». In: Emanuel Braun u.a. (Hg.). Johann Evangelist Holzer. Maler des Lichts, Augsburg / Innsbruck 2010a, S. 18–35. Roeck, Bernd. Mörder, Maler und Mäzene. Piero della Francescas ‹Geißelung›, München 2010b. Roeck, Bernd. «Das verlorene Meisterwerk. Übermalt, gestohlen, versunken: Kunst wird interessant, wenn sie verschwindet. Über die Magie des blinden Flecks». In: Süddeutsche Zeitung, 20. August 2011, S. 14. Rosand, David. «Ekphrasis and the Renaissance of Painting. Observations on Alberti’s Third Book». In: Karl Ludwig Selig u.a. (Hg.). Florilegium Columbianum. Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller, New York 1987, S. 147–163. 43 Sassoon, Donald. Leonardo and the Mona Lisa Story. The History of a Painting Told in Pictures, London 2006. Schütz, Bernhard. Balthasar Neumann, Freiburg i.Br. 1986. Schweikhart, Gunther. «Der Fondaco dei Tedeschi: Bau und Ausstattung im 16. Jahrhundert». In: Bernd Roeck u.a. (Hg.). Venedig und Oberdeutschland in der Renaissance. Beziehungen zwischen Kunst und Wirtschaft, Sigmaringen 1993, S. 41–49. Sontag, Susan. Kunst und Antikunst, Reinbek b. Hamburg 1968. Soussloff, Catherine M. The Absolute Artist. The Historiography as a Concept, Minneapolis / London 1997. Stierle, Karlheinz. Ästhetische Rationalität. Kunstwerk und Werkbegriff, München 1997. Wagner, Eckard. «Ein helles Licht der deutschen Barockmalerei erlosch im Emsland. Zum 250jährigen Todestag von Johann Evangelist Holzer auf dem Jagdschloß Clemenswerth». In: Jahrbuch des emsländischen Heimatbundes 38 (1991), S. 45–54. Westman, Robert S. «Nature, Art, and Psyche: Jung, Pauli, and the KeplerFludd Polemic». In: Brian Vickers (Hg.). Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance, Cambridge u.a. 1984, S. 177–229. Wohlfahrt, Günter. «Das Schweigen des Bildes. Bemerkungen zum Verhältnis von philosophischer Ästhetik und bildender Kunst». In: Gottfried Boehm (Hg.). Was ist ein Bild?, München 1995, S. 163–183. Zapperi, Roberto. Abschied von Mona Lisa. Das berühmteste Gemälde der Welt, München 2010. Zöllner, Frank. La ‹Battaglia di Anghiari› di Leonardo da Vinci fra mitologia e politica, Florenz 1998. Zöllner, Frank. Leonardo da Vinci. Sämtliche Gemälde und Zeichnungen, Hongkong u.a. 2007. 44 Bildverkehr. Über Bilder von Bildern und den Verlust des Originals. Oder: Wie man weiß, wo man ist Thomas Steinfeld I. Gehen Der Titel dieser Konferenz ist geliehen: Der Bildverlust ist der Name eines Romans von Peter Handke,1 und es mag angelegen sein, im Rahmen dieser Veranstaltung auch danach zu fragen, was es mit Titel und Inhalt dieses Buches auf sich hat. Erschienen im Januar 2002, nimmt dieses Werk die Motive eines anderen Buchs auf, das fast vierhundert Jahre zuvor veröffentlicht wurde. Denn von Bildern und vom Verlust dieser Bilder erzählt auch der Don Quijote von der Mancha von Miguel de Cervantes.2 Dieses Werk ist ein komisches Buch über Ritter und Knappen, vor allem aber ein Roman über andere Romane, eine Abrechnung nicht nur mit den Windmühlen der Rittergeschichten, sondern auch mit den Wetterfähnchen der Schelmendichtung und der Schäferpoesie. Miguel de Cervantes war ein Meister nicht nur im Schaffen, sondern vor allem im Niederreißen von Bildern. Wenn aber sein Buch heute noch gelesen wird, dann hat dieser Erfolg weniger mit der prosaischen Absicht seines Autors, sondern mit dem bunten Glanz eben dieser Bilder zu tun, die er in seinem Zerstörungswerk schafft. Peter Handkes Werk nimmt den Don Quijote in sich auf wie einen alten Weggefährten. Dabei ist sein Buch, dem Umfang von über siebenhundert Seiten zum Trotz, eben keine epische Erzählung, sondern ein literarisches Pamphlet, ein Mittelding zwischen Roman und Manifest. Peter Handke dreht allerdings die Laufrichtung seiner Vorlage um. Er liest den Roman des 1 2 Handke (2003). Cervantes (2008). 45 frühen spanischen Barock rückwärts, gegen dessen Impetus. Er zieht aus zur Wiedereroberung der Windmühlenflügel als Gebilde der Phantasie. Oft ist in diesem Buch von der «langen Dauer» die Rede. Auf Marc Bloch wird ausdrücklich verwiesen, auf den französischen Historiker, der dieses Wort für die langen Rhythmen der Geschichte, für die Welt unterhalb der Ereignisgeschichte prägte.3 So wie er, möchte auch Peter Handke die Welt betrachten, aber nicht um Ruhe und Gelassenheit zu finden. Sondern vor allem, weil an der langen Dauer, am langsam schwingenden Rhythmus der Jahrhunderte, die Banalität des stilisierten, inszenierten Ereignishaften zuschanden gehen soll. Deswegen auch will Peter Handke die Absicht des Miguel de Cervantes, seine Zeitgenossen um ihre poetischen Illusionen zu bringen, nicht teilen. Peter Handkes Roman Der Bildverlust ist auch eine Streitschrift. Er hat also einen Gegner. Dieser Gegner heißt Aktualität – ein Wort, das in diesem Buch nicht vorkommt, das aber genau bezeichnet, worauf es hier ankommt: auf das plötzliche Gerinnen der Wirklichkeit in einem Ereignis, in einem Bild nämlich – das dem Menschen mit einer unabweisbaren Dringlichkeit entgegentritt. Das Wort «Aktualität» tut einem dabei den Gefallen, mit dem actus seinen scholastischen, theologischen Ursprung nicht zu verschweigen. Es geht darin um das «Tätige», «Erscheinende», im Unterschied zum Evidenten. Das englische Adjektiv actual oder das Adverb actually sind dieser Herkunft näher als das deutsche «aktuell». Peter Handke nun besteht darauf, dass Aktualität und Wirklichkeit nicht dasselbe sind, und für die fortlaufende Verwechslung dieser Blickweisen macht er eine aktualistische Sicht der Dinge verantwortlich. Die Aktualität, meint er, sei die wahre Illusion, wahnhafter noch als die Hirngespinste der Traumritter. Denn Aktualität bedeutet Nähe, räumliche wie zeitliche, und sie kassiert alle Reflexion. Aktualität bezeichnet Distanzverlust und ist daher Ausdruck eines grundsätzlichen Einverständnisses mit der Welt durch eine immer größer werdende Nähe, an deren äußerstem Punkt man die sogenannten sozialen Medien vermuten kann. Wie durch die Linse eines Kamerazooms betrachtet der Aktualismus, was er für die Wirklichkeit hält. Sein Repräsentant ist der Journalist, der Live-Reporter, der eine brandaktuelle, möglichst spektakuläre Chronik der laufenden Ereig3 46 Handke (1994), 244f. nisse schreiben will. Dieses im Sinn, ließe sich sagen, dass Der Bildverlust im Werk von Peter Handke eine ähnliche Rolle spielt wie die Ästhetik des Widerstands im Œuvre von Peter Weiss.4 Der Bildverlust ist ein utopischer Roman, verlegt in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der ein Krieg zu einer latent allgegenwärtigen Angelegenheit geworden ist. Das Buch hat eine eher vage gezeichnete Geschichte, eine Heldin und ein paar Nebenfiguren. Eine schöne Frau ohne Alter, Herrin über ein gigantisches Finanzimperium, verlässt ihren Beruf und ihr Haus in einer «nordwestlichen Flusshafenstadt»5 und fliegt nach Valladolid, um von dort aus die Sierra de Gredos zu überqueren, geografisch ein Gebirge in Kastilien, poetisch ein Ort der Wahrheit, eine Risikozone für Seele und Verstand. Manchmal reist sie per Autobus, manchmal zu Fuß. Erwartet wird sie jenseits des Gebirges, in der Mancha, also der Heimat des Don Quijote, von einem Autor, der mit ihr und über sie – und über den Rest der Welt – ein Buch schreiben soll. Denn nicht anders als bei Miguel de Cervantes sind das Erzählen und das Erzählenkönnen das eigentliche Ziel des Buches: Es geht, bei beiden, am Ende um einen poetischen Frieden, der darin liegt, dass der eine etwas zu berichten weiß, was der andere nicht kennt. Weswegen der andere zuhört. Auf die Art der Fortbewegung kommt es hier durchaus an, und auch auf den Beruf der Protagonistin. Eine «Finanzweltmeisterin»6 sei sie, sagt der Autor, und wenn der Leser auch wenig darüber zu wissen bekommt, was genau ihre Tätigkeit ist, so erfährt er doch einiges über die Sphären, die mit ihrer Arbeit verknüpft sind – es sind so gut wie alle. Anders gesagt: Sie repräsentiert das Geld in seiner radikal vergesellschaftenden Kraft, und je näher sie dem Autor kommt, desto weiter lässt sie die Kommunion von allem mit allem durch das Geld zurück. In der Sierra de Gredos angekommen, beginnt sie zu gehen, und auch in der Art der Fortbewegung ist das Allegorische nicht zu übersehen. Denn das Gehen hält die Mitte zwischen dem Schreiten der Götter und dem Rennen der Flüchtlinge, es setzt die Abwesenheit von Bedrohung voraus, die 4 5 6 Vgl. Weiss (2005). Handke (2003), 8. Ebd., 63. 47 Anwesenheit von Muße und die Gewissheit, dass sich alles, was man braucht, in behaglicher Nähe befindet. Das Gehen gehört zu den mittleren Verhältnissen im menschlichen Leben, es ist der Enge der mittelalterlichen Stadt ebensowenig angemessen wie den ausufernden Metropolen unserer Zeit. Und vor allem: Wer geht, erlebt die Welt im dauernden Wechsel. Dabei gerinnt sie vielleicht, bestenfalls, zur Zeichnung, keineswegs aber zum großen Bild. Der spezifische Blick des Abendlandes auf die Welt ist mit dem Geld entstanden, genauer, mit der Zentralperspektive, in der die Vergesellschaftung der Welt durch die sich entfaltende Finanzökonomie ihrer selbst innewurde. Der sich in der Geschichte und der Geschichte der Malerei entfaltende Begriff der Perspektive ist dabei nicht nur ein Resultat, sondern auch eine Form von Vergesellschaftung. Der westliche Glaube, das Ich, genauer: ein jedes Ich, am Bild repräsentiert durch Fluchtpunkt, Sehpunkt und Rahmen, bilde je für sich einen gleichsam herrschaftlichen Mittelpunkt der Welt, fand also mehr als seinen künstlerischen Ausdruck: er fand sich selbst in eben der Zentralperspektive (deren Repräsentant in der Literatur übrigens der Held des Romans ist). Man muss also abstrahieren, um die Bestimmung einer Grenze wie einer Mitte zu treffen, und diese Abstraktion ist nicht ohne Widerspruch zu gewinnen: Zum einen gelingt es nur durch das Herauslösen eines Fragments – also einer Verfertigung von Unvollständigkeit – den Anspruch auf Geschlossenheit und Ganzheit oder die Vision von Vollständigkeit zu erzeugen; das ist nichts weniger als sein Gegenteil. Zum anderen begründet – und das ist gleichfalls widersprüchlich – nur das Ausschneiden die Illusion von endloser Kontinuität, die sich auf einen Fluchtpunkt konzentriert. Alles, was sich nicht in diese partikulare Allgemeinheit fügt, gehört zu einem unmarked space, dessen Negativität ein uneingelöstes Versprechen in sich birgt. Deswegen zieht es Peter Handke ja so in die Bildlosigkeit der Sierra de Gredos. Im Gehen hingegen ist zwar auch das Ich als Bezugspunkt gegeben, aber seine Perspektiven sind dem dauernden Wandel, also der Zeitlichkeit unterworfen. Das Gehen und die Zentralperspektive gehen nicht zusammen, weil der Betrachter in der Zentralperspektive steht und die Welt als seine betrachtet. Er ist die Nabe, der Drehpunkt einer subjektiven Weltsicht, die nur deshalb funktioniert, weil sie allem und jedem einen Ort zugewiesen hat, und ihre Bedeutung reicht deshalb weit über die Kunst hinaus: Es gibt kein 48 Selbst ohne Selbstdarstellung, und der Ausdruck dieses Verhältnisses ist das Bild. Denn der Fluchtpunkt eines Bildes, für den Körper selbst unfassbar, weil völlig abstrakt, ermöglicht es dem Betrachter, sich selbst als ein Subjekt wahrzunehmen, das sieht. Die zentrale Bedeutung des Ich, der Glaube an das Subjekt als an den Mittelpunkt der Welt, und die scheinbar objektive Zentralperspektive sind die beiden, sich jeweils gegenläufig bewegenden Momente nur eines Verhältnisses. Denn das Ich tritt erst in dem Augenblick in seiner ganzen Einzigartigkeit und Erhabenheit hervor, in dem kein Ich mehr außerhalb der Gesellschaft steht. Leicht lässt sich dieser Gedanke in die Gegenwart wenden: Globalisierung und Mobilisierung scheinen demselben Bewegungsgesetz zu gehorchen wie Individuum und Gesellschaft. Spätestens seit der kommerziellen Durchsetzung der Fotografie gibt es eine Globalisierung der Bildkunst, und in ihr eine Globalisierung eines Ichs, das Anspruch auf Autonomie erhebt. Diese Bilder meint Peter Handke, wenn er den Erzähler sagen lässt: «Vor allem im noch nicht so lang vergangenen Jahrhundert wurde ein Raubbau an den Bildergründen und -schichten betrieben, welcher zuletzt mörderisch war. Der Naturschatz ist aufgebraucht, und man zappelt als Anhängsel an den gemachten, serienmäßig fabrizierten, künstlichen Bildern, welche die mit dem Bildverlust verlorenen Wirklichkeiten ersetzen, sie vortäuschen und den falschen Eindruck sogar noch steigern wie Drogen, als Drogen».7 Diesen Bildern entgegen gibt es selbstverständlich die wahren, gleichsam natürlichen Bilder jenseits des Bildverlusts. Warum aber heißt Peter Handkes Buch nicht «Das wiedergefundene Bild», sondern «Der Bildverlust»? Über fünf Stationen geht die Reise der Heldin durch die Sierra de Gredos. Auf der vorletzten gerät sie in die «Finsterlichtung»8 Hondareda, eine Art Exil für «todhässliche»,9 zu gebückten Sammlern regredierten Menschen, denen die Bilder – und das heißt vor allem: die inneren Bilder – abhanden gekommen sind: «Wen solch ein Verlust trifft, der kann nur noch einen einzigen Gedanken denken: Ausgespielt! 7 8 9 Ebd., 744. Ebd., 557. Ebd., 570. 49 Es ist zu Ende mit mir und mit der Welt. Bloß haben diese Betroffenen, statt sich zu ertränken, zu erhängen und Amok zu laufen gegen die Reste der Welt, sich hierher auf den Weg gemacht».10 Und nun werden die finsteren Gestalten flächendeckend mit Bildern beschossen, «zehn bis vierzehnmal häufiger als in Frankfurt, Paris, New York oder Hongkong die Verkehrsampeln».11 Auch die Heldin wird am Ende ihren Bildersturz erleben. Den ersten Teil dieser Allegorie aufzulösen, ist eine einfache Sache: Sie ist Medienkritik. So wie Cervantes’ Roman dem Zerfall der mittelalterlichen Welt den Zerfall ihrer Nachbilder, ihres Scheinlebens im Buch folgen lässt, so spiegelt Peter Handke den vermeintlichen Niedergang der modernen Gesellschaften in ihren Scheinbildern. Und auch bei der Auflösung des zweiten Teils der Allegorie hilft Don Quijote: Denn als dieser im Kreis seiner Angehörigen stirbt, befreit von seinem literarischen Wahn, ergreift der große Historiker «Cide Hamete Benengeli»12 das Wort, um den Lesern mitzuteilen, er habe die ganze Geschichte nur erfunden, um «Abscheu gegen all die ersonnenen und wirren Ritterbücher zu erwecken»13 – tatsächlich aber hat sich der Leser längst und mit Begeisterung durch das wirrste aller Ritterbücher gearbeitet. Noch einmal: Schon in Don Quijote geht es nicht um den angeblichen Widerspruch von Kunst und Leben, sondern um eine Erlösung vom Bilderwahn durch das wahrhaftige – und das heißt immer auch: das nicht-zentrierte, rahmenlose – Bild. Es geht um Lebensformen, von denen einige sehr fantastisch sind. In höherem Maße gilt das auch für den Bildverlust von Peter Handke: «Ein Gefährt hielt an seinem Ziel», heißt es auf der letzten Seite, «am Ende nach einer langen Fahrt, und schwankte im Stehen noch nach. Und dieses Schwanken hörte so bald nicht auf; wird nicht so bald aufgehört haben».14 Das ist ein Bild, und nach ihm werden, zumindest für Peter Handke, noch unendlich viele andere kommen, nur werden sie dem Gehen verpflichtet sein, dem Schwanken, der fortlaufenden Veränderung. Sie werden nicht mehr selbständig sein. Und keines wird einen Rahmen haben. 10 11 12 13 14 50 Ebd., 532. Ebd., 570. Cervantes (2008), 87. Ebd., 628f. Handke (2003), 759. II. Sehen Es hat etwas Vermessenes, in einer Welt und in einer Zeit, deren auffälligstes Signum, neben der Allgegenwart der populären Musik, die Allgegenwart von Bildern ist, von einem «Bildverlust» zu reden und gar von einem «Bildverlust» als solchem. Tatsächlich, wohin man schaut – man sieht Bilder, und die digitale Datenverarbeitung fügt, als rasende Reproduktionsmaschine in milliardenfacher Ausfertigung, dem vorhandenen überwältigenden Überfluss zu jeder Sekunde noch ein paar Überflüsse hinzu. Scheint es da nicht absurd vernünftig, auf verrückte Weise haushälterisch, wenn die Sphäre, der das Bild eigentlich zuzugehören scheint, sich von ihm zurückzieht? Denn weitgehend verloren ist das Bild in der Bildenden Kunst, zumindest insofern, als das traditionelle Tafelbild darin nur noch eine untergeordnete – und wenn: dann eine reichlich komplizierte – Rolle spielt. Vor einiger Zeit, anlässlich der vorvergangenen Biennale der Kunst in Venedig, war im Rundfunk ein eher missglücktes Interview mit Isa Genzken zu hören. Warum sie ihre Installation auf der Biennale Oil genannt habe, wollte der Journalist wissen. Die Künstlerin reagierte unwirsch. «Das ist es doch, worum es auf der Welt geht», herrschte sie den Fragenden an, «ob Krieg, ob nicht, darum geht’s. Um Energie und um Öl».15 In ihrem Kunstwerk im deutschen Pavillon sah man herrenlose Koffer und Trolleys, die in der Ausstellung herumstanden, als wäre diese eine verlassene Bahnhofshalle, Astronauten, die als Gliederpuppen von der Decke hingen, ausgestopfte Tiere, Totenköpfe und viele andere Dinge, die sie irgendwo gefunden hatte. Nichts und alles davon war mit dem Titel Öl erfasst, nichts fügte sich zum Bild. Aber es lag ein dunkler Reiz in diesem Namen – ein diffuser Appell an eine zum Gemeinplatz gewordene Weltbedrohungslage, deren Größe und Bedeutung die Künstlerin auf ihr Werk übertragen sehen wollte. Oil ist ein schwacher Titel, aber es ist immerhin noch einer. Die meisten Kunstwerke dürften hingegen heute «O.T.» heißen, «ohne Titel». Das ist nicht nur so, weil der Künstler vielleicht davor zurückscheute, seine Werke mit einem Hinweis auf eine Bedeutung zu versehen, weil er das Deuten ande15 Siehe vergleichend das Interview in Genzken (2007). 51 ren, vielleicht Berufeneren, den Kunstwissenschaftlern und Kritikern möglicherweise, überlassen möchte. Vielmehr ist eine benennbare Bedeutung hier selbst zu etwas Fremdem und Unwillkommenem geworden. Denn die Kunst ist ins Leben selbst eingezogen, hat sich in ihm niedergelassen, ist mit ihm gemein geworden. Man betrat die Ausstellung Isa Genzkens in Venedig, schritt durch eine orangefarbene Absperrung, die nicht Rahmen, sondern schon Teil des Dargebotenen war – aber im Pavillon war nichts wesentlich anderes zu erfahren, als was man außerhalb auch schon hätte wahrnehmen können: eine bricolage mehr oder minder banaler Dinge, ein buntes Sortiment aus halb wie bloß gefunden wirkenden, halb arrangierten Gegenständen, deren eigentliche Herkunft irgendwo tief im Alltag liegt. Um was es bei diesem Kunstwerk eigentlich ging, benannte Isa Genzken in ihrer barschen Antwort also, auf eine etwas verdrehte Weise, durchaus richtig: nicht um etwas Greifbares, fest in Raum und Zeit Ruhendes, sondern um eine Art von Energie – und das ist auch die Energie eines Menschen, der einem das gewöhnliche Leben als außergewöhnliche Veranstaltung nahebringt, in Gestalt einer Art Assoziationskette, zu der eine potentiell unendliche Zahl von alltäglichen Gegenständen gehört, die zu Kunst werden, wenn die Hand des Künstlers sie ergreift und in diese Räume stellt. Die moderne Kunst war einmal Aufbruch. Über mehr als zweihundert Jahre hinweg hatte sie gegen die Institutionen des Kunstbetriebes revoltiert, hatte sich ihre Autonomie immer wieder neu erfunden und erworben, hatte gegen die Akademien und das Akademische aufbegehrt und war unablässig vorangedrängt, stets zunächst gegen den Markt. Jetzt inszeniert sie ihre Großereignisse selbst – und siehe da: Sie wird getragen von einem so breiten Konsens zwischen Mäzenen, Auftraggebern, Betrachtern und künstlerischer Praxis, dass dazwischen nicht einmal mehr Platz für den geringsten Widerstand wäre. Viele hundert Jahre hat die Kunst gebraucht, bis sie diesen Stand erreichte – oder genauer: bis sie wieder zu ihm zurückkehren durfte. Denn der Aufbruch aus dem Normativen, aus dem (wie auch immer gearteten) handwerklichen Einverständnis zwischen Auftraggeber und Künstler war an eine Intellektualisierung gebunden: schon weil diese Ablösung begründet, die Freiheit als bestimmte motiviert werden musste. 52 Von der frühen Neuzeit bis noch in unsere Zeit war daher die Kunst vom Gedanken getragen, es liege ihr etwas Geistiges zugrunde, das sie darstelle und symbolisch überhöhe. Noch in den gigantischen Werken von Anselm Kiefer findet sich dieses Reklamieren von Bedeutung, in der wütenden Monomanie eines Mannes, der Materialberge auftürmt, um in deren Masse und Stofflichkeit ein Indiz dafür zu finden, woraus Welt und Leben eigentlich bestehen. Die Konzeptkunst, immer noch nicht vergangen, ist seit Jahrzehnten damit beschäftigt, mit einem Minimum an Gegenständlichem Anlässe zu schaffen, um sich dann, zuweilen auf höchst aufwendige Weise, selbst zu erläutern und aller fremden Deutung den Weg zu weisen. Und schließlich ist die Pointe, auf die viele zeitgenössische Kunstwerke hin konzipiert sind – Lars Rambergs Aufschrift «Zweifel» auf dem nun längst untergegangenen Palast der Republik, um nur ein Beispiel zu nennen – eine letzte (und oft alberne) Erinnerung an das Symbolische, eine auf einen minimalen Zeitraum und auf einen geographischen Punkt zusammengedrängte Idee. Vermutlich ist die Kunst nur in einer relativ kurzen Periode ihrer langen Geschichte nicht sakral gewesen, von ihrem Eintritt in bürgerliche Verhältnisse bis zum Ende des Realismus. Die ästhetische Moderne zeichnet seit ihren Anfängen zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts eine Rückkehr zu sakralen Motiven aus – und mit ihr beginnt die Abkehr vom Bild. Denn begonnen hatte sie, wie Wassily Kandinsky im Jahr 1912 erklärte, mit dem Bedürfnis, «aus einer Teetasse ein beseeltes Wesen zu schaffen oder richtiger gesagt, in dieser Tasse ein Wesen zu erkennen».16 Aus diesem Verlangen heraus ließ die Malerei das Figurative und Figürliche hinter sich, wurde abstrakt, zog aus in die unkünstlerische Welt, griff nach beliebigen Gegenständen, suchte den zufälligen Augenblick und das reduziert Typische zu gestalten und in allem ein Wesen, das Wesen schlechthin, zu ergreifen. «Feinere Emotionen», «die mit unseren Worten nicht zu fassen sind»,17 nannte Wassily Kandinsky diese Wahrheit, der man einen esoterischen Zug nicht absprechen kann. Was aber ist, wenn die Wahrheit sich nicht einstellt, aus dem Werk der Geist nicht spricht? Seit hundert Jahren regiert nun die ästhetische Moderne, und ihre 16 Kandinsky (1965), 50. 17 Ebd., 23. 53 Geschichte ist eine fortlaufende Radikalisierung, eine lange Kette von Überbietungen und immer wieder neu und immer wieder anders gebrochenen Konventionen. Es ist, als müsse die Kunst durch stets verschärfte Maßnahmen dazu gezwungen werden, sich endlich unmittelbar der Seele zu zeigen. Jetzt zeigt sie sich, indem sie nichts mehr zeigt. Georg Wilhelm Friedrich Hegel hatte für die ihm völlig selbstverständliche Überzeugung, in aller Kunst liege eine Bedeutung, die prägnante Formulierung vom «sinnlichen Scheinen der Idee»18 gefunden – sie sei nicht reiner Geist, hatte er gemeint, denn dieser drücke sich in Theorie aus, sondern unauflöslich ins Sinnliche gewobener Intellekt. Umgekehrt ist die Existenz von Kunst- oder Kulturwissenschaft, gleich welcher Art, Ausdruck der Gewissheit, hinter dem «sinnlichen Scheinen» gebe es tatsächlich eine Bedeutung, die sich ermitteln lasse. In einer Kunst hingegen, die auf pure Präsenz setzt, ist diese Vorstellung wenigstens scheinbar aufgehoben. An der Stelle des «sinnlichen Scheinens der Idee» steht nun das sinnliche Scheinen einer Energie. Das aber gab es schon einmal: in der religiösen Kunst, und zwar so lange, wie man daran glaubte, bis sie also in den Status von Bildern rückte. Auch sie bedurfte keiner Erklärung und schon gar keiner Deutung, war sie doch unmittelbarer Ausdruck einer höheren Macht. Man begegnete ihr mit Frömmigkeit, und das heißt: im reinen Vertrauen, in den Gegenständen der Verehrung auf Gott, auf Vermittlung, auf die spirituelle Mitte aller Verhältnisse selbst treffen zu können. Jetzt aber ist es die Kunst, die offen daliegt, nicht-bildlich, in schlichter Gegenwärtigkeit, und alles Deuten scheint ihr unangemessen zu sein. Distanzlos, aber aktuell. Oder genauer: Distanzlos, weil aktuell. Sie ist selbst der gesellschaftliche Mittelpunkt geworden, den sie bislang allenfalls zur Darstellung brachte. Deswegen hat sich die zeitgenössische Kunst so heftig mit dem Profanen assoziiert. Das aber heißt auch: Deswegen ist sie so sakral geworden. Der Verzicht auf einen bestimmbaren Inhalt, der Einzug ins Banale und Alltägliche ist der Preis, den die Kunst für ihren Aufstieg zur höheren Macht zahlt. Denn weit mehr als um alles Einzelne geht es hier um die Kunst selbst. 18 Hegel (1986), 151. 54 III. Kaufen Warum fotografieren die Menschen, wenn sie einen Ort erreicht haben, den sie wenigstens für halbwegs sehenswert halten? Was treibt sie dazu, sich zu Hunderttausenden in Luzern vor den Wasserturm zu stellen, zu Millionen in New York auf den Times Square oder in Venedig auf den Markusplatz, um sich ein Bild von sich selbst zu machen – oder sich eines machen zu lassen? Es reicht ihnen offenbar nicht aus, zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein. Es ist ihnen nicht genug, wenn sie sehen, hören, riechen, dass sie sich hier und nicht irgendwo anders aufhalten. Nein, beides bedarf der Bestätigung, der Mensch und der Ort, man muss sich ihrer symbolisch bemächtigen. Das ist so, weil weder das eine noch das andere gewiss ist. Denn es ist ja nicht wahr, dass der Tourist von einem Ort zum anderen fährt, um etwas Neues zu sehen. Tatsächlich reist er, um zu sehen, was er schon kennt, und die Menschen, die sich selbst vor den Sehenswürdigkeiten der Welt fotografieren, bringen ihre Bilder dieser Sehenswürdigkeit schon mit, wonach die selbstgemachten Bilder dann Belege der vollzogenen Gleichheit sind. Daraus ist zu schließen, vor allem anderen, dass sinnliche Gewissheit überhaupt erst durch ihre mediale Vermittlung entsteht. Zur Bilderflut, zur hemmungslosen Vervielfältigung der Bilder gehört, dass alles im Bild festgehalten wird, und Bild heißt hier vor allem Fotografie, und zum anderen, dass sich die Bilder auf immer weniger Gegenstände konzentrieren. Wollte man diese Verteilung illustrieren, müsste man zum Bild einer amerikanischen Stadt greifen, also etwa zum Bild von den Metropolen Shanghai oder Los Angeles, die eine gewaltige Fläche bedecken, um, sehr konzentriert, in der Mitte extreme Hochhäuser hervorzubringen. Die Zahl der Motive wird tatsächlich umso endlicher, je mehr technische Reproduktionen es von ihnen gibt. Und je weiter diese Entwicklung geht, desto mehr verwandelt sich jedes Motiv in ein Zeichen – um mit Georg Simmel zu reden, in eine reale Abstraktion, in etwas Sakrales, in die sinnliche Gegenwart einer Unterscheidungsleistung des Verstandes.19 Die Fotografie, die der Tourist von seiner eigenen Anwesenheit vor einer Sehenswürdigkeit macht, ist Beleg 19 Vgl. Simmel (1989), 57. 55 dieser Metamorphose, in der Bildkult und Gegenstand verschmelzen. In der Marke, im zum Logo gewordenen Auftritt finden beide zusammen. Und Bild bedeutet nicht nur, dass da etwas gemalt oder fotografiert oder aus anderen Bildnissen montiert ist. Die Wahrnehmung verläuft umgekehrt. Denn die Welt ist bebildert: die öffentlichen Abfalleimer sind es, die Griffe der Benzinschläuche von Tankstellen, die mit einem flimmernden Monitor unterlegten Wechselgeldschalen, die Flächen der öffentlichen Verkehrsmittel, jede Oberfläche ist dem Bild erschlossen und schließlich die Architektur selbst: Hochhäuser, die mit Billboards bedeckt zu Zeichenträgern mutieren. Und auch, ja, leider, die klassischen Buchstabenmedien, allen voran die Zeitung, sind, in erheblichem Maße, zu Bildmedien mutiert. Was Arbeit und Gesellschaft, was Privatleben und Interessen sind, wie man sich darin einfügt und welche Vorstellungen es davon gibt – all diese Ansichten, im buchstäblichen Sinne, werden heute in einem hohen Maße ikonisch distribuiert. Sie erscheinen als unwidersprechliche, nicht mehr dem Diskurs zu Verfügung stehende Anschauungen, die ihre Autorität aus der Unmittelbarkeit des Bildes beziehen. Das Bild erscheint als nicht mediales Fenster zur Realität. Im Bild lag, indessen, lange Zeit etwas ganz anderes, nämlich eine Hoffnung auf Rettung, und manchmal ist es gewiss auch heute noch so. Dass etwas zum Bild wird, dass ein Gegenstand, oder ein Ensemble von Gegenständen, aus allen anderen möglichen Gegenständen herausgehoben und im Bild festgehalten wird, diese Anstrengung hebt den Gegenstand unter allen anderen Anstrengungen heraus. Unter feudalen Voraussetzungen ist diese Mühe überschaubar, und man muss nicht zum Geschichtsphilosophen werden, um zu sagen, dass eine auf manueller Arbeit beruhende, aber gesellschaftlichen Surplus hervorbringende, ständisch organisierte, aber sich nach Akten der Souveränität auf­fächernde Gesellschaft ihre Entsprechung in den unerhört aufwendigen, langwierigen und auch teuren Techniken des klassischen, meist in Öl gemalten Tafelbildes ihre Entsprechung findet. Die Fotografie hingegen tritt nicht nur im selben Augenblick in die Welt, in der die industrielle Produktion einsetzt, sondern auch im Augenblick der Entstehung einer entfalteten Warenwelt. Sie entspricht darüber hinaus, in ihrer Gleichgültigkeit gegenüber ihren Gegenständen, im Umstand, dass jeder fotografiert werden kann, in ihrer Kontingenz einer demokratischen Weltordnung – die sich dar56 in bestätigt, dass das Fotografieren (und, unter digitalen Voraussetzungen, auch das Filmen) zum technischen Repertoire einer überwältigenden Mehrheit in der Bevölkerung gehören. Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem Zusammenhang, dass sich das Hineindrängen von Bildapparaten in die privaten Wohnungen für die meisten Menschen als größerer Wandel darstellt als der Übergang von der analogen zur digitalen Reproduktion (damit eng verbunden die erstaunliche Beständigkeit des Rahmens). Doch zurück zum Zusammenhang zwischen Bild und Ware: Man kann einen Gegenstand nicht als Ware wahrnehmen, ohne ihm die Eigenschaft des Ware-Seins zu übertragen. Diese Reflexion schlägt sich an der Ware nieder als deren Merkmal, gekauft werden zu wollen. «Hier bin ich», ruft die Ware, «nimm mich wahr», «nimm mich mit». Wenn dem Bild – und besonders: dem Bild unter den Voraussetzungen der technischen Reproduktion – grundsätzlich eine Sehnsucht immanent ist, dann wäre es zuerst diese. Und wehe, dieses Begehren wird nicht eingelöst. Zu den großen ungeschriebenen Büchern des bürgerlichen Zeitalters gehört der Roman der verstoßenen, der nicht erwählten Ware, das Buch vom kapitalen Unglück des erfolglosen Angepriesen-Seins, vom Ramsch und vom vorzeitig entstehenden Müll. Es ist dieser Punkt, an dem die Rettung durch das Bild eintreten soll, an dem also die Reklame beginnt. Wobei sich das Bild dann in einen Anwalt des Ideellen verwandelt, als der optische Befreier des Zufälligen und potentiell zur Wertlosigkeit verdammten. Das zieht Konsequenzen nach sich, unübersehbare: Denn die rasende Vervielfältigung der Bilder beginnt in dem Augenblick, in dem Bild und Markt miteinander verschmelzen. Das geschieht in der Reklame. Im selben Maße, wie Waren nicht nur Gegenstände sind, sondern Arbeitsleistungen, Lebensläufe, Menschen, wie also alles und jeder sich in eine Ressource verwandelt, die verkauft werden und sich verkaufen muss. Das hat nicht nur zur Folge, dass besondere Lebensformen entstehen, die einem existentiellen Surrealismus unterworfen zu sein scheinen. Sondern auch einen permanenten Wettbewerb auf dem Gebiet der Bilder, in dem Bilder sich verdrängen, kopieren, überlagern, vernichten, übertrumpfen und gegenseitig verjagen. Anders gesagt: Jedes Bild kämpft um seine eigene Gegenwart. Und kaum ist es da, ist es schon wieder fort. Jenseits der Bilder aber ist unmarked-space, Nicht-Ich, Nicht-Ort, die Hölle des Kapitalismus. 57 Dieser Wettbewerb wird ausgetragen nach dem Gesetz des schärferen Reizes. Die äußerste Konsequenz ist das Bild als dauerhafte praktizierte sinnliche Gewissheit, oder anders gesagt: die Organwerdung des Bildes, etwa in der Tätowierung. Sie wird vorangetrieben von einem Moment, das dem Bild von vornherein zugewiesen ist, aus mehr oder minder guten Gründen, nämlich vom Moment der Vergewisserung oder Bemächtigung – das Organ gewordene Bild ist also ein äußerster Akt der Selbstbemächtigung. Man kann das auch anders sagen: Das Bild wird Original. Was natürlich umgekehrt nicht nur heißt, dass es womöglich bald gar keine Originale mehr gibt, sondern auch, dass immer mehr Bilder auf Originale reagieren, die wiederum Bilder sind. Der Bildverkehr ist absolut geworden. Den Schluss aus diesem Gedanken zieht der Bildtheoretiker und Künstler Wolfgang Scheppe, indem er auf Edgar Allan Poes Gespräch zwischen Monos und Una20 aus dem Jahr 1841 verweist.21 Darin gibt es eine apokalyptische Vision einer durch die Industrialisierung zerstörten Welt, gestaltet als Gespräch zweier Verstorbener. Poe spricht von einer Welt der rectangular obscenities, deren Verursacher er so kennzeichnet: «He grew infected with system, and with abstraction. He enwrapped himself in generalities».22 Edgar Allan Poe gibt hier eine poetische Ahnung von einem Begriff, der bei Hegel entstand und über Marx und Simmel zum Situationismus von Guy Debord und zur kulturwissenschaftlichen Theorie des Kredits bei Joseph Vogl führt: dem der Real-Abstraktion. Hegel entwickelte in seiner Rechtsphilosophie diesen Gedanken entlang der Geldform, die sich ihm als «existierender Begriff» oder als «existierendes Allgemeines» erklärt.23 Marx sprach von «sachlichen Abhängigkeitsverhältnissen», die so erscheinen, «dass die Individuen nun von Abstraktionen beherrscht werden».24 Real-Abstraktionen sind, wie Wolfgang Scheppe erklärt, weniger ein Produkt des Denkens, als vielmehr der gesellschaftlichen Organisation, die den Prinzipien des Waren- und Finanzverkehrs Herrschaft über das Konkrete einräumt. Sie sind der Begriff für die Verkeh20 21 22 23 24 58 Poe (2008). Scheppe (2011), 98. Poe (1982), 445f. Hegel (1974), 229f. Marx (1974), 81. rung, in der das Leben dort untergehen muss, wo sich Reglements des Abstrakten in der Wirklichkeit geltend machen. Im sich vergegenständlichenden Abstrakten erscheint so das lebendige Tote in Gestalt von Menschen, Dingen und Ereignissen, die im Bild als Abstraktionen ihrer selbst auftreten, indem sie mit anderen Bildern agieren und auf diese reagieren. Der radikale Bildverlust der modernen Kunst und der unendliche Bildgewinn im gesellschaftlichen Leben korrespondieren also insofern miteinander, als einer Kunst, die unbedingte Wirklichkeit zu sein beansprucht, eine Wirklichkeit entspricht, die keine Vorstellung von ihrer bedingten Künstlichkeit hat. IV. Schluss Es gibt (wenn man die Revolution ausschließt) nur drei Mittel gegen den Bildverlust, ein künstlerisches, ein akademisches und ein lebenspraktisches. Politisch ist es das détournement im Sinne von Guy Debord, dem Kopf der Situationisten, einer Pariser Künstlervereinigung der fünfziger und sechziger Jahre, die am Ende nur noch aus ihm selbst bestand. Détournement bedeutet das Umkehren, das Zweckentfremden aller Bilder. Unter Anwendung aller Kunstrichtungen und Techniken, meinte Guy Debord, sollen revolutionäre «Kraftfelder» entstehen, in denen die Widersprüche und Lügen, die in jedem Bild stecken, offenbar werden. Im détournement sollen Evidenzen geschaffen – transportable, mit allen Merkmalen des Authentischen ausgestattete Beweise, die wie von allein einen Weltzustand offenlegen. Das détournement ist also ein moderner Bildersturm, ein Zurücklenken des Blicks vom Bild auf das Abgebildete, im Insistieren darauf, dass hinter oder unter der «Gesellschaft des Spektakels»25 noch eine andere Gesellschaft liegt, ein Ort, der noch nicht Bild seiner selbst ist. Der akademische Widerstand gegen die Instrumentalisierung durch das Bild wäre vorzüglich eine Angelegenheit der Geschichtsschreibung. Denn sie tut etwas, was aller Theodizee widerstrebt, und was allen geschichtsphilosophischen Substraten wie dem «Ende der Geschichte» 25 Debord (1996). 59 und allen Providenztheorien von Kapital und Warenwirtschaft entgegengesetzt ist. Geschichtswissenschaft in diesem Sinne heißt: die Kontingenzen offenlegen. Für den lebenspraktischen Widerstand gegen die Instrumentalisierung durch den entfesselten Bildverkehr schließlich empfiehlt sich Peter Handkes Programm: Gehen. Literatur Cervantes, Miguel de. Don Quijote von der Mancha, München 2008. Debord, Guy. Die Gesellschaft des Spektakels, Berlin 1996. Genzken, Isa. Oil. German Pavilion, Venice Biennale 2007, Köln 2007. Handke, Peter. Mein Jahr in der Niemandsbucht, Frankfurt a.M. 1994. Handke, Peter. Der Bildverlust, Frankfurt a.M. 2003. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818– 1831, Stuttgart-Bad Cannstatt 1974. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Ästhetik I, Frankfurt a.M. 1986. Kandinsky, Wassily. Über das Geistige in der Kunst, Bern 1965. Marx, Karl. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1974. Poe, Edgar Allan. «The Colloquy of Monos and Una». In: Ders. The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe, London 1982, S. 444–451. Poe, Edgar Allan. «Das Gespräch zwischen Monos und Una». In: Ders. Sämtliche Erzählungen, Bd. 2, Frankfurt a.M. 2008, S. 82–93. Scheppe, Wolfgang. «Lewis Baltz and the Garden of False Reality». In: Lewis Baltz. Candlestick Point, Göttingen 2011, S. 83–107. Simmel, Georg. Philosophie des Geldes, Frankfurt a.M. 1989. Weiss, Peter. Die Ästhetik des Widerstands, Frankfurt a.M. 2005. 60 Komplexe Bilder: Kommunizierte Wahrnehmung Dirk Baecker I. Bilder sind kommunizierte Wahrnehmung. Darin liegen ihre Komplexität, ihre doppelte Reduktion, die Bedingungen ihrer Rekursivität und ihr Kalkül. Bilder richten sich an die Wahrnehmung, sie müssen gesehen oder zumindest vorgestellt werden, um Wirklichkeit annehmen und damit Wirkung entfalten zu können. Und sie können sich nur an die Wahrnehmung richten, indem sie mitgeteilt werden. Die Mitteilung durch eine Geste, einen Rahmen, eine Beschreibung markiert sie im Unterschied zur Fülle sonstiger optischer und anderer sinnlicher Eindrücke, die sich in der Welt finden. Wir nehmen damit eine erhebliche Ausweitung des Bildbegriffs vor, erfassen die Tafelbilder der Religion und der Kunst ebenso wie die Höhlenmalerei, das Totem, die Vignetten in Manuskripten und Büchern, die Bilder auf Vasen, Münzen und Geldscheinen, Diagramme und Fotografien, die bewegten Bilder des Films, des Fernsehens und des Videos, die grafische Gestaltung der Tageszeitung, des Plakats und des Computerbildschirms und nicht zuletzt auch jene Bilder, die als Weltbilder Weltanschauungen prägen, ohne ihrerseits sichtbar werden zu müssen. Die Engführung dieses ausgeweiteten Bildbegriffs auf kommunizierte Wahrnehmung zwingt uns jedoch zugleich zu einer Präzisierung des Bildbegriffs, die es dann auch ermöglicht, die in der Ausweitung gestrichenen Unterschiede zwischen den Bildern der Kunst, des Alltags, der Medien und der Welt wieder einzuführen und an der Art und Weise festzumachen, welche Kommunikation welcher Wahrnehmung das jeweilige Bild jeweils leistet. Bilder sind in jedem Falle daran erkennbar, dass sie Formen, Farben und Figuren für eine Wahrnehmung präparieren. Auf einer Fläche, auf einem Rund, im Raum und in der Zeit stellen sie Sachverhalte zusammen, die ihre Prägnanz zunächst einmal negativ daraus gewinnen, dass sie nicht zugleich in 61 Worte gefasst, als Klang gehört oder auf eine Formel gebracht werden können. Stattdessen werden diese Sachverhalte konkreter oder abstrakter, reeller oder fiktiver Art «gesehen». Und nicht nur das. Sie werden, wenn das Bild gesehen wird, «zusammen» gesehen, auf welche Kontraste, Differenzen und Bezüge auch immer der Blick dann fällt, wenn er etwas zusammen sieht, und wie viel Zeit auch immer vergehen mag, um diesen als synchron wahrnehmbaren Zusammenhang auch als Zusammenhang zu konstruieren. So oder so wird das Bild immer nur von einem einzelnen Bewusstsein gesehen und wird der Zusammenhang wie immer selektiv nur von einem einzelnen Bewusstsein gefunden und rekonstruiert. Selbst wenn man sich die Bilder gegenseitig zeigt und erläutert, weiß man nicht, was der andere tatsächlich «sieht», ganz abgesehen davon, dass das einzelne Bewusstsein auch zur eigenen Wahrnehmung nur einen begrenzten und zum Prozess der Herstellung dieser Wahrnehmung im Gehirn keinen Zugang hat. Auch dann, wenn die Bilder gezeichnet, gemalt, fotografiert oder gefilmt werden, werden sie in ihrem Prozess der Entstehung und der Entscheidung darüber, wann sie «fertig» sind, um «gezeigt» werden zu können, von jeweils einem einzelnen Bewusstsein gesehen, zu dem kein anderes Bewusstsein einen Zugang hat. Aus dieser unaufhebbaren Differenz, weil Singularität des Bewusstseins ergibt sich die Komplikation des Bildbegriffs, der als Begriff so tun muss, als gäbe es in dem Gesehenen eines Bildes das Allgemeine eines Sichtbaren. In der Entfaltung dieser Komplikation, vielleicht auch in ihrem Schnüren zu immer neuen Knoten, liegt die Faszination einer Malerei wie jeder anderen Bildgebung, die immer wieder aufs Neue im Material erprobt, was man sieht, wenn man sich und anderen etwas zu sehen gibt.1 II. Bilder setzen voraus und profitieren davon, dass sich jede Kommunikation wie minimal auch immer an Wahrnehmung richten muss. Gesten müssen gesehen, Sätze gehört, Schrift gelesen, Stimmungen empfunden werden, 1 62 Siehe vor allem Merleau-Ponty (1964). ohne dass das Sehen, das Hören, das Lesen und das Empfinden selber Kommunikation wären. Sie sind Wahrnehmung, die in einer verschlossenen und ihrerseits als komplex unterstellten Einheit, einem Organismus, einem Bewusstsein, einer Maschine, stattfindet, einer Quelle und Senke der Kommunikation, die als das mise en abîme jeder Kommunikation dieser ihre Unmöglichkeit als Möglichkeit zur Erfahrung bringt. Weil die Wahrnehmung durch die Kommunikation nicht determiniert werden kann, ist Kommunikation als Abtasten der Wahrnehmung möglich. Jede Kommunikation setzt diese Art von Wahrnehmung voraus, richtet sich an sie und versucht sie in unterschiedlichem Maße zu binden. Eine Interaktion zwischen Menschen, zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Maschine kann nur stattfinden, wenn sich Menschen, Tier und Maschine wechselseitig wahrnehmen, das heißt wahrnehmen, dass sie sich wahrnehmen. Nur so kann der eigene Beitrag zur Kommunikation ebenfalls wahrgenommen und die Wahrnehmung von der Kommunikation unterschieden werden.2 Eine Organisation als Ordnung und Unordnung von Arbeit und Entscheidung ist nur möglich, wenn sich die Mitglieder der Organisation durch Akteneinträge, das Zwischenprodukt, den Fließbandtakt, die Projektdeadline oder die Besprechung im wahrsten Sinne des Wortes angesprochen fühlen und daraufhin ihr Verhalten modifizieren. Auch die massenmediale Kommunikation durch Bücher, Zeitungen, Film, Fernsehen und das Internet weist die Sollbruchstelle auf, dass sie Wahrnehmung rekrutieren können muss, die auch ausbleiben kann. Die Funktionssysteme der Gesellschaft wie die Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Religion oder die Kunst sind allesamt darauf angewiesen, dass sie an einem bestimmten Punkt der Kommunikation Wahrnehmung in Anspruch nehmen, sei es die Androhung von Gewalt, die Befriedigung von Bedürfnissen, die Überprüfung durch ein Experiment, den Trost der Seele oder die Überbietung und Problematisierung aller Wahrnehmung im Schönen und Erhabenen.3 2 3 So Mead (1962). Luhmann (1997), 378ff., spricht von «symbiotischen Mechanismen», die den Rückbezug der Kommunikation auf den Körper nicht nur in der Interaktion, für deren Zwecke die wechselseitige Wahrnehmung anspruchsvoll genug ist, sondern auch in der Kommunikation der Funktionssysteme sicherstellt. 63 Jede Kommunikation von der intimen und familiären bis zur alltäglichen, institutionellen und öffentlichen, so kann man im Anschluss an die antike Rhetorik sagen, ist auf ein decorum angewiesen, das selber Kommunikation ist, jedoch zugleich Zeichen bereitstellt, die wahrnehmbar definieren, welches Verhalten in welchen Situationen erwartet wird und als angemessen gilt. Dieses decorum definiert zugleich eine Kultur, wenn seine Zeichen untereinander in Verbindung stehen und die verschiedenen Verhaltenserwartungen zueinander in ein auf Stichwort abrufbares Verhältnis setzen, das seinerseits durch Krisenerfahrungen geprägt sein kann.4 So undurchschaut jedoch das Verhältnis von Kommunikation und Wahrnehmung ist, so entscheidend sind die Freiheitsgrade in diesem Verhältnis. Erst dank dieser Freiheitsgrade kann das Verhältnis konditioniert und unterschiedlich konditioniert werden. Das Ohr kann sich nicht verschließen, so Georg Simmel in seiner Soziologie der Sinne, doch das Auge kann sich öffnen und schließen, hinschauen und wegschauen, verweilen und weiterwandern und damit je unterschiedlich indizieren und punktuieren, welche willkür­ lichen und unwillkürlichen Bereitschaften vorliegen, sich an welcher Kommunikation wie zu beteiligen.5 All dies, wie gesagt, setzen Bilder voraus und von all dem profitieren Bilder. Bilder wenden sich an eine Wahrnehmung, an die sich jede andere Kommunikation ebenfalls richtet. In Frage steht daher, wie sie sich, da sie ihrerseits kommuniziert werden müssen, um wahrgenommen werden zu können, von jeder anderen Kommunikation unterscheiden. III. Bevor wir auf die Frage, wie Bilder ihren Unterschied markieren, antworten können, müssen wir jedoch das Verhältnis von Kommunikation und Wahr4 5 64 Siehe in diesem Sinne zum alteuropäischen decorum Mühlmann (1996) und zum damals so noch nicht genannten decorum von Eskimogesellschaften im Wechsel zwischen Winter und Sommer Mauss (1978). Siehe Simmel (1992), 722ff. Siehe speziell zur Bedeutung von Mimik auch Ekman (1985). nehmung explizieren, das für unsere Überlegungen eine offenbar entscheidende Rolle spielt. Hier einen präzisen Unterschied zu setzen, versteht sich alles andere als von selbst, da dies nur innerhalb einer Denkfigur möglich ist, die Kommunikation und Wahrnehmung nicht nur auf unterschiedliche Systemreferenzen bezieht, sondern vorab Systemreferenzen überhaupt ins Spiel bringt. Dies zu tun, ist jedoch der Ausgangspunkt, der uns ermöglichen soll, von «komplexen» Bildern zu reden.6 Die Hypothese einer Systemreferenz ist eine Hypothese darüber, unter welchen Bedingungen sich bestimmte Sachverhalte auszudifferenzieren und im Zeitablauf zu erhalten vermögen. In der Biologie und in den Ingenieurwissenschaften wird auf die Explikation von Systemreferenzen oft verzichtet, da sich Referenzen auf Organismen und Maschinen von selber zu verstehen scheinen, doch in der Soziologie hat man es mit dem Versuch zu tun, die Eigendynamik von Handlung und Kommunikation zu beobachten, so dass spätestens hier die Angabe und damit auch die Unterscheidung von Systemreferenzen unabdingbar wird.7 Je tiefenschärfer jedoch die jüngere Systemtheorie auf Fragen der Grenzziehung, der Selbstreferenz, der Temporalisierung und der Selbstorganisation zu achten versteht, desto mehr wird es interessant, auch die Begriffe des Organismus und der Maschine, vom Bewusstsein, dem psychischen System zu schweigen, auf die in ihnen unterstellten Modalitäten der Ausdifferenzierung und Reproduktion hin zu untersuchen. Immerhin stehen mit den Begriffen des Organismus und der Maschine, sobald sie als Systeme verstanden werden, auch die Begriffe des Lebens und der Künstlichen Intelligenz zur Diskussion. Eine Systemtheorie erkennt man daran, dass sie sich der Direktive unterwirft, für die von ihr untersuchten Phänomene eine oder mehrere Systemreferenzen anzugeben. Dabei gilt die Regel, dass ein Phänomen entweder als Struktur der Ausdifferenzierung und Reproduktion eines Systems oder als Objekt in der Umwelt eines bestimmten Systems untersucht werden kann. Als Voraussetzung und weitere Komplikation dieses Vorgehens kommt jeweils zusätzlich ins Spiel, dass auch die Beobachtung der Struktur eines 6 7 Siehe auch die Betonung eines dynamischen Zusammenhangs von «sozialer» und «symbolischer» Ordnung bei Seifert (2008), im Anschluss an Scheibler (1987). So Parsons (1951); und Luhmann (1980). 65 Systems oder eines Objekts in der Umwelt eines Systems nur unter der Bedingung einer weiteren Systemreferenz vorgenommen werden können, nämlich unter der Bedingung der Inanspruchnahme der Systemreferenz der Wissenschaft. Wir arbeiten hier im Rahmen einer bestimmten Theorie und wenden eine bestimmte Methode an, nämlich das Ordnen von Daten mithilfe von Metadaten, die die Systemtheorie zur Verfügung stellt.8 Und wir können nur beobachten, was wir mithilfe dieser Theorie und dieser Methode beobachten können. Die Theorie sozialer Systeme in den Fassungen von Talcott Parsons und Niklas Luhmann hat nicht zuletzt deshalb Widerstand auf sich gezogen, weil sie sich mit ihrer Unterscheidung zwischen sozialen und psychischen Sys­temen oder zwischen Gesellschaft und Bewusstsein von der humanis­ti­ schen Prämisse verabschiedet, dass im Menschen und vielleicht sogar nur im Menschen beides irgendwie eins sei oder zumindest eins sein können müsse.9 Die Theorie sozialer Systeme konzediert, dass Gesellschaft und Bewusstsein beide gleichermaßen im Medium des Sinns operieren, optiert dann jedoch mit aller Schärfe für den Versuch, die Sozialdimension des Sinns gegenüber der sachlichen Konfusion des Sinns im Menschen und der zeitlichen Synchronizität von Gesellschaft und Bewusstsein zu isolieren und als unabhängig intervenierende Variable zu präparieren.10 Gesellschaft unterscheidet sich darin von Bewusstsein, dass sie zu regeln versucht, welche Abhängigkeitsverhältnisse unabhängige Organismen untereinander eingehen können, ohne den Anspruch auf Unabhängigkeit aufzugeben. Gesellschaft kann dann sogar heißen, sich auf Abhängigkeiten einzulassen, etwa jene der Familie, der Organisation, der Politik, der Religion und der Wirtschaft, um Unabhängigkeiten steigern zu können. Deshalb unterscheiden wir für unseren Versuch, die Komplexität der Bilder zu bestimmen, die beiden Systemreferenzen der Kommunikation und der Wahrnehmung, wohl wissend, dass dies ein wissenschaftliches Unterfangen ist, das außerhalb der Wissenschaft auf Unverständnis stößt und auch 8 9 Siehe dazu auch Baecker (im Erscheinen). Siehe Luhmann (1984), 286ff.; und vgl. Koschorke / Vismann (1999); sowie Fuchs / Göbel (1994). 10 Siehe vor allem Luhmann (1984), 92ff. 66 innerhalb der Wissenschaft umstritten ist, solange nicht deutlich ist, welche empirischen Phänomene man im Rahmen der Annahme der Differenz von Systemreferenzen sichtbar machen kann. Das Unverständnis außerhalb der Wissenschaft müssen wir hinnehmen. Wir riskieren sogar, es zu steigern, da wir im Folgenden höchst unanschaulich ausgerechnet von «Bildern», dem Anschaulichen schlechthin, zu reden gezwungen sind. Am Streit innerhalb der Wissenschaft können wir uns nur beteiligen. Wir beteiligen uns an ihm, indem wir mit unserem unanschaulichen Begriff komplexer Bilder Phänomene nachzuzeichnen versuchen, die auch in den Bildwissenschaften unter den Titeln der Technisierung und Medialisierung auffällig geworden sind.11 Beides wird zuweilen als eine Art Entfremdung des Bildes vom künstle­r­ischen Sinn des Bildes gesehen und beklagt. Doch damit greift man zu kurz. Interessanter ist, dass die Technisierung nicht ohne eine Gestaltung und die Medialisierung nicht ohne eine Reflexion auf die unverfügbaren Voraussetzungen jeder Formbildung zu haben sind,12 so dass Bilder im wahrsten Sinne des Wortes zu epistemologischen Objekten werden. Im Folgenden wird es auch darum gehen herauszufinden, welche Kognitionen, nämlich die der Gesellschaft und die des Organismus in weitgehend unklarer Interdependenz, diesen epistemologischen Objekten zugrunde liegen. Die Systemreferenz der Kommunikation ist die Gesellschaft. Nur die Gesellschaft kommuniziert und jede Kommunikation findet in der Gesellschaft statt. Zugleich wird damit ein nicht mehr substantieller, sondern nur noch operationaler Begriff der Gesellschaft formuliert, der für die Existenz einer Gesellschaft nur annimmt, dass eine Kommunikation unter jeweils spezifizierbaren Bedingungen fortgesetzt werden kann, alle weiteren Fragen der Verfassung, Institutionen, Strukturen und Differenzierungsmuster der Gesellschaft jedoch offen lässt.13 11 Siehe nur Belting (2007). 12 Siehe die entsprechenden Technik- und Medienbegriffe bei Heidegger (1954); und Heider (2005). Beide Autoren verstehen Technik und Medium im besten Sinne des Wortes medientheoretisch, das heißt nicht nur als Gegenstände, sondern auch als immer nur partiell einholbare Voraussetzungen ihrer Überlegungen. 13 Siehe dazu Luhmann (1997); und vgl. Baecker (2007b); und zu einem gleichfalls in diesem Sinne operationalen Begriff der Gesellschaft auch Tarde (1999). 67 Und die Systemreferenz der Wahrnehmung ist der Organismus. In der Regel gehen wir vom Organismus des Menschen aus, obwohl wir damit nicht ausschließen wollen, dass auch Tiere in der Lage sind, Kommunikation zumindest in der Form der wechselseitigen Wahrnehmung wahrzunehmen. Mit der Systemreferenz Organismus vermeiden wir eine Festlegung auf entweder Körper oder Bewusstsein, obwohl und weil wir nicht ausschließen können, dass das Bewusstsein in der Wahrnehmung einen sowohl gegenüber der Kommunikation als auch gegenüber den Empfindungen des Körpers selektive Rolle spielt. Noch können wir ausschließen, dass das Bewusstsein eine Erfindung der Kommunikation ist, um den Körper sowohl positionieren als auch auf Distanz halten zu können.14 So oder so jedoch ist das Bewusstsein auf Leistungen des Gehirns angewiesen, das im Organismus angesiedelt ist und dort in seinen prozessualen Leistungen sowohl für die Kommunikation als auch für das Bewusstsein nicht zugänglich ist. Der Begriff der Wahrnehmung steht hier für die Eigenleistung eines Organismus, die von der Kommunikation, wenn sie Gesten, Sätze, Schrift, Töne und Bilder in Anspruch nimmt, vorausgesetzt werden muss und auch angeregt, ja sogar fasziniert werden kann, in jedem Fall jedoch nicht determiniert werden kann. Der Begriff der Wahrnehmung ist seinerseits ein Begriff, das heißt ein Produkt und Artefakt der Kommunikation, mit dessen Hilfe wir bezeichnen zu können versuchen, was wir meinen, wenn wir von Eigenleistungen eines Organismus sprechen, ohne allerdings den Begriff mit der Sache verwechseln zu dürfen. Wir haben zur Wahrnehmung eines Organismus nur in einem einzigen Fall, dem je individuellen, einen Zugang und wissen auch und gerade bezogen auf diesen einen Fall spätestens seit den dankenswerterweise mitgeteilten Selbstbeobachtungen Montaignes und Meditationen Descartes’, wie zweifelhaft die Leistungen sind, die hier erbracht werden.15 Wenn wir von uns auf andere schließen, bewegen wir uns bereits im Rahmen einer theory of the mind,16 die als Unterstellung, dass auch das soziale Gegenüber der Selbst- und Fremdbeobachtung fähig ist, mindestens ebenso sehr kommunikativen wie perzeptiven Ursprungs ist. 14 Siehe etwa James (1922). 15 Siehe de Montaigne (1962); und Descartes (1986). 16 Im Sinne von Whiten (1991). 68 IV. Der Begriff der Kommunikation ist deshalb so anspruchsvoll, weil er zwei Systemreferenzen miteinander kombiniert. Er bezeichnet zum einen die Operation sozialer Systeme, die kommunizieren, um sich auszudifferenzieren und zu reproduzieren, und sich in diesem Rahmen Strukturen, Codes, Institutionen und Programme geben. Und er bezeichnet zum anderen die Notwendigkeit der Adressierung eines weiteren Systems in der Umwelt sozialer Systeme, nämlich organische Systeme, und damit zugleich ein Objekt in der Umwelt dieser organischen Systeme. Kommunikation gelingt nur, wenn es ihr gelingt, Organismen zu rekrutieren, die bereit sind, sich an ihr zu beteiligen und ihr als Mindestbedingung ihrer Reproduktion so etwas wie ein aufmerksames Bewusstsein zur Verfügung zu stellen.17 Der Begriff der Kommunikation ist eine Erfindung der Kommunikation, eine Form der Selbststrukturierung, innerhalb derer sich die Kommunikation auf diese Notwendigkeit der Adressierung hinweist und als Bedingung dieser Adressierbarkeit die Vermutung formuliert, dass sie in der Tat Organismen auffällt, deren unabhängige Lebensform sie jederzeit dazu befähigt, sich von Kommunikationsangeboten ab- und anderem zuzuwenden.18 Als mise en abîme ihrer selbst, als unendliche Wiederholung ihres Bezugs auf eine Wahrnehmung, die ihrerseits auf Kommunikation Bezug nehmen kann, aber nicht muss, ist die Kommunikation notwendigerweise ihrerseits komplex. Sie ist Einheit einer Vielfalt,19 Zusammenführung zweier Zeitrei17 Siehe auch Luhmann (1988). 18 Heute muss man die Frage aufwerfen, ob sich neben Organismen mit ihrem Bewusstsein möglicherweise auch andere hinreichend komplexe, gedächtnisfähige und intransparente Systeme an der Kommunikation beteiligen können, etwa Computer. Noch ist es wohl nicht so weit, aber eine «Unbestimmtheitsstelle» empfiehlt Luhmann schon einmal für sie bereitzuhalten. Siehe dazu Luhmann (1997), 118. 19 So der Komplexitätsbegriff von Luhmann (1990), 59–76; vgl. ders. (1984), 45ff.; Weaver (1948); und Morin (1974). Der Begriff der Komplexität ist der Begriff eines Beobachters, der einem Phänomen, das er weder kausal noch statistisch erklären kann, stattdessen Selbstorganisation unterstellt. Selbstorganisation ist ihrerseits Reproduktion einer Differenz, die Selektivität zwischen den Elementen und in den Relationen des Phänomens auf beiden Seiten der Differenz voraussetzt. Die Kombination zweier oder mehrerer Sys- 69 hen, die nicht aufeinander reduziert werden können,20 Kultivierung einer Trope, in der das Unvereinbare miteinander kombiniert wird.21 Und vermutlich ist auch die Wahrnehmung komplex, da es ihr immer und mindestens gelingen muss, die Eigenleistung der Wahrnehmung und das wahrgenommene Objekt voneinander zu unterscheiden, um sich so auf Halluzination und Illusion, auf Irrtum und Korrekturmöglichkeit zumindest im jeweiligen Nachhinein aufmerksam zu machen und je nach Bedarf auf neuronale Prozesse, phänomenologische Befunde und objektive Gegebenheiten zurechnen zu können.22 Komplexe Bilder befinden sich daher in einer guten Gesellschaft. Als kommunizierte Wahrnehmung und, das darf man jetzt wohl hinzufügen, wahrgenommene Kommunikation, haben sie ihren «Grund» in komplexer Kommunikation und komplexer Wahrnehmung. Das ist jedoch kein Grund, jede Hoffnung auf ihre Bestimmung fahren zu lassen, sondern ganz im Gegenteil erst die Voraussetzung für ihre Bestimmung. Denn jetzt kann die temreferenzen, wie oben im Text, ist die Wahl und Entscheidung eines Beobachters, der sich seinerseits als komplexes, in einer Umwelt ausdifferenziertes System reproduziert, in unserem Fall: als Wissenschaft beziehungsweise als «Theorie» innerhalb der Wissenschaft. Dieser Wahl und Entscheidung liegt daher der Versuch des Beobachters zugrunde, auf Probleme zu reagieren, die er in seinem Ereignisraum registriert. Die Kybernetik und Systemtheorie unterstellt, dass dies für jeden Beobachter gilt, und geht zugleich davon aus, dass jeder Beobachter auf andere Probleme reagiert. Wenn wir im Text an einer soziologischen Theorie arbeiten, kann das, muss jedoch nicht für Kunsthistoriker und andere Bildwissenschaftler, ganz zu schweigen von Zeichnern, Malern, Fotografen, Filmemachern und Bildprogrammierern, interessant sein. 20 Siehe Wiener (1964), der deswegen Kommunikationsingenieuren und Statistikern den Rückgriff auf Fouriers Transformationen empfiehlt, die mit Berechnungen komplexer Ebenen arbeiten. Siehe zu einem dazu passenden mathematischen Begriff der Komplexität Stillwell (2002), 383f. 21 So im Sinne von Lotman (2010), 9f. und 53ff. 22 Phänomenologische Befunde sind Befunde des Bewusstsein, nicht des Sachverhalts, wenn man der Übung Husserls folgt, am Phänomen, das sich dem Bewusstsein einprägt, das Bewusstsein beobachtbar zu machen. Siehe Husserl (1950). Siehe zur Unmöglichkeit, zwischen Wahrnehmung und Täuschung im Moment der Wahrnehmung selber zu unterscheiden (wohl aber: im Zuge einer Beobachtung der Beobachtung im Moment danach, für den jedoch wiederum dasselbe gilt), Maturana (1994). 70 Komplexität eines Bildes auf eine ihrerseits irreduzible Differenz reduziert werden, die als diese Differenz das Bild organisiert. Komplexe Bilder, kann man dann sagen, bewegen eine einfache Differenz, die als diese Differenz auf zwei ihrerseits komplexe Sachverhalte verweist. Man hat es mit einer fraktalen, sich selbst wiederholenden Komplexität zu tun, die jedoch, um sich wiederholen zu können, auf Operationen der Anschlussfindung angewiesen ist, das heißt auf Zwischenergebnisse, die als Resultate eines unabschließbaren Prozesses gerade dann definiert sein müssen, wenn diese Unabschließbarkeit gewahrt und reproduziert werden soll. Ein komplexes Bild ist ein solches Zwischenergebnis. Was immer es zeigt, wer auch immer es sich anschaut und wozu auch immer es Verwendung findet, es kombiniert zwei Operationen zweier Systeme in ein Ereignis, das in beiden Systemen zu unterschiedlichen Anschlussereignissen führen kann. Es übersetzt somit die unbestimmte Komplexität der beiden Systeme, an denen es beteiligt ist, Gesellschaft und Organismus, in die bestimmte Komplexität einer Differenz, die gleich anschließend wieder auseinanderfallen kann. Unter der Hand haben wir mit dieser Formulierung jedoch bereits einen ersten Hinweis darauf gegeben, worin die Komplexität eines Bildes besteht. Sie besteht nicht nur in der Koinzidenz von Kommunikation und Wahrnehmung, Gesellschaft und Organismus, sondern sie besteht darin, dass diese Koinzidenz, verstanden als Differenz, auf beiden Seiten der Unterscheidung, während die jeweils eigene Seite der Unterscheidung bezeichnet wird, zugleich auf die jeweils andere Seite der Unterscheidung verweist. Mithilfe der Notation von George Spencer-Brown für Bezeichnungen,23 die auf Unterscheidungen zurückgeführt, und für Unterscheidungen, die in den Raum der Unterscheidung wieder eingeführt werden können, geben wir die mathematische Formel für ein komplexes Bild an: Gl. 1: Bild = Wahrnehmung Kommunikation 23 In: Spencer-Brown (2008). 71 Man beachte, dass die Gleichung die Form eines Diagramms hat, das heißt einer über die Linearität der Schrift hinausgehenden mindestens zweidimensionalen Darstellung, die wie jede mathematische Formel einen simultan wahrnehmbaren Sachverhalt präsentiert, der nicht in einen sequentiell lesbaren Text zurückübersetzt werden kann.24 Handelt es sich deswegen bereits um ein Bild? Entscheidend ist zunächst, dass die Gleichung einen Sachverhalt, das «Bild», identisch setzt mit zwei operativ vollzogenen und ineinander geschachtelten Bezeichnungen, der Bezeichnung von Wahrnehmung und der Bezeichnung von Kommunikation. Entsprechend unseres hier gewählten Ansatzes gehen wir davon aus, dass die beiden Bezeichnungen auf Unterscheidungen zurückgeführt werden können, die ihrerseits als Wahrnehmung und als Kommunikation bezeichnet werden können. Das heißt, im Bild bezeichnen die Wahrnehmung und die Kommunikation zunächst sich selbst und unterscheiden sich dann voneinander. Wahrnehmung nimmt wahr, dass sie Wahrnehmung ist und keine Kommunikation. Und Kommunikation stellt fest, dass sie Kommunikation ist und keine Wahrnehmung. Mit diesen beiden Bezeichnungen im Rahmen sich selbst bezeichnender Unterscheidungen ist jedoch noch kein Bild konstituiert. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Unterscheidung in den Raum der getroffenen Unterscheidung wiedereingeführt, das heißt auf ihre «Form» hin beobachtet wird: Die Kommunikation stellt fest, dass sie der Wahrnehmung bedarf; und die Wahrnehmung stellt fest, dass sie der Kommunikation bedarf, damit beide zusammen «Bild» werden können. Im Rahmen der Unterscheidung unserer beiden Systemreferenzen bedeutet dies, dass im Bild die Unverfügbarkeit der beiden Systemreferenzen füreinander Ereignis wird, das heißt, sich als Bild manifestiert. 24 Wie es sich trifft, erfahren Diagramme jüngst wieder eine verstärkte Aufmerksamkeit, weil sie Rechnungen veranschaulichen und damit in einem pragmatischen Zusammenhang stehen, zugleich jedoch ein kulturelles Vorwissen voraussetzen, um gelesen werden zu können. In ihnen wird Mathematik kulturell, ohne aufzuhören, technisch zu sein. Siehe in diesem Sinne Bogen / Thürlemann (2003); Krämer (2009); Bauer / Ernst (2010). 72 V. Die Überlegung von Ernst H. Gombrich, welche Rolle das Bild in der Kommunikation spielt, muss demnach ergänzt werden. Gombrich wies im Anschluss an die Sprachtheorie Karl Bühlers und die mathematische Kommunikationstheorie Claude E. Shannons und Warren Weavers darauf hin, dass das Bild eindeutig Information («Appell») und uneindeutig Mitteilung («Ausdruck») sei, da man zwar sähe, was es abbildet, aber nicht wissen könne, wer sein Absender und wer sein Adressat ist.25 Das ist richtig. Richtig ist jedoch auch, dass das Bild eindeutig Mitteilung und uneindeutig Information ist, denn sicherlich ist es kommuniziert worden, wenn es gezeigt wird, aber worüber es informieren will, kann durchaus unklar sein. In beiden Fällen ist zur Klärung der Uneindeutigkeiten ein Rückgriff auf jene Redundanz erforderlich, die in den jeweiligen Eindeutigkeiten zwar Anhaltspunkte, aber keine restlose Aufklärung findet. Weder erlaubt der Gegenstand einer Abbildung einen eindeutigen Rückschluss auf Absender und Adressat, noch erlauben Absender und Adressat einen eindeutigen Rückschluss auf den Gegenstand der Abbildung. Auch dies ist ein Indikator der Komplexität der Bilder, wenn nicht sogar einer unhintergehbaren Unschärferelation im Bild, die sich noch vor jeder Betrachtung des im Bild Dargestellten aus den wechselseitigen Freiheitsgraden von Information und Mitteilung ergibt. Diese Unschärferelation ist die Voraussetzung dafür, dass die Kommunikation des Bildes weder im Informationsgehalt noch in der Mitteilung des Bildes zum Abschluss kommt, sondern erst in jenem Akt des Verstehens, der durch die Information und die Mitteilung nicht vorweggenommen werden kann, sondern umgekehrt erst die Information auf die Mitteilung und die Mitteilung auf die Information bezieht.26 Die Unschärferelation wird in diesem Akt des Verstehens, der die Kommunikation abschließt und Anlass für die darauf folgende Kommuni25 Siehe Gombrich (1984). Und vgl. Bühler (1974); Shannon / Weaver (1963). Siehe mit einer Forderung nach einer Wissenschaft der Bilder, genannt eiconics, im Anschluss an Theorien der Information, der Kommunikation und der Organisation auch bereits Boulding (1957), insbesondere 148ff. 26 So der Kommunikationsbegriff von Luhmann (1984), 193ff. 73 kation ist, sowohl zugunsten einer bestimmten Eindeutigkeit aufgelöst als auch in eine neue Uneindeutigkeit übersetzt. Denn die Rückfrage danach, ob der abschließende Akt des Verstehens die Information und die Mitteilung treffend identifiziert und aufeinander bezogen hat, ist nur dadurch zu klären, dass das vorliegende Verstehen neuerlich nach Information und Mitteilung differenziert und in einem weiteren und wiederum riskanten Akt des Verstehens im Hinblick auf Information und Mitteilung spezifiziert wird. Content ambiguity und target ambiguity sind keine unangenehmen Begleitumstände einer noch nicht hinreichend geklärten Kommunikation, sondern die Bedingung dafür, dass Kommunikation erforderlich ist und von Kommunikation die Rede sein kann.27 Jede «Evidenz» des Zeigens ist gerahmt durch eine «Politik» des Zeigens,28 deren Referenz keine andere «Tatsache» als die des Bildes selber sein kann,29 das heißt der in Anspruch genommenen Differenz von Gegenstand und Abbildung in einem bestimmten Moment der Vorführung dieser Differenz. Die Pointe dieses Hinweises auf die Komplexität der Bilder besteht nicht darin, für eine Reduktion der Komplexität auf den pragmatischen Zusammenhang des Herstellens, Sammelns, Archivierens, Zeigens und Versteckens von Bildern zu plädieren oder gar für diese Pragmatik ausschließlich soziale Determinanten für erklärungstauglich zu halten. Bilder gehen in ihrer sozialen Codierung oder im Status und Habitus derer, die sie herstellen, zeigen oder betrachten, nicht auf. Sie legen immer auch Spuren, die auf eine phy­ sische Wirklichkeit der Farbe, Form und Figur und auf eine technische Apparatur des Präparierens, Sicherns und Verwischens dieser Spuren verweisen,30 so sehr dann sowohl die physische Wirklichkeit als auch die technische Apparatur wiederum in einem variablen Zusammenhang stehen mit deren Setzung, Rahmung und Erkundung innerhalb umstrittener und laufend variierter sozialer Konventionen.31 27 Siehe zu den Begriffen der content und target ambiguity Leifer (2002). 28 Siehe Boehm (2010); sowie Berg / Gumbrecht (2010), und hier insbesondere den Beitrag von Schmidt-Wulffen (2010). 29 Im Sinne von Wittgenstein (1963), Punkt 2.141: «Das Bild ist eine Tatsache». 30 Siehe für den Fall der Fotografie Geimer (2010b); Ders. (2010a). 31 Wir haben es, mit anderen Worten, auch im Fall einer Theorie der Bilder mit einem Kon­ 74 Die Komplexität des Bildes ist der Fall sowohl für die Kommunikation als auch für die Wahrnehmung. Beide Operationen müssen deshalb so gefasst werden, dass rekonstruiert werden kann, dass und wie diese Komplexität der Fall ist und dass und wie diese Komplexität fallweise in die Eindeutigkeit des Bildes, einer kommunizierten Wahrnehmung überführt werden kann, ohne auszuschließen, im bereits nächsten Moment wieder uneindeutig werden zu können. Der Begriff der Komplexität ist seinerseits komplex, da er sowohl phänomenologisch als auch operativ verstanden werden muss. Er erfasst die Welt als unfassbar und beschreibt die Operation der Ausdifferenzierung und Reproduktion in dieser Welt. Er hat die Form einer «Form» im Sinne von George Spencer-Brown, indem er auf eine Operation der Unterscheidung, eine Bezeichnung von Zuständen und einen immer mitlaufenden unmarkierten Raum der Möglichkeiten zugleich verweist. Sein Ausgangspunkt ist nicht die Bestimmtheit der Dinge im Rahmen eines ontologischen Paradigmas, sondern die Unbestimmtheit und damit je aktuelle und je operative Bestimmbarkeit der jeweils vorherigen und nachfolgenden Operation im Rahmen eines konstruktivistischen Paradigmas. Tatsächlich liegt eine relativ einfache (!) Bedingung für die Möglichkeit des Festhaltens an diesem Begriff der Komplexität im Allgemeinen und der komplexen Bilder im Besonderen darin, sowohl für die Operation der Kommunikation in der Gesellschaft als auch für die Operation der Wahrnehmung durch einen Organismus eine jeweils konstitutive Nachträglichkeit anzunehmen. Für den Fall der Wahrnehmung bedeutet dies, dass die Wahrnehmung sich in einer aktuellen Gegenwart auf jeweils wie immer minimal vergangene Ereignisse bezieht und damit unaufhebbar mit dem Problem konfrontiert ist, sich ein «Bild» von einer Sache zu machen, die möglicherweise so schon nicht mehr der Fall ist. Wir kompensieren und entfalten diese prinzipielle, wenn auch minimale Ungewissheit dadurch, dass wir für jede Wahrnehmung eine Evidenz in Anspruch nehmen, die dennoch damit rechnet, im nächsten struktivismus zu tun, der nicht «radikal» die Bilder als «Erfindungen» von Kommunikation und Wahrnehmung beschreibt, sondern «operational» am Bild sowohl die Kommunikation als auch die Wahrnehmung als Formen der Erkundung von Welt begreift. Siehe etwa Luhmann (1990); Latour (2003). 75 Moment als Illusion entlarvt werden zu können.32 Obwohl und indem das eine dem anderen widerspricht, rechnen wir mit beidem. Auch der Begriff der Kommunikation stellt auf diese konstitutive Nachträglichkeit ab. Kommunikation, so formuliert Niklas Luhmann, ermöglicht sich «von hinten her (…), gegenläufig zum Zeitablauf des Prozesses».33 Die beiden Selektionen einer Information und einer Mitteilung müssen bereits vorliegen beziehungsweise werden als bereits vorliegend gesetzt, wenn anschließend eine Selektion des Verstehens die beiden vorherigen Selekti­onen unterscheidet und in diesem Unterschied aufeinander bezieht. Das Verstehen als hinzutretende Selektion synthetisiert, so Luhmann, alle drei Selektionen zur einheitlichen und in dieser Einheit emergenten Operation der Kommunikation. Wegen dieser Nachträglichkeit ist der jüngere Kommunikationsbegriff bei Claude E. Shannon wie bei Norbert Wiener in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kontrollbegriff formuliert worden.34 Es geht zum einen darum, dass ein Verstehen für sich feststellt, welche Information und welche Mitteilung bereits vorliegen. Zum anderen jedoch sind alle drei Selektionen aktiv vorgenommene Selektionen, deren letzte auch nicht nur rezipiert, welche beiden ersten bereits gegeben sind, sondern in ihrer eigenen Selektivität konstruiert und konstituiert, welche Information und welche Mitteilung sie voneinander unterscheidet und aufeinander bezieht. Wiener spricht deshalb von einer control by informative feedback,35 die nicht statisch, sondern oszillierend arbeitet, und an Identitäten nur festhält, wenn diese sich im laufend neu statistisch rekonstruierten Ereignisraum als Identitäten behaupten. «Kontrolle» heißt hier demnach nicht Beherrschung des Anderen, sondern Selbst-Regulation, und diese Selbst-Regulation besteht in der Erprobung von Unterschieden im Raum der Unbestimmtheit beziehungsweise des Zufalls.36 Die doppelte Nachträglichkeit ist der «Raum», in dem sich das Bild sachlich, zeitlich und sozial einrichtet, um seine Bestimmtheit zu gewinnen. Die32 Siehe dazu Bateson / Bateson (1988), 95ff.; und vgl. mit Bezug auf neurophysiologische Forschung Frith (2007). 33 So Luhmann (1984), 198. Und vgl. Stäheli (2000), 184ff. 34 Siehe insbes. Wiener (1961). 35 Ebd., 113. 36 So Molnar / Molnar (1989). 76 ser Raum kann in Hundertstelsekunden durchschritten sein, er kann aber auch Minuten, Tage und Jahre der Rekonstruktion benötigen. Jedes studium dieses Raumes, mit dem Begriff von Roland Barthes,37 wird immer auf ein punctum warten oder auch von einem punctum ausgehen, in dem die Kontingenz der Möglichkeiten in die Notwendigkeiten des «So war es» und «Ich sehe es» kippt und dort so lange verweilt, bis wir das Bild und das Bild uns zu «bewohnen» beginnen. Auch wegen der Arbeit, die das Ausmessen des Raums der Nachträglichkeit kostet, ist dieses Bewohnen der Bilder und Wohnen der Bilder in uns ein alles andere als unschuldiger, sondern für die weitere Wahrnehmung und weitere Kommunikation weiterer Bilder prägender, Pfadabhängigkeiten legender Vorgang.38 Für unser Verständnis komplexer Bilder ist es entscheidend, dass wir deren Begriff so formulieren, dass die Komplexität und deren Reduktion gleichermaßen rekonstruiert werden können. Der Begriff muss abbilden (!) können, dass es im Raum der Nachträglichkeit der kommunizierten Wahrnehmung sowohl gelingt, Bilder zu zeigen und zu sehen und so zumindest als «Bilder» eindeutig werden zu lassen, wie auch gelingt, in diese Eindeutigkeit Verweise auf eine unreduzierbare Uneindeutigkeit einzubauen, die konstitutiv unklar bleiben lässt, ob der andere gesehen hat, was man selber gesehen hat. Ohne diese Uneindeutigkeit hätte man es nicht mit Kommunikation und Wahrnehmung, sondern mit Technik zu tun und dies auch nur auf eine Art und Weise, wie eine Maschine es mit Technik zu tun hat, nämlich ohne eine Wahl zu haben. VI. Komplexe Bilder gewinnen ihre Eindeutigkeit aus ihrer Uneindeutigkeit, nämlich aus Konstruktionsleistungen von Kommunikation und Wahrnehmung angesichts von Farbe, Form und Figur, die kein Zufall zu sein scheinen; und sie gewinnen ihre Uneindeutigkeit aus ihrer Eindeutigkeit, 37 In: Barthes (1980). 38 So Tisseron (2007). 77 nämlich aus der Unmöglichkeit, diese in der Kommunikation und in der Wahrnehmung länger als für den Moment festzuhalten. Wir schlagen vor, die aus deren Reduktion generierte Komplexität der Bilder auf den Begriff der symbolischen Differenz der Bilder zu bringen. Wir orientieren uns damit an Gottfried Boehms Begriff der «ikonischen Differenz»,39 korrigieren diesen Begriff jedoch mithilfe der Semiotik von Charles Sanders Peirce (auf den sich auch Boehm bezieht, jedoch nur um zu begründen, dass er sich nicht auf ihn bezieht) zum Begriff der symbolischen Differenz. Die ikonische Differenz, so Boehm, organisiert die Einzelereignisse eines Bildes (Farbe, Form, Figur) im Hinblick auf deren Differenz untereinander und im Hinblick auf das «anschauliche Ganze» des Bildes, das meist im Kontrast steht oder diesen herstellt, zum unanschaulichen Rest der Welt außerhalb des Bildes. Dieser Begriff der ikonischen Differenz scheint primär kunsthistorisch motiviert zu sein. Er setzt das Bild ikonisch, mit Peirce,40 das heißt als «Erstheit», der alle hinzutretenden Indizes, also Verweise («Zweitheit»), und Symbolik, also Interpretation («Drittheit»), erst einmal nichts anhaben können, beziehungsweise die vor diesen in Schutz genommen werden muss, um sich dem Kennerblick des Kunsthistorikers jungfräulich unberührt, wenn nicht sogar göttlich unberührbar immer wieder neu zeigen zu können. Dieser Begriff ist in der Kunstgeschichte produktiv, liefert er doch eine fast schon mimetische Grundlage für die Notwendigkeit, sich der langen Nachwirkungen von theologischem Bilderverbot, philosophischem Bilderverdacht und intellektueller Bildverachtung immer wieder neu kritisch zu vergewissern, zumal diese Traditionen der Neigung, Bild und Dargestelltes naiv miteinander zu verwechseln, eher zu- als ihr entgegenzuarbeiten. Dennoch kann die Soziologie diesem kunsthistorischen Begriff der ikonischen Differenz nicht folgen. Die Soziologie hat es nie nur mit Erstheiten zu tun, sondern immer mit Erstheiten im Kontext von Zweit- und Drittheiten. Wir schlagen daher vor, im Anschluss an Peirces Unterscheidung von Ikone, Index und Symbol von einer symbolischen Differenz zu sprechen und 39 Siehe Boehm (2007). 40 Siehe zum Folgenden vor allem Peirce (1983); und vgl. Oehler (1993), insbes. 55ff., zur Motivation der Semiotik von Peirce aus dessen Auseinandersetzung mit der Kategorienlehre Kants. 78 somit das Zeichen, das ein Bild setzt, von der Interpretation und damit «von hinten her» zu rekonstruieren. Dies reduziert den Bildbegriff dann nicht auf einen Begriff der Rezeption des Bildes durch den Betrachter, wenn man, wie wohl unvermeidbar, davon ausgeht, dass bereits das Herstellen eines Bildes im Akt des Zeichnens, Malens, Fotografierens oder bloßen Sichvorstellens ein Vorgang der Interpretation, des Sortierens der Einzelereignisse des Bildes und der Tatsache des Bildes selber im Hinblick auf die Möglichkeit des nachträglichen Verstehens ist. Wie sonst soll ein Maler, ein Fotograf, ein Redakteur das Bild als Bild identifizieren können? Der Vorzug des Begriffs der symbolischen Differenz besteht darin, dass er geeignet ist, zu beschreiben, wie die Ikonizität des Bildes mithilfe welcher Indizes konstruiert und organisiert ist. Das, was dank der Interpretation, dank des Verstehens, so ist, wie es ist («Erstheit», icon), kann nur sein, was es ist, weil es von einem anderen so bezeichnet wird («Zweitheit», index), das sich von einem Dritten («Drittheit», symbol) als etwas gesetzt sieht, das mit dem Ersten nicht verwechselt werden darf.41 Zwar denkt die Drittheit die Erstheit als unabhängig vom Akt ihrer Symbolisierung, weiß jedoch zugleich, dass ohne ein Zweites, dass auf das Erste mithilfe eines Index verweist, von diesem Ersten keine Rede sein könnte. Die Unhintergehbarkeit des Verweises, der vom Ersten berichtet, wird im Begriff des «Symbols» festgehalten, in dem seit jeher Abstand von der Sache, Selbstbezeichnung des Zeichens und Durchgriff auf die Sache zusammenzudenken versucht wird.42 Das Symbol ist immer «bloßes Symbol», «immerhin ein Symbol» und «wirkende Kraft» zugleich. Indem es seine Zeichenhaftigkeit, die Wirklichkeit, die es bezeichnet, und die Wirklichkeit, die es in Differenz zur ersten Wirklichkeit selber entfaltet, in einen Begriff zu bringen versucht, ist es seinerseits nichts Geringeres als komplex: Einheit einer Vielfalt. Das Symbol ist nicht nur komplex, indem es eine Vielfalt zur Einheit bringt, sondern auch paradox, indem es ist, was es nicht ist, unwirkliche Wirklichkeit. Genau das lässt es jedoch selber bildhaft werden. Es hat eine Einheit; es hat eine Wirklichkeit; und es unterscheidet sich von einer Wirk41 Siehe Peirce (1983), 55ff. 42 Siehe zu diesem Symbolbegriff Luhmann (1997), 235, 255f. et passim; und vgl. LéviStrauss (1978); Leach (1976); Swidler (1986); Lotman (2010), 147ff.; Willke (2005). 79 lichkeit, auf die es gleichwohl Bezug nimmt und ohne die es nicht zu denken ist. Das Symbol ist, wie Ernst Cassirer dies formuliert, Darstellung der notwendigen Verknüpfung von Erscheinungen,43 die die Notwendigkeit der Verknüpfung ebenso ernst nimmt wie den bloßen Darstellungs- und Erscheinungscharakter. Letztlich erprobt das Symbol in der Sprache, im Mythos und in der Wissenschaft Verknüpfungen, von denen es nur weiß, weil es sie aus Phänomenen abliest, über die es sich, wie es ebenfalls weiß, täuschen kann. Immerhin jedoch sind Symbole darin verlässlich, dass sie den, der an Symbole glaubt, mit dem verknüpfen, woran er glaubt.44 Bestimmt man das Bild über seine symbolische Differenz, wird es möglich, es als einen semiotischen Akt zu beschreiben, der im Bild und aus der Perspektive einer nachträglichen Wahrnehmung sowie einer nachträglichen Kommunikation ein Dargestelltes, eine Darstellung und einen Betrachter aufeinander bezieht und als Zusammenhang ihrer Unterscheidung beschreibt.45 Die Pointe daran ist, dass das Bild nicht nur der Zusammenhang seiner bildlichen Ereignisse im Kontext eines anschaulichen Ganzen, so noch einmal Boehms Begriff der ikonischen Differenz, sondern darüber hinaus Motivation dieses Zusammenhangs im Kontext einer referierten Wirklichkeit (unter Einschluss der Möglichkeit der Referenz auf eine unreferierbare Wirklichkeit) und eines die Referenz für sich rekonstruierenden (oder verfehlenden) Betrachters ist. So erst wird das Bild zur kommunizierten Wahrnehmung und wahrnehmbaren Kommunikation. So allerdings reicht der Bildbegriff über Zeichnungen, Tafelbilder, Fotografien und die bewegten Bilder des Kinos, des Fernsehens, des Videos und des Bildschirms auch hinaus und erfasst jede Art der Symbolisierung, die im Symbol dessen differentiellen Zeichencharakter mitzulesen vermag. Die symbolische Differenz ist in jedem einzelnen Fall eines Bildes semantisch, syntaktisch und pragmatisch zu bestimmen.46 Es hat eine Bedeutung, zu bestimmen aus den Sinnbezügen zwischen den Elementen des Bildes und 43 Siehe Cassirer (1994), 17f. 44 So auch der Ausgangspunkt von White (1969). 45 Siehe noch einmal Wittgenstein (1963), Nr. 2.1511: «Das Bild ist so mit der Wirklichkeit verknüpft; es reicht bis zu ihr». 46 Siehe zu dieser Unterscheidung Morris (1938). 80 den Elementen seines Kontextes. Es hat eine Grammatik, zu bestimmen aus der funktionalen Ordnung, die diesen Elementen gegeben wird beziehungsweise die zur Ordnung dieser Elemente vorausgesetzt und/oder unterlaufen wird. Und es hat seinen Handlungsbezug, zu bestimmen aus dem Gebrauch des Bildes, der, bezogen auf Bilder der Kunst, auch darin bestehen kann, jeden anderen Gebrauch als den seiner Kontemplation zu unterbinden. Erst so ist das Bild als Element des decorum einer Gesellschaft zu begreifen, das die Blicke jener Betrachter auf sich zieht, die sich zu diesem decorum in ein sei es affirmatives, sei es kritisches Verhältnis zu setzen suchen.47 Der Begriff des Symbols passt auch hier, da Semantik, Syntax und Pragmatik im Bild ebenso ernst genommen wie, sobald gezeigt und vorgeführt, als kontingent und damit variierbar verstanden werden. VII. Wie die Sprache und die Musik sind die Bilder Medien der strukturellen Kopplung von Kommunikation und Wahrnehmung.48 Für den Moment ihrer Kommunikation von Wahrnehmung koppeln sie Strukturen der Ausdifferenzierung und Reproduktion des Organismus und Strukturen der Ausdifferenzierung und Reproduktion der Gesellschaft. Wie die Sprache und die Musik sind sie auf ein Bewusstsein dieser Kommunikation von Wahrnehmung angewiesen, das die beiden Systemreferenzen voneinander trennt und die Wahrnehmung dem Organismus (besser noch: dem «Ich» dieses Organismus, denn der wahrnehmende Organismus wird in der Wahrnehmung typischerweise nicht mit wahrgenommen) und die Kommunikation der Gesellschaft zurechnet. Wichtig ist der Hinweis, dass nicht das einzelne Bild, das einzelne Wort oder das einzelne Musikstück diese Kopplung von Kommunikation und Wahrnehmung leisten, sondern die an diesen Bildern, Worten und Musik47 Und auch das kritische Verhältnis ist ein sich selbst affirmierendes, die Distinktion suchendes Verhältnis, wie vor allem Bourdieu (1979) gezeigt hat. 48 Siehe zum Begriff der strukturellen Kopplung Maturana (1975) und bezogen auf Kunstwerke: Luhmann (1992). 81 stücken ihre Anhaltspunkte findende kommunizierte Wahrnehmung und wahrgenommene Kommunikation selber. Die Kopplung ist auf beiden Seiten der Differenz nicht extern, sondern intern vermittelt, nimmt jedoch zur Organisation dieser Vermittlung auf Fremdreferenzen, das heißt auf die Zurechnung dieser Vermittlung auf extern vorliegende Anhaltspunkte Bezug. Das Bewusstsein, so formuliert Luhmann, unterbricht die Selbstreferenz des Organismus und erzwingt die Externalisierung von Wahrnehmung, obwohl und weil und während alle Wahrnehmung ausschließlich innerhalb des Organismus auf der Grundlage von Gehirn und Körperlichkeit hergestellt werden kann.49 Die Bilder, Worte und Musikstücke selber sind boundary objects,50 die physisch sind, was sie sind, während Kommunikation und Wahrnehmung sie behandeln, als wären sie für beide Systemreferenzen dasselbe. Wie die Sprache und die Musik nehmen auch die Bilder das Medium des Sinns für die Reproduktion von Kommunikation und Wahrnehmung und für die Vermittlung von Kommunikation und Wahrnehmung in Anspruch. Bilder müssen auf beiden Seiten der Differenz sinnvoll sein, inklusive der Möglichkeit des sinnhaften Bezugs auf ihre Sinnlosigkeit, um kommunikativ und perzeptiv verarbeitet werden zu können. Und «Sinn» heißt, dass jede Zuweisung von Bedeutung innerhalb eines durch die einzelne Zuweisung auf Abstand gehaltenen und dadurch erschlossenen Raums weiterer möglicher Verweisungen stattfindet, die potentiell mitlaufen und jederzeit aktualisiert werden können.51 Sinn ist immanent unruhig und schon deswegen darauf angewiesen, in Sprache, Bildern und Musik je anders und für den Moment wie für die Situation passend eingefangen und mit weiteren Möglichkeiten angereichert zu werden. Es ist schwer, den Unterschied zwischen Sprache, Musik und Bildern festzuhalten, denn kaum hat man Unterschiede benannt, findet man ihre Struktur auch in den anderen Medien, die schon wegen der Unruhe des Sinns, ganz zu schweigen von aisthetischer und ästhetischer Intervention und Subversion, beieinander Anleihen aufnehmen. Für den ersten Zugang genügt es, darauf zu verweisen, dass die Musik strukturelle Kopplungen vor allem im Medium der Zeitlichkeit, die Sprache vor allem im Medium der Sequentialität und die 49 So Luhmann (1995), 14f. 50 Mit dem Begriff von Star (1989). 51 So der Begriff des Sinns bei Luhmann (1971). 82 Bilder vor allem im Medium der Simultaneität vornehmen, doch bereits diese Formulierung taugt nur dann etwas, wenn man Zeitlichkeit, Sequentialität und Simultaneität als Formen versteht, das heißt Zeitlichkeit mit Tempo, Dauer und Zeitlosigkeit, Sequentialität mit Abbruch, Wechsel und Wiederaufnahme und Simultaneität mit Narration, Entfaltung und Inversion kombiniert.52 Jedes dieser Medien der strukturellen Kopplung von Kommunikation und Wahrnehmung kann die Komplexität der Systemreferenzen wie ihrer Kopplung nur durch Formen der Rekursivität bedienen, von denen die Mathematik der Faltungen, Knoten, Fraktale und Netze eine erste Ahnung vermittelt.53 So oder so jedoch ist Rekursivität das Stichwort, das auf die Frage antwortet, wie Sprache, Musik und Bilder die Komplexität ihrer Systemreferenzen und deren Kopplung sowohl auffangen und auf einzelne Sätze, Musikstücke und Bilder reduzieren können als auch dank dieser Reduktion steigern und erweitern können. Das Kalkül, das dieser Leistungsfähigkeit zugrunde liegt, ist das statistische Kalkül, das Claude E. Shannon, Warren Weaver und Norbert Wiener für die Theorie der Kommunikation beschrieben haben und das im Wesentlichen darin besteht, in den Ereignisräumen, in denen die Kommunikation sich orientiert, jene Redundanz herzustellen, die es erlaubt, alle anderen Ereignisse auf Varietät zuzurechnen.54 Kommunikation ist Suche nach Überraschungen, um an ihnen das Vertraute sowohl zu bewähren als auch vorsichtig, denn Redundanz ist ein prekäres Gut, zu erweitern. Vermutlich gilt dasselbe für die Wahrnehmung.55 Die Theorie der Bilder, um Sprache und Musik wieder auf sich beruhen zu lassen, ist nicht zuletzt deshalb so schwer zu formulieren, weil die Rekursivität, die hier die Strukturen der Redundanz wie der Varietät liefert, nicht etwa im Bild, sondern in der kommunizierten Wahrnehmung des Bildes für 52 Für die bewegten und bewegenden Bilder des Kinos, matière intelligible und automate spirituel, gilt das Interesse insbesondere der Frage, welche Bilder sich «automatisch» auseinander ergeben und welche nicht. So Deleuze (1983); und Ders. (1985), 342. Und vgl. Baecker (2002). 53 Siehe immerhin einige Anregungen bei Weber (1972); Pichler / Ubl (2009); Godart / White (2010). 54 So Shannon / Weaver (1963); und Wiener (1961). 55 Siehe Frith (2007). 83 den Moment zum Ereignis wird und damit auch für den Moment mit sich identisch ist. Nicht das Bild, sondern die kommunizierte Wahrnehmung liefert die unter Umständen stabilen Eigenwerte jener rekursiven Funktionen, in denen Kommunikation und Wahrnehmung auf Bilder Bezug nehmen.56 Eine soziologische Bildanalyse wäre daher eine Konversationsanalyse, die mit Zurechnungen und deren Vermeidung, mit Reden und Schweigen gleichermaßen umgehen kann.57 Stabil, wenn nicht sogar ultrastabil58 ist die kommunizierte Wahrnehmung eines Bildes nicht dank des Bildes, sondern dank jener hochgradig verlässlichen Irritation beider betroffenen Systeme, die auf jede auftretende Struktur mit Lust und Frust zugleich reagiert, mit jouissance im Sinne von Jacques Lacan,59 das heißt mit der Bereitschaft, sich auf eine Anregung einzulassen, dem unmöglichen Verlangen, sich diese Anregung als Eigenleistung zuzurechnen, und mit der Flucht vor dieser Anregung, die auch wieder nur zu determinieren versucht, was nicht zu determinieren ist. Eine Struktur ist immer nur ein Anlass auszuweichen, ein Hinweis auf ein Spiel, das sich in keiner Struktur erschöpft.60 Deswegen ist ein Bildbegriff, der mit den beiden Systemreferenzen der Kommunikation und der Wahrnehmung rechnet, bereits hinreichend komplex. Immerhin sind mit diesen beiden Systemreferenzen von der einfachen über die antike bis zur modernen und zur nächsten Gesellschaft bereits beachtlich differenzierte Strukturen der Kommunikation und jeweils eine Vielzahl von Organismen angesprochen, die je nach Gesellschaft nach Hunderten bis zu Milliarden Exemplaren zählt, die allesamt ihre Wahrnehmung sowohl zuwenden als auch abwenden, sowohl diesem Zeichen als auch jenem Zeichen widmen können. Die symbolische Differenz des Bildes muss diesen Strukturen und dieser Vielzahl Rechnung tragen. Sie kann sich nicht auf eine ikonische Differenz zurückziehen und das Bild Bild sein lassen, gleichgültig, in welchen Zusammenhängen es steht. Nur unter dieser Voraussetzung kann man sich anschauen, wie die symbolische Differenz, die ein bestimmtes 56 57 58 59 60 84 Siehe von Foerster (1993a); Ders. (1993b). Etwa im Sinne von Sacks (1995). Im Sinne des Einbaus von step-functions. Siehe Ashby (1960), 95ff. Siehe Lacan (1972). So im selben Band, Derrida (1972). Bild setzt, auf eine ganz bestimmte Differenzierung der Gesellschaft und eine begrenzte Menge von Betrachtern Bezug nimmt und im Bild den Ausschluss anderer Möglichkeiten mitorganisiert.61 Nur unter dieser Voraussetzung, mit anderen Worten, kann man möglicherweise auch autonome von heteronomen Bildern unterscheiden, Bilder der Kunst von anderen Bildern, indem man sich anschaut, wie ein Bild es schafft, alle symbolische Differenz auf sich selbst zurückzubeziehen und so eine Autonomie zu gewinnen, die mit einem ästhetischen Blick rechnet, der diese Autonomie zu entziffern und zu würdigen versteht. Das autonome oder künstlerische Bild ist so der Spezialfall des allgemeinen Bildes und nicht umgekehrt das künstlerische Bild das Vorbild aller anderen Bilder (dem diese dann nicht genügen, so dass die «Bildwissenschaften» sie vernachlässigen können). Auch das autonome oder künstlerische Bild, so der wichtige Hinweis von Hans-Georg Gadamer,62 ist zunächst einmal «dekorativ». Und dekorativ zu sein, heißt, sich im Rahmen von Kommunikation an die Wahrnehmung zu richten. Der entscheidende Unterschied, den die Kunst dem Bild in dieser Hinsicht hinzufügt, besteht darin, dass diese Adressierung der Wahrnehmung im künstlerischen Bild reflektiert und mitvorgeführt wird.63 Aber auch das muss dekorativ sein, das heißt sich in einem decorum absichern, während es dieses decorum markiert und reflektiert. Trotz unserer Reduktion der Komplexität des Bildes auf die beiden Systemreferenzen der Kommunikation und der Wahrnehmung sowie ihrer Kopplung kann und darf der Begriff des komplexen Bildes jedoch nicht ausschließen, dass weitere Systemreferenzen im Bild mit jenen der Kommunikation und Wahrnehmung in potenzierte Ordnungen der Nichtlinearität integriert werden. Wie groß ist das Herz eines Fourierschen Integrals, das diese Integration beschreibt?64 Wie viele Systemreferenzen lassen sich miteinander in komplexe Figuren falten? Wie, vor allem, berücksichtigen wir mögliche Systemreferenzen organischer, physischer und technischer Art, von denen 61 Siehe hierfür paradigmatische Anregungen bei White / White (1993). 62 Siehe Gadamer (1990), 149ff.; und vgl. zur Lösung des Bildes aus dem Alleinvertretungsanspruch der Kunst ebd., 139ff. 63 Siehe hierzu Baecker (1996); Ders. (2007c). 64 Siehe oben den Verweis auf Wiener (1964). 85 uns unsere Begriffe der Natur, des Universums und der Maschine immer wieder berichten, ohne dass wir andere Evidenzen als jene der Wahrnehmung und Kommunikation hätten, die sie uns bestätigen können? Die magischen, religiösen und psychiatrischen Empfindlichkeiten vergangener Jahrhunderte haben wissenschaftlichen, ästhetischen und ökologischen Empfindlichkeiten Platz gemacht, die in Bildern mit derselben Leidenschaft nach Spuren ihrer Herstellung wie nach Spuren des Dargestellten und nach Spuren der Betrachter suchen. Das Bild wird zum «systemischen Bild»,65 das heißt zu einem Bild, das seine ikonische Differenz derart zur symbolischen Differenz stilisieren muss, dass Anschlussoperationen möglich werden. Die aktuellen Bildwissenschaften sind ebenso beunruhigt wie angeregt durch die Beobachtung, dass diese Anschlussoperationen nicht mehr nur die der tribalen Magie, der antiken Mimesis und der modernen Kritik sind, sondern darüber hinaus die eines Designs, das diese Erfahrungen aufgreift und Bilder zu Instrumenten einer Erforschung von Ökologien macht.66 Das Bild steht nicht mehr still im Bild, sondern wird zu einer Visualisierung, einem imaging, das über prekäre Zustände einer nur momenthaften Integration und damit prinzipiellen Differenz verschiedener Systemreferenzen von der Physis über den Organismus bis zur Kommunikation und Maschine eine Auskunft gibt, die zwar immer noch nicht sagt, aber doch immerhin zeigt, was genauer zu wissen wäre. Damit geht einher, dass die schönen (Tafel-)Bilder der Kunst den Bildbegriff heute nicht mehr dominieren können. Allzu deutlich ist, dass ästhetische Schönheit, die einst dem unruhigen Bewusstsein des immer etwas suspekten Subjekts angeboten wurde, um seine allzu ungebundene Wahrnehmung mit den Kriterien akzeptabler Geschmacksurteile abzustimmen,67 nicht mehr als Paradigma der Anschlusskommunikation von Bildern gelten kann, die mit einer Vielzahl weiterer Netzwerkeffekte aufgeladen sind. Das Training komplexer Bilder an der Schnittstelle zur Transzendenz des Erhabenen und Schönen zahlt sich heute auch dort aus, wo es um Märkte, Nachrichten, Politik, Expertise und Unterhaltung geht.68 Wenn etwas zum Paradigma der Bild65 66 67 68 86 So der Begriff von Hinterwaldner (2010). Siehe dazu auch Baecker (2007a). So Baumgarten (1983); und Kant (1968); vgl. auch Graubner (1977). Die Formulierung ist eine Anspielung auf Park (1967). kommunikation geworden ist, dann nicht die Ästhetik, sondern das Problem, für das diese Ästhetik eine Lösung darstellen sollte: die Differenz individueller Wahrnehmung. Dass diese Differenz kommuniziert werden kann, ist die Leistung und die Paradoxie des Bildes. Sie wird heute überall gebraucht, wo Systeme sich in ihren laufend zu rekonstruierenden Umwelten reproduzieren und Netzwerke sich um strukturell äquivalente Leerstellen bilden.69 Der Begriff des komplexen Bildes, den wir hier entwickelt haben und für den wir uns auf die beiden Systemreferenzen der Kommunikation und der Wahrnehmung gleichsam paradigmatisch beschränkt haben, ist möglicherweise geeignet, das Interesse der «nächsten Gesellschaft»70 am Bild theoretisch zu begleiten. Als Pointe dieser Theorie lässt sich möglicherweise der Satz von Niklas Luhmann aufgreifen, dass reale Realität sich nur auf der Außenseite einer Form bezeichnen lässt, auf deren durch Kommunikation und Wahrnehmung kontrollierten Innenseite sich nichts anderes als eine semiotische Realität befindet.71 Wirklichkeit ist das Komplement der Erfahrung von Sprache, nicht diese Erfahrung selber. Bilder forcieren diesen Befund, indem sie zunächst gegenüber der Sprache auf die Seite der Wirklichkeit zu wechseln scheinen, dann aber doch auf Kommunikation und Wahrnehmung zurückfallen. Dass sich in Bildern die außersprachliche Wirklichkeit auch nicht wiedergeben lässt, gehört vermutlich zu den tiefsten Enttäuschungen einer Menschheit, die immer wieder neu auf ihre magisch, mimetisch oder kritisch geschlossene Welt gestoßen wird. Deswegen kommt es darauf an, auch hier auf die Außenseite der Form zu wechseln und danach zu fragen, auf welchen unmarked space sich jede symbolische Differenz verlassen muss. Diese Frage kann man jedoch nur stellen, wenn man weiß, im Raum welcher Redundanz wir unsere Markierungen bisher vorgenommen haben. Das immerhin kann jede Bildbetrachtung lehren: Kein Bild lässt sich lesen, wenn man vorher nicht andere Bilder gesehen hat. 69 Daraus erklärt sich, dass die Montage und der Schnitt mit Walter Benjamin und Jean-Luc Godard zum Faszinosum einer Theorie bewegter Bilder geworden sind. Siehe zum Begriff der strukturellen Äquivalenz Lorrain / White (1971). 70 Siehe hierzu Baecker (2007a). 71 So Luhmann (1997), 218f. 87 Ideen aus diesem Text sind zunächst auf der Tagung «Bilderflut – Bilderarmut?», an der Universität Luzern, 8.–9. April 2011, vorgetragen worden. Für kritische Hinweise danke ich Cornelia Bohn, Tobias Brücker, Ludwig Jäger und Enno Rudolph. Literatur Ashby, William Ross. Design for a Brain. The Origin of Adaptive Behavior, New York 1960. Baecker, Dirk. «Die Adresse der Kunst». In: Jürgen Fohrmann / Harro Müller (Hg.). Systemtheorie der Literatur, München 1996, S. 82–105. Baecker, Dirk. «Was wissen die Bilder?». In: Wolfgang Ernst u.a. (Hg.). Suchbilder. Visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven, Berlin 2002, S. 149–162. Baecker, Dirk. «Bilderzauber». In: Ders. Studien zur nächsten Gesellschaft, Frankfurt a.M. 2007a, S. 175–190. Baecker, Dirk. «Die Natur der Gesellschaft». In: Ders. Wozu Gesellschaft?, Berlin 2007b, S. 10–28. Baecker, Dirk. «Zu Form und Funktion der Kunst». In: Ders. Wozu Gesellschaft?, Berlin 2007c, S. 315–343. Baecker, Dirk. «Die Texte der Systemtheorie», erscheint in: Matthias Ochs / Jochen Schweitzer-Rothers (Hg.). Handbuch der systemischen Forschung (im Erscheinen). Barthes, Roland. La chambre claire. Note sur la photographie, Paris 1980. Bateson, Gregory / Mary Catherine Bateson. Angels Fear. Towards an Epistemology of the Sacred, Toronto 1988. Bauer, Matthias / Christian Ernst. Diagrammatik. Einführung in ein kulturund medienwissenschaftliches Forschungsfeld, Bielefeld 2010. Baumgarten, Alexander Gottlieb. Theoretische Ästhetik. Die grundlegenden Abschnitte aus der ‹Aesthetica› (1750/58), Hamburg 1983. Belting, Hans. «Die Herausforderung der Bilder. Ein Plädoyer und eine Einführung». In: Ders. (Hg.). Bilderfragen. Die Bildwissenschaften im Aufbruch, München 2007, S. 11–23. 88 Berg, Karen van den / Hans Ulrich Gumbrecht (Hg.). Politik des Zeigens, München 2010. Boehm, Gottfried. «Die Wiederkehr der Bilder». In: Ders. (Hg.). Was ist ein Bild?, München 2007, S. 11–38. Boehm, Gottfried. «Das Zeigen der Bilder». In: Ders. u.a. (Hg.). Zeigen. Die Rhetorik des Sichtbaren, München 2010, S. 19–53. Bogen, Steffen / Felix Thürlemann. «Jenseits der Opposition von Text und Bild. Überlegungen zu einer Theorie des Diagramms und des Diagrammatischen». In: Alexander Patschovsky (Hg.). Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter, Ostfildern 2003, S. 1–22. Boulding, Kenneth E. The Image. Knowledge in Life and Society, Ann Arbor, Michigan 1957. Bourdieu, Pierre. La distinction. Critique sociale du jugement, Paris 1979. Bühler, Karl. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Frankfurt a.M. 1974. Cassirer, Ernst. Philosophie der symbolischen Formen, Bd. 1, Darmstadt 1994. Deleuze, Gilles. Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris 1983. Deleuze, Gilles. Cinéma 2. L’image-temps, Paris 1985. Derrida, Jacques. «Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences». In: Richard Macksey / Eugenio Donato (Hg.). The Languages of Criticism and the Sciences of Man. The Structuralist Controversy, Baltimore (MD) 1972, S. 247–265. Descartes, René. Meditationes de Prima Philosophia. Meditationen über die Erste Philosophie, Stuttgart 1986. Ekman, Paul. Telling Lies. Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage, New York 1985. Frith, Chris. Making Up the Mind. How the Brain Creates Our Mental Worlds, London 2007. Fuchs, Peter / Andreas Göbel (Hg.). Der Mensch – das Medium der Gesellschaft?, Frankfurt a.M. 1994. Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1990. 89 Geimer, Peter. Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen, Hamburg 2010a. Geimer, Peter. Theorien der Fotografie zur Einführung, Hamburg 2010b. Godart, Frédéric C. / Harrison C. White. «Switchings Under Uncertainty. The Coming and Becoming of Meanings». In: Poetics 38 (2010), S. 567–586. Gombrich, Ernst H. «Das Bild und seine Rolle in der Kommunikation». In: Ders. Bild und Auge. Neue Studien zur Psychologie der bildlichen Darstellung, Stuttgart 1984, S. 135–158. Graubner, Hans. «‹Mitteilbarkeit› und ‹Lebensgefühl› in Kants ‹Kritik der Urteilskraft›. Zur kommunikativen Bedeutung des Ästhetischen». In: Friedrich A. Kittler / Horst Turk (Hg.). Urszenen. Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurskritik, Frankfurt a.M. 1977, S. 53–75. Heidegger, Martin. «Die Frage nach der Technik». In: Ders. Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1954, S. 9–40. Heider, Fritz. Ding und Medium, Berlin 2005. Hinterwaldner, Inge. Das systemische Bild. Ikonizität im Rahmen computerbasierter Echtzeitsimulationen, München 2010. Husserl, Edmund. «Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die Phänomenologie». In: Ders. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Husserliana Bd. 3, Den Haag 1950. James, William. «Does ‹Consciousness› Exist?». In: Ders. Essays in Radical Empiricism, New York 1922, S. 1–38. Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft, Bd. 5, Frankfurt a.M. 1968. Koschorke, Albrecht / Cornelia Vismann (Hg.). Widerstände der Systemtheorie. Kulturtheoretische Analysen zum Werk von Niklas Luhmann, Berlin 1999. Krämer, Sybille. «Operative Bildlichkeit. Von der ‹Grammatologie› zu einer ‹Diagrammatologie›? Reflexionen über erkennendes Sehen». In: Martina Heßler / Dieter Mersch (Hg.). Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft, Bielefeld 2009, S. 94–122. Lacan, Jacques. «Of Structure as an Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever». In: Richard Macksey / Eugenio Donato (Hg.). The Languages of Criticism and the Sciences of Man. The Structuralist Controversy, Baltimore (MD) 1972, S. 186–200. 90 Latour, Bruno. «Die Versprechen des Konstruktivismus». In: Jörg Huber (Hg.). Interventionen 12: Person/Schauplatz, Zürich 2003, S. 183–208. Leach, Edmund. Culture and Communication. The Logic by which Symbols are Connected, Cambridge 1976. Leifer, Eric M. «Micromoment Management. Jumping at Chances for Status Gain». In: Soziale Systeme: Zeitschrift für soziologische Theorie 8 (2002), S. 165–177. Lévi-Strauss, Claude. «Einleitung in das Werk von Marcel Mauss». In: Marcel Mauss. Soziologie und Anthropologie, Bd. 1 Frankfurt a.M. 1978, S. 7–41. Lorrain, François / Harrison C. White. «Structural Equivalence of Individuals in Social Networks». In: Journal of Mathematical Sociology 1 (1971), S. 49–80. Lotman, Jurij M. Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der Kultur, Frankfurt a.M. 2010. Luhmann, Niklas. «Sinn als Grundbegriff der Soziologie». In: Jürgen Habermas / Niklas Luhmann. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die Systemforschung?, Frankfurt a.M. 1971, S. 25–100. Luhmann, Niklas. «Talcott Parsons. Zur Zukunft eines Theorieprogramms». In: Zeitschrift für Soziologie 9 (1980), S. 5–17. Luhmann, Niklas. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a.M. 1984. Luhmann, Niklas. «Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt?». In: Hans Ulrich Gumbrecht / Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.). Materialität der Kommunikation, Frankfurt a.M. 1988, S. 884–905. Luhmann, Niklas. «Haltlose Komplexität». In: Ders. Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven, Opladen 1990, S. 59–76. Luhmann, Niklas. «Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität». In: Ders. Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven, Opladen 1990, S. 31–58. Luhmann, Niklas. Wahrnehmung und Kommunikation anhand von Kunstwerken». In: Harm Lux / Philip Ursprung (Hg.). Stillstand switches. Gedankenaustausch zur Gegenwartskunst, Zürich 1992, S. 65–74. 91 Luhmann, Niklas. Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1995. Luhmann, Niklas. Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1997. Maturana, Humberto R. «The Organization of the Living. A Theory of the Living Organization». In: International Journal of Man-Machine Studies 7 (1975), S. 313–332. Maturana, Humberto R. Was ist Erkennen?, München 1994. Mauss, Marcel. «Soziale Morphologie. Über den jahreszeitlichen Wandel der Eskimogesellschaften». In: Ders. Soziologie und Anthropologie, Bd. I, Frankfurt a.M. 1978, S. 183–278. Mead, George Herbert. Mind, Self, and Society from a Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago 1962. Merleau-Ponty, Maurice. L’Œil et l’Esprit, Paris 1964. Molnar, F. / V. Molnar. «Noise, Form, Art». In: Leonardo 22 (1989), S. 15–20. Montaigne, Michel de. Essais. Paris 1962, S. 11–1097. Morin, Edgar. «Complexity». In: International Social Science Journal 26 (1974), S. 555–582. Morris, Charles. Foundations of the Theory of Signs, Chicago 1938. Mühlmann, Heiner. Die Natur der Kulturen. Entwurf einer kulturgenetischen Theorie, Wien 1996. Oehler, Klaus. Charles Sanders Peirce, München 1993. Park, Robert E. «The City. Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment». In: Ders. u.a. The City, Chicago 1967, S. 1–46. Parsons, Talcott. The Social System, New York 1951. Peirce, Charles Sanders. Phänomen und Logik der Zeichen, Frankfurt a.M. 1983. Pichler, Wolfram / Ralph Ubl (Hg.). Topologie. Falten, Knoten, Netze, Stülpungen in Kunst und Theorie, Wien 2009. Sacks, Harvey. Lectures on Conversation, Oxford 1995. Scheibler, Ingeborg. «Bild und Gefäß. Zur ikonographischen und funktionalen Bedeutung attischer Bildfeldamphoren». In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 102 (1987), S. 57–118. 92 Schmidt-Wulffen, Stephan. «Kontexte des Zeigens». In: Karen van den Berg / Hans Ulrich Gumbrecht (Hg.). Politik des Zeigens, München 2010, S. 168–191. Seifert, Martina (Hg.). Komplexe Bilder, Berlin 2008. Shannon, Claude E. / Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication, Urbana (IL) 1963. Simmel, Georg. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Frankfurt a.M. 1992. Spencer-Brown, George. Laws of Form, Leipzig 2008. Stäheli, Urs. Sinnzusammenbrüche. Eine dekonstruktive Lektüre von Niklas Luhmanns Systemtheorie, Weilerswist 2000. Star, Susan Leigh. «The Structure of Ill-Structured Solutions. Boundary Objects and Heterogenous Distributed Problem Solving». In: Les Gasser / Michael N. Huhns (Hg.). Distributed Artificial Intelligence, Bd. 2, London 1989, S. 37–54. Stillwell, John. Mathematics and Its History, New York 2002. Swidler, Ann. «Culture in Action. Symbols and Strategies». In: American Sociological Review 51 (1986), S. 273–288. Tarde, Gabriel. Monadologie et Sociologie, Le Plessis-Robinson 1999. Tisseron, Serge. «Unser Umgang mit Bildern. Ein psychoanalytischer Zugang». In: Hans Belting (Hg.). Bilderfragen. Die Bildwissenschaften im Aufbruch, München 2007, S. 307–315. Von Foerster, Heinz. «Gegenstände. Greifbare Symbole für (Eigen-)Verhalten». In: Ders. Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt a.M. 1993a, S. 103–115. Von Foerster, Heinz. «Epistemologie der Kommunikation». In: Ders. Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt a.M. 1993b, S. 269–281. Weaver, Warren. «Science and Complexity». In: American Scientist 36 (1948), S. 536–544. Weber, Max. Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik, Tübingen 1972. White, Harrison C. / Cynthia A. White. Canvases and Careers. Institutional Change in the French Painting World, Chicago, 1993. 93 White, Leslie A. The Science of Culture. A Study of Man and Civilization, New York 1969. Whiten, Andrew. Natural Theories of Mind. Evolution, Development and Simulation of Everyday Mindreading, Oxford 1991. Wiener, Norbert. Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge (MA) 1961. Wiener, Norbert. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series With Engineering Applications, Cambridge (MA) 1964. Willke, Helmut. Symbolische Systeme. Grundriss einer soziologischen Theorie, Weilerswist 2005. Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt a.M. 1963. 94 Die Evidenz des Bildes. Einige Anmerkungen zu den semiologischen und epistemologischen Voraussetzungen der Bildsemantik Ludwig Jäger I. Vorbemerkung: «Das Bild» – ein «Diskursfetisch»? Die generische Rede von der Evidenz des Bildes, die im Titel meines Textes enthalten ist, wirft natürlich die Frage nach der Legitimität einer solchen essentialistischen Adressierung des Evidenzproblems im Raum des Piktoralen auf. Lassen sich Bilder im Hinblick auf eine allgemeine, gleichsam generische Eigenschaft, ihre genuine semantische Evidenz, in den Blick nehmen?1 Gibt es eine «piktorale Evidenz»2 jenseits der verschiedenen Subgattungen des Bildes? Auch wenn sich mein Versuch einer Annäherung an die Evidenz des Bildes mit seinem generalisierenden Gestus im Diskurs der Bild- und Medienwissenschaften nicht einsam zu fühlen braucht – allenthalben wird die Frage danach gestellt, was das Bild sei und was seine Logik, wird gefragt nach der Wahrheit bzw. dem Realismus im digitalen Bild, wird das Bild erörtert als Spur oder als Palimpsest, wird das Verhältnis von Welt und Bild, von Bildkunst und Wortkunst verhandelt etc.3 Auch wenn also das Bild in einer großen Anzahl von Studien im Zentrum der theoretischen Aufmerksamkeit steht, lässt sich doch kaum abweisen, was Hans Belting festgestellt hat, dass es nämlich ein solches generisches Bild «in der Praxis gar nicht gibt», dass dieser Allgemeinbegriff vielmehr in den bildtheoretischen Debatten der letzten Jahre so etwas wie ein «Diskursfetisch» geworden sei: Belting scheint es deshalb «sinnvoller, das Bild als Allgemeinbegriff erst einmal zu demontieren, 1 2 3 Zum Begriff der Evidenz vgl. Lethen (2006); Jäger (2006); sowie ders. (2008). Vgl. Boehm (2008). Vgl. hierzu etwa Boehm (1995); Ders. (2006); Wyss (2006); Mitchell (2007); Mersmann (2007); Krüger (2007); Ingold (1995); Gadamer (1995). 95 um der Vielfalt einer Bildpraxis gerecht zu werden, die nicht mehr als den ‹Begriff› Bild gemeinsam hat».4 Auch wenn ich nun mit Belting durchaus darin übereinstimme, dass der Bildbegriff in seiner undifferenzierten Allgemeinheit dazu tendiert, zu einem Diskursfetisch zu werden, geht es mir im Folgenden doch nicht darum, an seiner Stelle die «Vielfalt der Bildpraxis» in den Blick zu nehmen (was ich als Sprachzeichen- und Medientheoretiker auch gar nicht angemessen könnte). Ich werde vielmehr die Frage nach der Evidenz des Bildes, trotz der Beltingschen Einrede, weiterhin – wobei ich mich hierin etwa durch Gottfried Boehm legitimiert finde – als eine allgemeine theoretische Frage stellen, dabei freilich gleichwohl ihre Reichweite dadurch einschränken, dass ich sie an einem exemplarischen Fall diskutiere, am Fall nämlich der analogen Fotografie, von dem ich glaube, dass er einige verallgemeinerbare Problemfelder berührt. In der Tat ist der Fall der Fotografie in verschiedener Hinsicht para­dig­ matisch,5 vor allem im Hinblick auf die Dimensionen des fotografischen Bildes, die sich aus seiner indexikalischen und ikonischen Natur ergeben. Beide Eigenschaften werfen zunächst die grundlegende Frage auf, ob es sich bei Bildern um Zeichen handelt, ob also das Fotografische aus der Perspektive des Semiologischen verstanden werden muss, oder ob die Bildtheorie, wie dies Gottfried Boehm anregt, «vom verlockenden Angebot der Zeichentheorie» besser «keinen Gebrauch» machen sollte.6 Ich werde im Folgenden die These vertreten, dass die Bildtheorie das verlockende Angebot der Zeichentheorie gar nicht ausschlagen kann, weil es vor allem die Zeichentheorie, etwa die Peircesche Idee der Semiose, erlaubt, die spezifische Indexikalität sowie die Ikonizität der Fotografie, und damit ihre genuine semantische Evidenz, theoretisch angemessen zu entfalten – ja weil es insgesamt schwierig sein dürfte, auf irgend­eine Gattung von Bild und die für sie charakteristischen Evidenztypen Bezug zu nehmen, ohne einen im weitesten Sinne semiologischen Theorierahmen. Die Eigenschaften der Indexikalität und der Ikonizität analogischer Bilder führen in der Tat zu Fragen von allgemeinerer Reichweite hinsichtlich der Evidenz des Bildes. So ist es etwa die spezifische Indexikalität der analogen 4 5 6 96 Belting (2007), 11. Vgl. Wolf (2002). Vgl. Boehm (2010), 21. Fotografie, aus der wir, wie Joel Snyder formulierte, «unseren unerschütterlichen Glauben an die privilegierte Beziehung zwischen Bild und abgebildetem Gegenstand»7 ableiten. Zugleich bestimmt die Indexikalität in epistemologischer Hinsicht auch die eigentümliche Qualität, die der ikonischen Referenz des Bildes zugeschrieben wird und die für jenes «besondere Verhältnis von Bild und Welt»8 verantwortlich sein soll, das der analogen Fotografie unerschütterlich, freilich irrigerweise, noch immer angemutet wird. Dass wir es hier mit einem grundlegenden Problem der Bildtheorie zu tun haben, lässt sich auch daran ablesen, dass das Verhältnis analoger und digitaler Bilder im Horizont der Frage des Bild-Welt-Verhältnisses und der spezifischen Differenz verhandelt wird, die hier für die beiden Bildgattungen bestimmend sein soll: So ist es eine im kulturwissenschaftlichen Bilddiskurs häufig vertretene Annahme, dass die Evolution digitaler Bilder zu einem «Zusammenbruch der indexikalischen Beziehung zwischen dem Foto und seinem Referenten»9 geführt habe. Die Hypothese, dass das Verhältnis «zwischen der fotochemischen Fotografie und den neuen elektronischen Bildtechnologien» gerade im Hinblick auf die privilegierte Beziehung zwischen Bild und Welt einen «radikalen Bruch» darstelle,10 weil in diesem neuen, wie Lunenfeld es nennt, dubitativen Verhältnis von Bild und Referent das «Realismus-Zertifikat»11 der älteren Fotografie außer Kraft gesetzt werde, dass also im neuen digitalen «Zeitalter des Dubitativen»12 der alte Anspruch fotografischer Bilder, die Welt getreu, natürlich und genau wiederzugeben, von der Digitalisierung unterhöhlt worden sei, wirft die generelle epistemologische Frage auf, in welcher Form das Problem der Relation von Zeichensystemen auf ihre Referenzobjekte gedacht werden kann. Ich werde mit Blick auf diesen von Mitchell so genannten «Mythos», die digitale Fotografie habe eine Ontologie, die von der auf Chemie basierenden abweicht,13 zu zeigen versuchen, dass bereits auf 7 8 9 10 11 12 13 Vgl. Snyder (2002), 29. Ebd., 27. Vgl. Lunenfeld (2002), 169. Ebd., 163. Mitchell (2007), 237. Lunenfeld (2002), 171. Mitchell (2007), 241. 97 die analoge Fotografie zutrifft, was Snyder allgemein als epistemologische Maxime für die Medialität des Bildlichen formuliert: «Es gibt keinen Weg, auf dem wir die Sprache oder die Abbildung umgehen und zum Wirklichen vorstoßen könnten, zu den ungeformten Materiespuren, die hinter den Dingen oder unserer Erfahrung stünden».14 Was auch immer die Evidenz des (fotografischen) Bildes sein mag, sie verdankt sich keiner besonderen epistemologischen Nähe des Bildes zur Realität, insbesondere keiner, die kategorial verschieden wäre von der semiologischer Systeme – oder, wenn man so will – symbolischer Formen überhaupt: «sie alle verhalten sich nicht wie ein bloßer Spiegel, der die Bilder eines Gegebenen des äußeren oder inneren Seins, so wie sie sich in ihm erzeugen, einfach zurückwirft, sondern sie sind statt solcher indifferenter Medien vielmehr die eigentlichen Lichtquellen, die Bedingungen des Sehens wie die Ursprünge der Gestaltung».15 II. Die Logik des Bildes und der Horizont des Semiologischen Für den Bildbegriff, wie er im Kontext der jüngeren kulturwissenschaftlichen Theoriediskurse der Kunst- und Bildwissenschaften entwickelt und etabliert worden ist, ist es weithin charakteristisch, dass das Ikonische als eine mediale Domäne verstanden wird, aus der alle Momente des Sprachlichen, ja des Zeichenhaften überhaupt, kategorisch exkludiert sind. Vor dem Hintergrund der neuen theoretischen Zentralopposition von Sagen und Zeigen,16 wird das Deiktisch-Ikonische als ein mediales Regime verstanden, das unabhängig vom Raum des Semiologisch-Sprachlichen operiert. Insgesamt wird der kulturwissenschaftliche Bilddiskurs weithin von der Überzeugung getragen, dass für die Art der Bedeutung, die in den Medien der Sichtbarkeit generiert wird, eine genuine ikonische Evidenz angenommen werden muss, die von den Formen semantischer Evidenz in den Medien des Sagbaren in einer prinzipiellen Weise unabhängig – ja im Verhältnis zu dieser geradezu epistemologisch grundlegend ist. Dieser ikonischen Evidenz werden dabei Merkmale 14 Snyder (2002), 59. 15 Vgl. Cassirer (1964), 27. 16 Vgl. hierzu etwa Krämer (2003). 98 zugeschrieben, durch die sie nicht nur dem Universum des Semiologischen entzogen, sondern zugleich mit einer Mächtigkeit ausgestattet wird, vor deren Strahlkraft alle anderen Typen semantischer Evidenz verblassen müssen. Bildliche Medien – so wird angenommen – verfügen mit der ikonischen Evidenz über eine Evidenz sui generis, die gegenüber den allgemeinen Verfahren der kulturellen Semiosis autonom ist.17 Wie weit sich diese Überzeugung verbreitet hat, zeigt sich auch in der jüngeren schriftbildlichen Wende der Schrifttheorie,18 die sich sogar hinsichtlich des Mediums der Schrift das Postulat zu eigen gemacht hat, dass diese, wenn man sie unter der Perspektive ihres bildlichen Charakters in den Blick nimmt, zu verstehen sei «als ein Medium sui generis, das systematisch weder von der Sprache noch von sonst einer semiologischen Ordnung abhängig» sei.19 Es wird mir also im Verlauf meines Textes bei der Erörterung dessen, was ich die semantische Evidenz des Bildes genannt habe, nicht unwesentlich um die Frage gehen, ob es sich bei der insbesondere in den Kunst- und Bildwissenschaften für Bilder in Anspruch genommenen ikonischen Evidenz, (insbesondere, wenn diese indexikalisch fundiert ist), tatsächlich um eine Evidenz sui generis derart handelt, dass sie als von jeder Art sprachlich-semiologischer Imprägnierung frei anzusehen sei. Wenn dem so wäre, müsste man sie im Hinblick auf ihre spezifische Geltung außerhalb jenes medialen Raumes ansiedeln, in dem die nicht-piktoralen Medien operieren. Im Reich der Medien des Sichtbaren würden prinzipiell andere Gesetze gelten, als in dem des Sagbaren.20 Insbesondere unterläge die ikonische Evidenz keiner Logik des Medialen, keiner Konstitutionslogik, in deren Raum auch das Unmittelbare als Ergebnis von medialen Vermittlungsleistungen gedacht werden müsste. Sie wäre kein Ergebnis transkriptiver Verfahren,21 durch die Medien rekursiv auf sich selbst und auf andere Medien Bezug nehmen und im Zuge dieser Prozesse kulturellen Sinn fortschreiben bzw. rekonzeptualisieren. Die piktorale Evidenz läge – gleichsam als paradigmatische Form des Evidenti17 18 19 20 21 Vgl. etwa Boehm (1995a), 330. Vgl. Krämer (2005); ebenso Grube / Kogge (2005). Grube / Kogge (2005), 16. Vgl. zu dieser Opposition Voßkamp / Weingart (2005). Vgl. etwa Jäger (2004b); Ders. (2009). 99 ellen – solchen Prozeduren immer schon voraus. Die semantische Evidenz bildlicher Medien wäre durch eine kategorial andere Logik bestimmt, als die der nicht-bildlichen semiologischen Medien. Die Frage, die also im Zuge meines Versuches, mich dem Problem der Evidenz des Bildes anzunähern, diskutiert werden soll, ist die, ob der für die ikonische Evidenz von den Bildwissenschaften erhobene epistemologische «sui generis»-Anspruch gerechtfertigt ist oder ob nicht auch für die Bildmedien eine allgemeine Logik des Medialen gilt, aus der sich konstitutiv wirksame Momente des Sprachlichen und des Zeichenhaften nicht ausschließen lassen. Ich werde für die letztere Annahme argumentieren und dem IkonischIndexikalischen eine allen Zeichenprozessen vorausliegende epistemologische Begründungsfunktion absprechen. Dies heißt im Übrigen noch keineswegs, dass es «sui generis»-Eigenschaften bildlicher Medien nicht gibt, sondern nur, dass diese im allgemeinen Rahmen des Semiologischen zu bestimmen wären. Auch wenn man also Gottfried Boehms These, dass Bilder im Hinblick auf ihre spezifische Medialität «einen eigenen epistemischen Raum»22 umzirkeln, durchaus zustimmen kann, handelt es sich – wie ich glaube – bei diesem epistemischen Raum des Bildlichen doch nicht um einen solchen, der außerhalb der Ordnung des Zeichenhaften situiert wäre. Meine These lautet deshalb: auch Bildprozesse sind Zeichenprozesse, auch die ikonische Evidenz ist eine semiologische Evidenz. Die Medien des Sichtbaren sind ebenso wie die des Sagbaren einer allgemeinen (transkriptiven) Logik des Medialen unterworfen, der sich auch das «epistemisch aufgewertete Bild»23 nicht entziehen kann. Bevor nun die Ausfaltung dieser These näher ins Auge gefasst werden soll, scheint es angebracht, sich die zentralen theoretischen Überzeugungen der «sui generis»-Annahme des bildtheoretischen Diskurses noch einmal pointiert vor Augen zu führen. Es sind, wie mir scheint, die folgenden: (1) Die erste Überzeugung ist – wie bereits angedeutet – die Annahme, dass Bilder «Evidenzen eines eigenen Typs»24 zu begründen vermögen, dass sie über einen genuin ikonischen Sinn verfügen.25 Sie gewinnen – so Gott22 23 24 25 Boehm (2007), 79. Krämer (2005), 24. Boehm (2007a), 30. Belting (2007), 20, der sich hier auf Gottfried Boehm bezieht. 100 fried Boehm – ihre Evidenzen «aus der Erfüllung eigener Vorgaben».26 Bilder haben, wie man auch sagen könnte, eine eigene Art und Weise, Bedeutung hervorzubringen. Sie sind in ihren Bedeutungshervorbringungen geprägt durch eine «eigentümliche Leistung des bildlichen Sinnes»,27 wobei sie insbesondere «von Sprache unabhängig»28 sind. Es ist eine «eigene Wirkmacht und Wirkkraft»,29 die die Bilder entfalten. Man könnte diese Hypothese deshalb die Hypothese vom Eigensinn des Bildlichen nennen. (2) Die zweite Annahme hängt mit der ersten unmittelbar zusammen: die wesentliche Eigenschaft des bildlichen Eigensinns besteht darin, dass Bilder ihre Bedeutung nicht über ein konventionelles semiotisches Bezugsverhältnis zur Welt erlangen. Sie sind «keine bloßen Zeichen»30 dessen, was sie zum Ausdruck bringen. Vielmehr sind sie durch eine «Nicht-Koinzidenz zwischen der realen Welt und der Welt der Repräsentation»31 bestimmt. Die Bildtheorie scheint hierin der Feststellung des Neurologen Wolf Singer zu folgen, der bereits für die Wahrnehmung konstatiert: «Unsere Wahrnehmungen sind keine isomorphen Abbildungen einer wie auch immer gearteten Wirklichkeit. Sie sind vielmehr das Ergebnis hochkomplexer Konstruktionen und Interpretationsprozesse, die sich stark auf gespeichertes Wissen stützen».32 Diese zweite Hypothese ließe sich also als die Hypothese von der Nicht-Zeichenhaftigkeit der Bilder bezeichnen. (3) Dass Bilder ihre Bedeutung nicht über ein konventionell-semio­ tisches Verhältnis zur Realität erhalten, dass sie über eine eigene Weise der «Sinnstiftung»33 verfügen, hat die dritte Annahme zur Folge: Bilder sind nicht restlos in andere Medien übersetzbar. «Die Idee einer restlosen Übersetzbar26 27 28 29 30 31 32 Boehm (2008), 32. Boehm (2010), 21. Belting (2007), 20; ebenso Boehm (2007a), 30. Vgl. Waldenfels (2008), 46. Belting (2007), 14, der hier Laurent Lavaud zitiert. Ebd. Wolf Singer, hier zitiert nach Schürmann (2008), 35, Anm. 21; freilich besteht eine bildtheoretische Annahme gerade darin, zwischen dem Visuellen und dem Bildlichen so zu bestimmen, dass erst dem Bildlichen konstitutionelle Leistungen zugeschrieben werden, während das Visuelle einhüllt, «ohne dass wir es selbst erzeugen» (Belting (2007), 19). 33 Boehm (2007a), 29. 101 keit des Bildes in Sprache»34 etwa, muss deshalb – so Gottfried Boehm – verworfen werden. Das Bildliche lässt sich nicht auch nicht-bildlich sagen. Eben hierin bleibt der Eigensinn «Eigensinn». Die Evidenz des Bildes ist eine andere, als die der Medien, in die Übersetzungsversuche stattfänden – also etwa in Sprache. Die dritte Hypothese ist also die Hypothese der NichtÜbersetzbarkeit. (4) Aus allen diesen Postulaten folgt nun die vierte Annahme, die eine weitere Zentralannahme des «sui generis»-Diskurses der Bildtheorie darstellt: Das Bild wird als eigensinniges, unübersetzbares Medium nicht mehr als dem Logos subordiniert angesehen. Dies hatten im Horizont des europäischen Logo- / Phonozentrismus35 Denker wie Lessing, Hegel und Humboldt36 postuliert und damit nicht nur die Sprachphilosophie des 19. Jahrhunderts, sondern auch die des sogenannten linguistic turn37 geprägt. Für Hegel etwa ist die Intelligenz, sofern sie zum Ausdruck ihrer Vorstellungen noch Bilder verwendet, nicht wirklich frei. Sie ist dann – wie Hegel formuliert – «mit dem Inhalte der Anschauung» noch nicht fertig geworden.38 Erst durch die Tilgung des Bildlichen befreit sich die zeichenmachende Phantasie von der Aufdringlichkeit des Piktoralen und erreicht das ihr gemäße Niveau der «bildlosen Allgemeinheit».39 Diese Herabsetzung des Ikonischen gegenüber dem Logos erfährt nun im neueren Bilddiskurs eine grundsätzliche Kehre, die «Wende zum Bild».40 Das Ikonische tritt – wie Gottfried Boehm formuliert – aus dem Schatten des Logos heraus: Wir haben es beim Bild «mit einer eigenen Darstellung von Sein zu tun analog zum Logos, die aber im 34 Boehm (1978), 447f. 35 Dass freilich die etwa bei Derrida vorfindliche Engführung von Logozentrismus und Phonozentrismus inakzeptabel ist, habe ich an anderer Stelle gezeigt. Vgl. Jäger (2005), insbesondere Abschnitt 3, 193ff. 36 Vgl. hierzu etwa Jäger (2004a), 48ff. 37 Rorty (1992). 38 Vgl. Hegel (1970), 269. 39 Hegel (1986), 277. Freilich bleibt für Hegel das «dichterische Vorstellen» nicht bei der «bildlosen Allgemeinheit» des Denkens stehen: ihm wir durchaus eingeräumt, «bildlich» zu sein (vgl. ebd., 276ff.). 40 Vgl. Boehm (2007a), 29; zum Iconic bzw. Pictorial Turn insgesamt den Briefwechsel zwischen Gottfried Boehm und Tom Mitchell in Belting (2007), 27–46. 102 Unterschied zum «ist»-Sagen der Sprache, selbst nicht sprachförmig organisiert ist».41 Das Bildliche ist nicht mehr das dem Logos-Artigen Untergeordnete. Es wird seinerseits nonverbaler, ikonischer Logos.42 Es löst sich aus dem Horizont des sprachlichen Logos gänzlich heraus und begründet eine eigene Form der Sinnbildung. Die vierte Hypothese ist also die der NichtSubordination des Ikon unter den Logos. So nachvollziehbar nun die Einreden des Bilddiskurses gegen die Postulierung einer epistemologischen Nachrangigkeit des Ikonischen gegenüber dem Logos und so überzeugend die Bestimmungen des «sui generis»-Charakters des Bildlichen auch sind, sie rechtfertigen an keiner Stelle den Schluss, dass das Bildliche jenseits des Horizontes des Semiologischen zu situieren sei. Auch wenn man davon ausgeht, dass der sprachliche Logos einem ikonischen Logos nicht übergeordnet werden darf, heißt das noch nicht, dass nicht beide ihre Operationen in einem semiologischen Horizont entfalteten. So sehr ich auch mit den skizzierten theoretischen Postulaten des «sui generis»-Diskurses der Bildtheorie übereinstimme, insbesondere auch mit der These Gottfried Boehms, dass Bilder über eine ihnen eigentümliche, nur an «ihnen selbst abzulesende Weise, Sinn zu erzeugen» 43 verfügten, so wenig kann der in den vier Annahmen mitgeführten Prämisse zugestimmt werden, dass das Heraustreten des Bildlichen aus dem «Schatten des Logos», d.h. die Emanzipation des Ikonischen von der Subordination unter den Logos, notwendigerweise zur Folge habe, dass dieser neue «ikonische Logos» außerhalb des Horizontes einer semiologischen Vernunft anzusiedeln wäre. Es ist für alle Medien bzw. symbolische Formen, für alle Zeichenformen im Horizont des Semiologischen insgesamt charakteristisch, dass sie auf eine je eigentümliche Weise, die durch ihre jeweiligen ästhetisch-aisthetischen Bedingungen bestimmt ist, an der Erzeugung kulturellen Sinns beteiligt sind. Sie sind insofern, wie man mit Goodman sagen könnte, generell spezifische «Weisen der Welterzeugung».44 Es ist nur schwer nachvollziehbar, warum Belting zustimmend auf Lavauds Bemerkung Bezug nimmt, Bilder stellten «eine privilegierte Art» dar, «um 41 42 43 44 Boehm (1978), 451. Vgl. Boehm (2007a), 29. Vgl. Boehm (2006), 250. Goodman (1990). 103 uns von der Nicht-Koinzidenz zwischen der realen Welt und der Welt der Repräsentationen zu überzeugen».45 Die «sui generis»-Hypothesen, die der Bilddiskurs für die Bilder in Anspruch nimmt, gelten für den Raum des Medialen insgesamt. Ihre sinngenerative Funktion sollte also als eine zentrale Eigenschaft von Medien insgesamt angesehen werden, und zwar zunächst unabhängig davon, ob sie als Medien der Sichtbarkeit, der Sagbarkeit oder als hybride Medien operieren: Medien – ich verstehe darunter durch je verschiedene dispositive Ordnungen46 bestimmte semiologische Verfahren – sind generell durch den Umstand charakterisiert, dass sie an der Hervorbringung des Sinns, der Bedeutung, bzw. der Information konstitutiv beteiligt sind, die sie übertragen, speichern, distribuieren oder zum Ausdruck bringen. Dieser Umstand ist es auch, der mich dazu anregt, davon zu sprechen, dass Medien «Eigensinn»47 erzeugen – und zwar einen Eigensinn, der in seinem je eigentümlichen Charakter wesentlich bestimmt wird durch die spezifische Medialität des jeweiligen Mediums, d.h. sowohl durch seine ästhetisch-aisthetische, als auch durch seine dispositive Form. Die Hervorbringung der jeweiligen autochthonen Semantiken erfolgt dabei nicht primär durch einen Bezug auf medientranszendente Quellen, d.h. etwa durch einen Bezug auf prämediale Realitäten oder Referenzobjekte etc. bzw. Sprachen des Geistes, Begriffe oder Ideen etc., und auch nicht durch eine präsemiotische, medial unvermittelte Enthüllung von Gegenständen, wie dies Barthes für die analoge Fotografie postuliert, sondern vielmehr prioritär durch intramediale rekursive Selbstbezugnahmen oder durch intermediale Bezugnahmen auf andere Medien, kurz durch transkriptive Verfahren. Die These lautet also: alle Medien, sowohl sprachliche als auch bildliche, haben prinzipiell nicht primär eine Abbildungs45 Belting (2007), 14. 46 Unter einer dispositiven Ordnung verstehe ich im Anschluss an Foucault Netzwerke von an sich heterogenen Elementen wie Diskursen, Institutionen, architekturalen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, moralischen Lehrsätzen etc., die die strategische Funktion haben, in historisch unterschiedlichen Konstellationen jeweils auf vorliegende gesellschaftliche «Notstände» zu reagieren und diese zu beheben. Vgl. Foucault (1978), 120ff.; vgl. zum Dispositionsbegriff Foucaults den vorzüglichen Artikel von Hubig (2000). 47 Vgl. hierzu Jäger (2005a). 104 oder Repräsentationsfunktion: sie sind zunächst inferentiell (selbstbezüglich), ehe sie referentiell sind; sie sind zunächst transkriptiv, ehe sie denotativ sind, sie sind – wie man mit Peirce formulieren könnte – zunächst Symbole, ehe sie Indices und Ikone zu sein vermögen.48 Auch wenn also Medien im Zuge ihrer aisthetisch-ästhetischen Eigensinnigkeit verschiedene Formen semantischer Evidenz hervorbringen, und Bilder ihre Bedeutung sicher anders vermitteln, als dies etwa sprachliche Zeichen tun, kann doch für die Medien des Sichtbaren keine epistemologische Privilegierung derart angenommen werden, dass die bildliche Semantik asemiologisch operiert. Alle Formen semantischer Evidenz, und natürlich auch die «ikonische Evidenz» bildlicher Medien,49 sind im weitesten Sinne Ergebnisse von Verfahren, die sich zwar aisthetisch-ästhetisch, aber nicht epistemologisch unterscheiden. Ich möchte nun diese These am Beispiel einer theoretischen Position diskutieren, die in einer sehr exponierten Weise das Postulat der «Mächtigkeit» der bildlichen Evidenz und der Nicht-Zeichenhaftigkeit des fotografischen Bildes vertreten hat, an Roland Barthes’ Theorie der fotografischen Evidenz.50 An diesem Fall lassen sich – wie mir scheint – einige Fragen exemplarisch in den Blick nehmen, die für unseren Problemzusammenhang zentral sind: (1) die Frage, ob es sich bei (in diesem Falle analogen) Fotografien um Bildzeichen handelt oder um «Bilder ohne Code»,51 also nicht um Zeichen; (2) die Frage, ob die Weise, in der fotografische Bilder auf Gegenstände einer prämedialen Welt unvermittelt referieren52 durch eine – wie Barthes annimmt – «unerhörte Verschränkung von Wirklichkeit und Wahrheit»53 charakterisiert ist und schließlich die Frage, ob wir es (3) bei der semantischen Evidenz der fotografischen Bilder mit einer mächtigen Evidenz derart zu tun haben, dass sie sich unabhängig von allen Leistungen einer umfassenderen Semiose einstellt. Insbesondere diese letzte Frage führt in das Zentrum des Problems, das 48 Vielleicht sollte man genauer sagen, sie können nicht Indices und Ikonen sein, ohne zugleich auch Symbole zu sein. 49 Boehm (2008), 17, 23ff. 50 Vgl. Barthes (1989), 118. 51 Ebd., 99. 52 Ebd., 90. 53 Ebd., 124. 105 hier verhandelt werden soll: ihre Beantwortung entscheidet nämlich darüber, ob die fotografische Evidenz als Resultat einer allgemeinen (transkriptiven) Logik des Medialen angesehen werden muss oder ob sie allen medialen Vermittlungszusammenhängen vorausgeht und als solche – wie Barthes formuliert – «unanfechtbar gewiss»54 ist. Gerade weil Barthes die fotografische Evidenz darauf zurückführt, dass das Bild den Gegenstand selbst gleichsam prämedial «enthüllt»,55 stellt sich die Frage umso schärfer, ob wir es bei dem fotografischen Bild mit einem Medium zu tun haben, dessen semantische Evidenz seine Beglaubigung unmittelbar aus transsemiologischen Quellen und nicht aus dem transkriptiven Spiel intra- und intermedialer Bezugnahmen bezieht. Die Beantwortung dieser Frage entscheidet auch darüber, ob es sich bei der Hypothese, die Differenz zwischen analogen zu digitalen Bildern markierte eine Differenz der Ontologien, einen epistemologischen Bruch, um eine zutreffende Diagnose oder, wie Mitchell feststellt, um einen der «hartnäckigsten Gemeinplätze hinsichtlich des Wesens der digitalen Fotografie»56 handelt. III. Ikonische Evidenz und (sprachliche) Semiose Bevor ich mich nun Barthes’ Fotografie-Theorie sowie den Problemen näher zuwenden werde, die sich aus ihr für den theoretischen Status der bildlichen Evidenz ergeben, möchte ich einige Vorüberlegungen zu der Frage des Verhältnisses von bildlichen und sprachlichen Medien, von Sichtbarem und Sagbarem anstellen, um auf diese Weise gleichsam das Terrain für den Dialog mit Barthes vorzubereiten. Meine Überlegungen beziehen sich dabei insbesondere auf die pointierte Kritik sprach- und zeichentheoretischer Konzepte, die im Diskurs der Kunst- und Bildwissenschaften häufig mit der theoretischen Entfaltung des Bildbegriffs verbunden ist. Meine Anmerkungen sollen deutlich machen, warum es sinnvoll sein könnte, sprach- und zeichentheoretische Theorieelemente in die Diskussion mit einzubeziehen, die als Rahmentheo54 Ebd., 117. 55 Ebd., 18. 56 Mitchell (2007), 237. 106 rie für die Beschreibung der Operationsweisen bildlicher und sprachlicher Medien nutzbar sein könnten. Dass weite Teile der kulturwissenschaftlichen Bildtheorie dem Ikonischen eine gegenüber dem Sprachlichen und Semiologischen allgemein prioritäre Rolle zuweisen, hat nicht unwesentlich mit einer These zu tun, die Roland Barthes in seiner Theorie der Fotografie hinsichtlich des Verhältnisses von bildlicher und sprachlicher Evidenz formuliert hat: «Im Bild» – so Barthes – «gibt sich der Gegenstand als ganzer zu erkennen, und sein Anblick ist gewiss – im Gegensatz zum Text oder zu anderen Wahrnehmungsformen, die mir das Objekt in undeutlicher, anfechtbarer Weise darbieten (…)»57 – oder wie es an anderer Stelle heißt: «Nichts Geschriebenes kann mir diese Gewissheit geben. Darin liegt das Übel (…) der Sprache: dass sie für sich selbst nicht bürgen kann».58 Auch wenn Barthes diese Sätze mit Blick auf die Fotografie geschrieben hat, machen sie doch sichtbar, vor welchem Hintergrund sich die in den Kultur- und Medienwissenschaften beobachtbare bildtheoretische Skepsis gegenüber den sprachlich-semiologischen Formen der Evidenz ausgebildet hat. Insgesamt ist in die Entfaltung des Bild-Diskurses gleichsam konstitutiv eine pointierte Kritik sprach- und zeichentheoretischer Konzepte eingeschrieben, die insbesondere von der Überzeugung getragen wird, dass das Bildliche / Ikonische über ein Veranschaulichungsvermögen, eine aisthetische Mächtigkeit und eine authentifizierende Kraft verfüge, über die sprachliche und andere nicht ikonische Zeichenmedien nicht verfügten. Erst von hier aus wird im Übrigen verständlich, warum angesichts der sogenannten «digitalen Revolution» von einem «Entschwinden der Bilder»59 bei gleichzeitiger «Bilderflut»60 bzw. von einem «Verlust der Referenz»61 und davon die Rede ist, dass dem Bewusstsein der Postmoderne tendenziell die Differenz zwischen Bild und Realität selbst zu entschwinden droht.62 57 58 59 60 61 62 Barthes (1989), 117. Ebd., 96. Belting (2007), 15. Boehm (1995), 35. Belting (2001), 216. Vgl. Boehm (1995), 35. 107 Natürlich waren es nicht zuletzt die versuchten «linguistischen ‹Kolonialisierungen› des Bildes»,63 die mit einem gewissen Recht die disziplinären Dis­tanz­ im­pulse des bildwissenschaftlichen Diskurses zur Sprach- und Zeichentheorie ausgelöst haben. So kann etwa kein Zweifel daran bestehen, dass es wenig Sinn macht, «bildliches Verstehen» – wie dies etwa Elliot Sober vorgeschlagen hat – als die Kompetenz zu bestimmen, «Bilder in Sätze umzuformen».64 Man kann hier Danto nur beipflichten, der feststellt: «Es mag richtig sein, dass Personen, die Bilder verstehen, fähig sind, in Worte zu fassen, was ein Bild zeigt. Aber ich bin skeptisch ob das bildliche Verstehen darin besteht».65 Auch wenn eine Bildbeschreibung in einem gewissen Sinne die Übersetzung eines Bildinhaltes in Sprache sein mag, formuliert sie doch in keinem Fall die genuine Semantik des Bildes, d.h. dessen bildliche Evidenz, die von seiner Medialität nicht zu trennen ist. Insbesondere ist das bildliche Verstehen nicht einfach eine Form des sprachlichen Verstehens. Gottfried Boehm hat mit einigem Recht darauf hingewiesen, dass das sinnliche Urteil des Auges, das der Bildwahrnehmung zugrundeliegt, als iudicium oculi «nicht unbedingt sprachlich verlautbart werden muss, um seiner Rolle zu genügen».66 Es scheint mir also völlig unstrittig zu sein, dass es – wie bereits Gadamer formuliert hat – eine genuine «Seinsvalenz des Bildes» gibt,67 oder, dass es – wie Scholz im Anschluss an Cassirer formuliert – einen «eigenen Ort symbolischer Prägnanz»68 des Bildes gebe. Auch Gernot Böhme nennt in seiner «Theorie des Bildes» die «Welt der Bilder» zu Recht einen selbständigen «Bereich des Seienden».69 Medien generieren aufgrund ihrer je spezifischen Medialität Eigensinn und damit einen jeweils genuinen Typus semantischer Evidenz, der sich nicht verlustfrei in andere mediale Formen der Evidenz übertragen lässt.70 Gleichwohl gibt es – wie ich 63 64 65 66 67 68 69 70 Voßkamp / Weingart (2005), 9; vgl. auch Scholz (2002), 109f. Vgl. Sober (1976). Vgl. Danto (1995). Boehm (2008), 16. Vgl. Gadamer (1965), 128ff., 144. Scholz (2002), 112. Böhme (2004), 47. Die Idee der Übersetzung an die der verlustfreien Übertragung von Inhalten aus einem medialen / semiologischen System in ein anderes zu binden, hieße freilich generell, sie ad absurdum zu führen. 108 glaube – keine sinngenerierenden Leistungen von Medien und Zeichensystemen, die sich außerhalb dessen vollzögen, was Peirce «Semiosis» genannt hat. Wie das Sagbare operiert auch das Sichtbare im Universum der Zeichenhaftigkeit – und zwar selbst dann, wenn man – wie Bredekamp und Krämer formulieren – darin erfolgreich wäre, die «epistemische Rang- und Bedeutungshierarchie zwischen Sprache und Bild» zugunsten des Bildes zu verschieben.71 Auch Bilder sind ebenso wie ikonisch-diskursive Hybridformen, sofern sie als mediale Gestalten verstanden und sofern ihnen sinngenerative Leistungen zugesprochen werden, in einer wesentlichen Hinsicht Zeichen.72 Ihre semantische Evidenz verdankt sich grundsätzlich semiologischen Verfahren, nämlich einmal intramedialen Bezugnahmen auf andere Bilder in den historischen und rezenten Bild-Universen der Kulturen und zum andern intermedialen Bezugnahmen auf andere Medien, unter denen Sprache – wie sich bei der Erörterung der Bartheschen Fotografietheorie noch zeigen wird – sicher keine periphere Rolle spielt. Kein Medium kann wirklich – wie dies Barthes für fotografische Bilder postuliert – für sich selber bürgen ohne die Inanspruchnahme von Leistungen, die andere Medien im Rahmen einer umfassenderen Semiose erbringen. Es ist das intramediale und intermediale Zusammenspiel der Medien, dem sich die kulturelle Semantik verdankt: Es ist kein Medium denkbar, das – wie Bolter und Grusin formulieren, «seinen eigenen, abgeschotteten und gereinigten semantischen Raum kultureller Bedeutung» einzurichten vermöchte. Alle Medien hängen von anderen Medien in Zyklen der Remediation ab.73 Der Raum des Bildlichen ist kein Fluchtort vor den Anmutungen des Sprachlichen und des Semiologischen. Die im bildtheoretischen Diskurs immer wieder vertretene These, dass – so etwa Gernot Böhme – Bilder «im Unterschied zu den Worten keine Zeichen»74 seien, oder dass – wie Belting im Anschluß an Lavaud formuliert – «Bilder keine bloßen 71 Vgl. Bredekamp / Krämer (2003), 12. 72 Bilder sind zwar im Sinne Goodmans nicht disjunkt und endlich differenziert, sondern dicht, aber sie verfügen in verschiedenen dispositiven Rahmen über Verfahren der Referenz, der intramedialen Selbstbezugnahme sowie der intermedialen Bezugnahme auf andere Medien. 73 Vgl. Bolter (2000), 55. 74 Böhme (2004), 46. 109 Zeichen» sind, «wie uns die Semiotik glauben macht»,75 greift auf ein antisemiologisches Ressentiment zurück, das den unangemessenen Versuch unternimmt, die aisthetisch-ikonische Mächtigkeit bildlicher Medien gegen die vorgeblich auf eine konventionell-arbiträre Repräsentationsfunktion eingeschränkten Zeichen auszuspielen. Zeichen sind freilich nicht auf eine Abbildfunktion restringiert.76 Eine zentrale epistemologische Pointe des linguistic turn, dessen Ablösung in den Bildwissenschaften allenthalben gefeiert wird, ist gerade die These, dass Zeichen und Sprache sich nicht darin erschöpfen, Abbildungsmedien einer präsemiologischen bzw. vorsprachlichen Welt zu sein, sondern dass ihnen eine erkenntniskonstitutive Leistung zukommt. Bereits Wilhelm von Humboldt hatte hierfür die programmatische Formulierung gefunden, dass die Sprache nicht das abbildende Werkzeug, sondern das «bildende Organ des Gedanken» sei. Wenn also Gadamer feststellt: «Der Unterschied von Bild und Zeichen hat (…) ein ontologisches Fundament. Das Bild geht nicht in seiner Verweisungsfunktion auf, sondern hat in seinem eigenen Sein teil an dem, was es abbildet»,77 so formuliert er weniger – wie er glaubt – ein Abgrenzungskriterium des Bildes vom Zeichen, als vielmehr ein konstitutives Merkmal des Semiologischen überhaupt. Kurz gesagt: die klassischen Abgrenzungsversuche, die in den Bildwissenschaften und auch im neueren Schriftdiskurs zwischen Bild und Zeichen bzw. Sprache vorgenommen werden, erkaufen die deutliche Sichtbarkeit dieser Demarkationslinie nicht selten mit theoretischen Annahmen über Sprache und Zeichen, die wenig angemessen sind. Sowohl ikonisch-bildliche, als auch sprachlich-diskursive Skripturen gehören ebenso wie hybride Formen dem Universum der Zeichenhaftigkeit, dem Raum der Semiosis, an, in dem sie durch viele intra- und intermediale Netzwerke miteinander verwoben sind. Gerade auch mit Blick auf Hybridformen muss man Sybille Krämer darin zustimmen, dass es problematisch ist, «Sprache und Bild als disjunkte symbolische Ordnungen»78 anzusehen. Diese Feststellung trifft im Wesentlichen auf alle begrifflichen Oppositionspaare zu, nach der Sprache und Bild disjunkt sor75 76 77 78 110 Belting (2007), 14. Boehm (1995b), 327. Gadamer (1965), 146. Krämer (2003), 509ff. tiert sind, insbesondere auch auf die Gegenüberstellung von Logos und Ikon, die seit Lessings Laokoon und der Zeichentheorie Hegels, Humboldts und Saussures den sprach- und bildtheoretischen Diskurs grundiert. Freilich lässt sich gerade deshalb das Sagbare nicht umstandslos aus der Domäne des Sichtbaren aussortieren. Deiktisch-indexikalische und ikonische Zeichen können ihre semantische Evidenz nur im Rahmen der Semiose insgesamt, also unter Einbeziehung der Leistungen der Symbole erbringen. Dies ist die theoretische Botschaft, die die Peircesche Semiotik vermittelt. Sie ist es freilich auch, die den einen oder anderen Abwehrreflex in den Bildwissenschaften auslöst. IV. Bild ohne Code: Fotografische Evidenz79 Mein Plädoyer für eine Theorie des Bildes und der bildlichen Evidenz, die sich begrifflich nicht aus dem Horizont des Zeichenhaften verabschiedet, geht von der für mein Argument wesentlichen Hypothese aus, dass auch im Raum indexikalisch-ikonischer Bilder die medienimmanenten Bezugnahmen von Zeichen auf Zeichen als die Bedingung der Möglichkeit medientranszendierender Bezugnahmen von Zeichen auf außersprachliche Objekte und Sachverhalte angesehen werden müssen. Sie folgt der Einsicht Jakobsons, dass Bedeutung nur insoweit die Bezugnahme auf Außersprachliches ermöglicht, als sie sich vorgängig in Formen der Übersetzung von Zeichen durch Zeichen zu konstituieren vermag,80 dass also – wie man mit Brandom formulieren könnte – «in der Reihenfolge semantischer Erklärung der Inferenz Vorrang vor der Referenz eingeräumt werden muss».81 Es gibt – so hatte Peirce formuliert – «keine Ausnahme von dem Gesetz», dass in den Prozessen der Semiose «jedes Gedanken-Zeichen durch ein folgendes übersetzt oder interpretiert worden sein muss (…)».82 Dies ist eine der wesentlichen Pointen der Transkriptivitätsannahme. 79 Die beiden folgenden Abschnitte stützen sich wesentlich auf meine Aufsätze Jäger (2008); sowie Ders. (2006). 80 Vgl. Jakobson (1992), 104; hierzu ebenso Holenstein (1975), 163. 81 Vgl. Brandom (2001), 9. 82 Vgl. Peirce (1984), 224. 111 Es liegt nun auf der Hand, dass eine solche Annahme von der Bartheschen Idee der fotografischen Evidenz grundlegend herausgefordert würde. In der Tat könnte man annehmen, dass für das Postulat einer Priorität medien­ immanenter vor medientranszendierenden Bezugnahmen (von Zeichen auf die Welt) gerade dann Schwierigkeiten entstehen könnten, wenn man einen Blick auf das Problem der Evidenz wirft. Denn semantische Evidenz scheint sich ja zunächst als eine Form unmittelbarer Geltung von Zeichensinn – sei diese nun sprachlicher oder bildlicher Provenienz – nur in einem Modus einzustellen, in dem sich die Gewissheitsbürgschaft nicht primär intra- und intermedialen Bezugnahmen von Zeichen durch Zeichen verdankt, wie sie etwa Zitation, Übersetzung, Kommentar oder Untertitelung von Bildern etc. darstellen, sondern vielmehr einer Bezugnahme, die aus dem Universum der Zeichen hinaus auf eine präsemiologische Welt verweist, die gerade in ihrem epistemologischen Status der Vorzeichenhaftigkeit als Quelle für die Evidenz des Zeichensinnes aufkommt. Darin, dass sich die Welt im Bild unvermittelt als sie selbst zeigt, läge dann die spezifische Evidenz des Bildes. Gerade der Fall der analogischen Fotografie scheint ein paradigmatischer Fall einer solchen Priorität des Referentiellen vor dem Inferentiellen zu sein. An ihm kann deshalb nachgeprüft werden, ob wir es hier mit einem Typus von Medium zu tun haben, der seine genuine Semantik ebenso wie seine spezifische bildliche Evidenz nicht den transkriptiven (inferentiellen) Bezugnahmespielen der Semiosis,83 sondern einer gleichsam vorsemiologischen Referenz verdankt. Zugleich hätten wir es dann zumindest im fotografischen Bild mit einem medialen Typus zu tun, der dem Universum des Zeichenhaften nicht zugerechnet werden könnte, sondern der es gleichsam epistemologisch begründete. Sollte freilich auch für ihn gezeigt werden können, dass «in der Reihenfolge semantischer Erklärung der Inferenz Vorrang vor der Referenz eingeräumt werden muss»,84 so wäre dieser Nachweis für weniger einschlägige mediale Kandidaten umso nachdrücklicher. Anders formuliert: sollte selbst für den Fall der bildlichen Evidenz von (analogen) Fotografien gezeigt werden können, dass er sich vom inferentiellen Spiel der Semiosis nicht zu emanzipieren 83 Vgl. hierzu Jäger u.a. (im Erscheinen). 84 Vgl. Brandom (2001), 9. 112 vermag, würde dies umso eher für mediale Formate gelten, die sich nicht durch einen analogisch indexikalischen Bezug auf eine transsemiologische Wirklichkeit charakterisieren lassen – also etwa auch für Arten von Bildern, die nicht analogische Fotografien sind. Der Barthsche Versuch, die Fotografie als paradigmatische Form gleichsam medial unvermittelter semantischer Evidenz in Geltung zu setzen, ist insofern ein guter Kandidat für die Prüfung der Frage, ob es sich hier um eine mächtige bildliche Evidenz jenseits der Einflusssphären von Sprache und Zeichen handelt. In seinem 1980 erschienenen und viel diskutierten Text La chambre claire. Note sur la photographie85 hatte Roland Barthes eine Idee des Lichtbildes zu resituieren versucht, die grundsätzlich für die Möglichkeit einer rein indexikalischen Bezugnahme der Fotografie auf ihr Bezugsobjekt Stellung bezog. Dabei publizierte Barthes seinen Text zu einem Zeitpunkt, zu dem der sich intensivierende Diskurs der Fotografie86 längst die Konzeptualisierung des Fotos als eines «interventionslosen Aufzeichnungsinstrumentes»87 prinzipiell in Frage gestellt hatte. In souveräner Ignorierung dieses Diskurses insistiert Barthes darauf, dass das Foto als «Bild ohne Code»,88 als indexikalisches Zeichen, seinen Gegenstand unmittelbar zur Darstellung bringt, ihn – wie Barthes formuliert – «chemisch enthüllt»:89 «Die Fotografie ist, wörtlich verstanden, eine Emanation des Referenten».90 Es ist also das Objekt jenseits der Semiose, das Objekt selbst, das in der (analogischen) Fotografie eine Möglichkeit gefunden zu haben scheint, sich medial, aber gleichwohl als es selbst, zu enthüllen. Wie Peirce behandelt Barthes das Foto als indexikalisch-ikonisches Zeichen, bei dem – wie Peirce formuliert hatte – «die physikalische Wirkung des Lichts beim Belichten eine existenzielle «Eins zu Eins»-Korrespondenz zwischen Teilen des Fotos und den Teilen des Objektes» herstelle.91 85 Die folgenden Überlegungen zitieren den Text nach der deutschen Ausgabe Barthes (1989). 86 Vgl. hierzu etwa Wolf (2002); Dies. (2003); Geimer (2002). 87 Vgl. Holenbusch (2003), 20. 88 Barthes (1989), 99. 89 Ebd., 18. 90 Ebd., 90. 91 Peirce (1983), 65; Barthes (1989), 18. 113 Anders aber als Peirce löscht er den für die indexikalische Bezugnahme konstitutiven Rahmen einer, das Verweisen erst ermöglichenden, umfassenden Semiosis. In einem wirkungsmächtigen Zusammenfall von Indexikalität und Deixis verweist die Fotografie, ohne dass sie eines überindexikalischen Rahmens, d.h., ohne dass sie der Übersetzungs- und Interpretationsverfahren der Semiosis als Ganzes bedürfte, im Zuge der chemischen Enthüllung ihres Gegenstandes zugleich auf diesen, und exponiert ihn unvermittelt als er selbst: «Die Fotografie ist immer nur ein Wechselgesang von Rufen wie «Seht mal! Schau! Hier ist’s»; sie deutet mit dem Finger auf ein bestimmtes Gegenüber und ist an diese reine Hinweissprache gebunden».92 Zugleich erzeugt sie auf diese Weise «die seltene, vielleicht einzigartige Evidenz des ‹So, ja, so, und weiter nichts›»;93 diese tritt als punctum «blitzartig»94 in Erscheinung: sie schießt «wie ein Pfeil» aus dem Zusammenhang des Bildes hervor, «um mich zu durchbohren».95 Es ist nicht ganz überraschend, dass die so konzeptualisierte fotografische Evidenz alle Eigenschaften der phänomenologischen Evidenz des «aufblitzenden Augenblicks» teilt. Ihre Unvergleichlichkeit96 verdankt sich zwei konstitutiven Momenten: (1) Einmal dem hinweisenden Finger, mit dem das Foto auf ein bestimmtes Gegenüber als auf seinen (gewesenen) Gegenstand deutet und die «magnetisierte»97 Aufmerksamkeit auf ihn richtet, durch eine deiktische Geste also, mit der das Zeichen auf seinen Referenten als auf seine Ursache zurückverweist – die so etwas zu sein scheint wie ein Amalgam aus Rahmung (Albertis Fenster) und Zentralperspektive sowie zum zweiten (2) durch die indexikalische Authentifizierung des Referenten, der sich als Gegenstand vor der Kamera kausal und unvermittelt, das heißt, ohne die Dazwischenkunft einer auktorial intervenierenden medialen Apparatur in das lichtempfindliche Papier einschreibt. Indexikalität und Deixis spielen hier in einer eigen92 93 94 95 96 Barthes (1989), 13. Ebd., 119. Ebd., 59. Ebd., 35. Auch in Barthes (1990), 13, spricht er vom «Sonderstatus des fotografischen Bildes: Es ist eine Botschaft ohne Code». 97 Peirce (1970), 218f. 114 tümlichen Weise zusammen: sie interagieren als zwei gegenläufig gerichtete Bewegungen derselben Zeichenrelation: der indexikalischen, die gleichsam von der Ursache (dem Objekt) auf die Wirkung, das Zeichen (das Foto), und durch dieses hindurch auf den Betrachter zielt und der deiktischen, die umgekehrt von der Wirkung auf die Ursache verweist. Aus dieser Komplizenschaft, die zugleich das Medium in seiner Materialität auslöscht,98 erhebt sich die fotografische als indexikalische Evidenz in ihrer Einzigartigkeit. Das Foto ist, wie Barthes schreibt, die «Beglaubigung, daß das, was ich sehe, tatsächlich dagewesen ist».99 Fotografie ist deshalb «Beglaubigung von Präsenz»,100 ja – sie ist «die Bestätigung selbst».101 Die «besondere Glaubwürdigkeit der Fotografie» beruht dabei – so Barthes an anderer Stelle – auf «ihrem außergewöhnlichen Denotationsvermögen»,102 darauf, dass wir auf der denotativen Ebene der Semantik des Bildes, die sich von seiner kulturell-konnotativen nicht berühren lässt, kein anderes Wissen benötigen «als das mit unserer Wahrnehmung verknüpfte»,103 ein Wissen, das als «ein anthropologisches Wissen» verstanden werden muss. Die Fotografie stellt also eine Form der Authentifizierung zur Verfügung, zu der kein anderes Medium – insbesondere nicht das der Sprache – in der Lage wäre.104 Nur die Fotografie, die – so Barthes – die Beglaubigung als neues Gen in die Familie der Bilder eingeführt hat,105 verfügt über eine Evidenz, die derart mächtig auftritt. Nur sie also vermittelt eine Gewissheit, die «unanfechtbar» ist.106 Was hat es nun mit der Unanfechtbarkeit der fotografischen Gewissheit auf sich? Verdankt sie sich einem Typus referentieller (direkter) Bezugnahme, die auf jeglichen inferentiellen Bezugshorizont, d.h. auf die Leistungen 98 Vgl. Barthes (1989), 14, 55. 99 Ebd., 92. 100 Ebd., 97. 101 Ebd., 96. 102 Barthes (1990), 17. 103 Barthes (1989), 32. 104 Ebd., 96, 117. 105 Ebd., 97. 106 Ebd., 117. 115 der Semiose, verzichten kann? Ein Moment einer solchen Unanfechtbarkeit könnte man darin sehen, dass es sich bei der Fotografie um eine Bildersprache handelt, die universal ist, d.h. um ein Medium, dessen Darstellungsleistung von den Kontaminationen kultureller Kontextualisierungen, von dem, was Barthes im Gegensatz zum «Punktum» «Studium» nennt, nicht berührt wird. Ein solches Medium könnte über die fotografische Evidenz, dass es so und so gewesen ist, deshalb verfügen, weil es sich einer Wahrnehmungsform bedient, die als «anthropologisches Wissen» allen kulturellen Kontaminationen und Konnotationen vorausliegt. Wir hätten es, wenn man dem Bartheschen Gedanken folgte, mit einer – wie Danto formuliert – bildlichen Sprache zu tun, die «für alle Wesen mit einem vergleichbaren Wahrnehmungsvermögen universelle Geltung besäße».107 Allerdings gälte für eine solche Sprache auch: «(…) was sie darstellen könnte, wäre auf das beschränkt, was man ohne weitere Lernvorgänge wahrnehmen könnte. Eine Sprache, deren Gehalt darauf reduziert wäre, hätte freilich nicht viel zu sagen. Und Bilder, die nur so viel zeigten, würden nicht viel zeigen».108 Es ist deshalb – zumindest für Danto – «zweifelhaft, ob eine bildliche Sprache die Möglichkeit der Darstellung einer diskursiven Sprache erreichen kann, ohne Hilfe von der diskursiven Sprache in Anspruch zu nehmen»,109 oder – wie man auch formulieren könnte: es ist zweifelhaft, ob referentielle Bezugnahmen einer indexikalischen Sprache der Bilder ohne inferentielle Bezugnahmen auf der Ebene symbolischer Kontextualisierungen, d.h. ohne die Übersetzungs- und Interpretationsleistungen der Semiose und ihrer symbolisch-inferentiellen Mittel möglich sind. Dass der Befund Dantos einige Plausibilität für sich hat, kann wieder ein Blick auf Peirce zeigen. Eine indexikalische Bezugnahme, in der sich gleichsam unmittelbar zum Ausdruck brächte, dass es so und so gewesen ist, die also ausschließlich durch eine kausale Relation zwischen Wahrnehmungsgegenstand und Darstellungsmittel bestimmt wäre, vermöchte für sich, unabhängig vom Funktionsrahmen einer komplexen Semiosis, ohne die Inanspruchnahme also ihrer Ikonizitäts- und Symbolizitäts-Funktion, gar nicht im Referenzfeld zu 107 Vgl. Danto (1995), 144. 108 Ebd. 109 Ebd. 116 spezifizieren, welches der Gegenstand ist, auf den sie sich richtet. Handelt es sich also etwa bei dem Referenten eines Porträtfotos von Richard Avedon «William Casby, als Sklave geboren»,110 in dem – wie Barthes behauptet, «das Wesen der Sklaverei (…) bloßgelegt» sei,111 um den tatsächlichen ehemaligen Sklaven William Casby, oder um einen Sklaven, der aber nicht William Casby hieß, oder um William Casby, der aber kein Sklave war, oder um jemanden, der weder Sklave war, noch William Casby hieß? Die Unentscheidbarkeit dieser und möglicherweise weiterer Lesart-Alternativen ist durch keinen Aspekt der indexikalischen Bild-Evidenz zu beseitigen, selbst dann noch nicht, wenn wir über das indexikalische Moment hinaus die Ikonizität des Bildes, also die Ähnlichkeit des Abgebildeten mit der fotografischen Abbildung, heranziehen. Das Objekt, das als Ursache die fotografische Wiedergabe bewirkte, wird erst dann zum Referenten112 des Fotos (William Casby), wenn das bildliche Zeichen durch den Paratext der Bildunterschrift («Richard Avedon – William Casby, als Sklave geboren 1963») – also durch sprachlich-mediale Mittel – transkribiert wird. Die kausale Relation, auf die die indexikalische Bezugnahme sich stützt, verwandelt sich allein unter der Voraussetzung in eine semiologische Referenz, dass der Index durch situationsungebundene symbolische Mittel semantisch ergänzt wird. Die kausale Relation darf also, wie Riedel mit Recht hervorhebt, «nicht mit der semiotischen verwechselt werden: damit sie sich zu einer indexikalischen Bezugnahme wandelt, ist zum einen das ikonische Moment, zum andern ein symbolisches Umfeld unabdingbar».113 Die deiktisch-indexikalische Geste, die für sich in Anspruch nimmt, die Gewissheit, «daß es so und so gewesen ist»,114 alleine zu verbürgen, muss also hinter ihrem Rücken notwendig die Operatoren des gesamten semiologischen Feldes in Anspruch nehmen, um ihre unanfechtbare Evidenz hervorzubringen. Die Evidenz des Bildes verdankt sich nicht allein der authentifizierenden Kraft der indexikalisch-ikonischen Evidenz, sondern auch Bezugnahmeformen, die jenseits der Referenzebene auf der Ebene der inferentiellen Bezugnahmen von Zeichen auf Zeichen liegen. 110 Vgl. zur Diskussion dieses Beispiels und zu dem folgenden Riedel (2002). 111 Barthes (1989), 45. 112 Vgl. zu der erhellenden Unterscheidung von «Objekt» und «Referent» Riedel (2002). 113 Ebd., 288. 114 Barthes (1989), 117. 117 V. Evidenz und Transkriptivität Barthes’ Versuch, die Fotografie gegen die Vertreter «semantischer Relativität», die Verächter des Realen, als «Emanation des vergangenen Wirklichen» zu rehabilitieren und ihr die «bestätigende Kraft» einer «Zeugenschaft»115 für das, was gewiss gewesen ist, anzumuten, wirft die allgemeinere Frage nach dem Verhältnis von Evidenz und Medialität auf. Vor dem Hintergrund der Bartheschen Annahme einer mächtigen Evidenz des Fotografischen, in der sich das Mediale in der Evidenz des Augenblicks zugunsten des Mediatisierten auflöst, möchte ich dafür argumentieren, dass es keine Form der semantischen Evidenz von Symbolsystemen gibt, die nicht ihrerseits als das Ergebnis intramedialer (rekursiver) bzw. intermedialer Bezugnahmen verstanden werden müsste, als das Ergebnis von transkriptiven Prozeduren also, die als medienimmanente Bezugnahmen die Möglichkeitsbedingung von medientranszendierenden Bezugnahmen zwischen Symbolsystemen und ihren Gegenstandswelten darstellen. Die authentifizierende Kraft der semantischen Evidenz lässt sich nicht allein und nicht einmal vorrangig aus der Referenzialität von Zeichen herleiten. Evidenz verdankt die Aura der unanfechtbaren Gewissheit, die sie umgibt, dem Umstand, dass es ihr nicht selten gelingt, die semiologischen Prozeduren zu maskieren, die sie allererst hervorbringen. Evidenz – so lässt sich gerade mit Blick auf die (analogische) Fotografie feststellen, ist das Resultat von Operationen der Semiose, die mitunter in ihren Ergebnissen verschwinden und so den Anschein unvermittelter Geltung erwecken. Die mächtige Evidenz des Sichtbaren beleiht die symbolischen Prozeduren des Sagbaren und bringt sie ebenso zum Verschwinden wie den Bild-Signifikanten, der in dem, was er zeigt, unsichtbar bleibt: «es ist nicht das Foto, das man sieht».116 Evidenz, so hat es den Anschein, ist grundsätzlich durch die untilgbare Einschreibung des Semiologischen in das Feld des Ursprünglichen und Unvermittelten gezeichnet; dies gilt auch für das Feld der indexikalischen Evidenz, auf dem – wie Barthes formuliert hatte – das Medium bereit ist, sich selbst aufzuheben und «nicht mehr Zeichen, son115 Barthes (1989), 99. 116 Ebd., 14. 118 dern die Sache selbst zu sein».117 Grundsätzlich lässt sich Evidenz nur als ein Resultat118 medialer Verfahren zur Sinngenerierung und nicht als deren Grund im Sinne einer unanfechtbaren Gewissheitsbürgschaft verstehen. Der Eigensinn des fotografischen Bildes verdankt sich der Medialität des fotografischen Verfahrens, aber die Evidenz, die ihm eigentümlich ist, steht am Ende einer Kette von Transkriptionen und nicht an deren Anfang.119 Vertritt man – wie ich dies hier tun möchte – eine solche Idee der Evidenz, dann bezieht Sinn seine Fundierung nicht aus prädiskursiven Geltungsgründen, sondern allein aus medialen Verfahren der Sinngenerierung und der Evidenzauszeichnung. Evidenzverfahren bringen dann als mediale Prozeduren gleichsam Schauplätze der Evidenz hervor, Aushandlungsbühnen, auf denen die kulturelle Semantik ihre Sinnzuschreibungen durchführt bzw. in ihren verschiedenen dispositiven Formaten Sinn unter den Bedingungen von Rhetoriken der Evidenz inszeniert.120 Unter diesen nehmen gerade die Rhetoriken bildlicher Evidenzgenerierung eine prominente Rolle ein. Dies betrifft nicht nur solche Formen der Evidenzauszeichnung, in denen die Zuschreibung von Evidenz in diskursiven Verfahren ausgestellt wird, sondern ebenso auch die, in denen, wie bei der epistemischen Evidenz, die Herstellungsprozeduren maskiert sind.121 Die einzigartige Evidenz des fotografischen Bildes lässt sich insofern als eine epistemische Evidenz verstehen, die ihre (subjektive) Gewissheit aus Prozeduren herleitet, die ihrerseits nicht wahrgenommen werden. Für die Evidenz dieses Typs gilt, dass das semiologische Verfahren, dem sie sich verdankt, unter bestimmten Bedingungen selber unsichtbar bleibt, dann nämlich, wenn die kulturellen Rahmen, in denen sie hervorgebracht wird, vertraut sind. Sichtbarkeit erlangt das Verfahren hier nur dann, wenn es gestört worden, d.h. die Evidenz des generierten Sinnes ungewiss geworden ist.122 Epistemische Evidenz ist also dadurch bestimmt, dass in ihr 117 Ebd., 55. 118 Zur «Evidenz als Leistung» vgl. Husserl (1929), 113ff., 140ff., 184ff., 249ff. 119 Vgl. hierzu ausführlich Jäger (2006), 42ff. 120 Vgl. hierzu Holert (2001), 208. 121 Vgl. zur Unterscheidung von diskursiver und epistemischer Evidenz ausführlich Jäger (2006). 122 Vgl. zum Begriff der «Störung» Jäger (2004a). 119 die sozialen (kommunikativen, diskursiven) Prozeduren ihrer Genese immer wieder in ihrem Gegebenheitsmodus verschwinden und gleichsam unsichtbar werden. Gleichwohl verdankt auch sie sich symbolisch-medialen Prozessen, Evidenzverfahren, in denen das scheinbar Ursprüngliche in Prozeduren der Nachträglichkeit erzeugt wird. Dies gilt für die indexikalische Evidenz fotografischer Bilder ebenso, wie für die semantische Evidenz anderer Zeichen- und Mediensysteme. Evidenz ist deshalb, wie man sagen könnte, nicht nur, wenn sie in der Sichtbarkeit rhetorischer Prozessualität als das Ergebnis diskursiver Operationen auftritt,123 sondern auch, wenn sie in ihrer epistemischen Gestalt erscheint, eine Hervorbringung medialer, d.h. transkriptiver Verfahren, die, weil sie als Verfahren transparent bleiben, hinter die Evidenz des in Szene gesetzten Sinns zurücktreten und ihre medialen Hervorbringungen mit dem Anschein ursprünglicher Unvermitteltheit ausstatten. Auch die Indexikalität der Fotografie verbürgt insofern nicht eine mächtige, d.h. von den transkriptiven Leistungen der Semiose unabhängige und insofern unmittelbare Evidenz. Es ist vielmehr allein die Unsichtbarkeit ihrer Inszenierungsbedingungen, die den Referenten in ontologischer Unmittelbarkeit erscheinen lässt.124 Auch die indexikalische Bezugnahme kann sich deshalb der Voraussetzung nicht entziehen, dass sich ihre Evidenz nur als Resultat der konstitutiven Bewegung der Semiose einstellt. VI. Kleines Resümee: bildlicher Sinn und Semiose Als kleines Resümee meiner bisherigen Überlegungen zur bildtheoretischen Konzeptualisierung des Bildlichen und zum epistemologischen Sonderstatus der ikonischen Evidenz ließe sich etwa das Folgende festhalten: Wie auch immer man die «eigentümliche Leistung des bildlichen Sinnes»125 verstehen will, man wird sie – wie ich glaube – in ihrem Eigensinn nicht nur dadurch angemessen würdigen können, dass man sie aus dem Horizont einer umfassenderen Semiose herauslöst. Eine solche Herauslösung aber scheint nach wie 123 Wie etwa in den Evidenzgewinnungsprozeduren eines Gerichtsverfahrens. 124 Vgl. Barthes (1989), 14. 125 Boehm (2010), 21. 120 vor die zentrale Option des bildtheoretischen Diskurses zu sein. Im jüngsten Sammelband Die Rhetorik des Sichtbaren der Baseler Forschungsgruppe Eikones begründet Gottfried Boehm das Ausschlagen des «verlockenden Angebots» der Zeichentheorie (Peircescher Provenienz) für eine Theorie des Bildes damit, dass die Verlockung verbunden sei mit einer «Überbrückung bzw. Einebnung der Differenz von ‹sagen› und ‹zeigen› bzw. von Bild und Sprache sowie anderer Medien auf der neuen Ebene des Zeichens und seiner Modi der Bezugnahme».126 Er fordert deshalb eine Prüfung der zeichentheoretischen Option für die Entfaltung des Bildbegriffs. Ohne Zweifel hat Boehm darin Recht, dass eine zeichentheoretische Konzeptualisierung des Verhältnisses von «sagen» und «zeigen» der Prüfung ihrer Plausibilität und ihrer Tragweite bedarf. Freilich scheint mir das «verlockende» Peircesche Angebot nicht in dem Vorschlag einer Einebnung der Differenz von «sagen» und «zeigen» oder, wenn man so will, von Bild und Sprache, zu bestehen, sondern vielmehr in ihrer begrifflichen Schärfung. Es wird nämlich ohne einen zeichentheoretischen Rahmen nicht ganz leicht zu zeigen sein, was Bilder zu erkennen geben, wenn sie etwa zeigen (und es nicht sagen), was also unter dem genuinen «bildlichen Sinn» des Bildes verstanden werden kann und vor allem, wie wir Begriffe wie Deixis, Indexikalität, Repräsentation oder Ikonizität in einem theoretisch befriedigenden Sinne verwenden können.127 Der Versuch, das Bildliche aus dem Horizont des Sprachlich-Zeichenhaften herauszulösen, ist ähnlich problematisch, wie der entgegengesetzte und von der Bildtheorie zurecht bekämpfte Versuch etwa Lessings, Hegels und Humboldts, die piktorale Intelligenz der sprachlich-diskursiven unterzuordnen. So sehr auch die Hegel-Humboldtsche Hierarchisierung von Logos und Ikon verfehlt ist, so sehr lebt doch die Umkehrung der epistemologischen Rangordnung von einer exklusiven Geste, von einem Ausschluss, der das Bild, indem er es feiert, tatsächlich dadurch abwertet, dass er es aus dem Horizont von Sprache und Zeichen ausbürgert. Die Evidenz des Bildes ist sicher durch einen ästhetischaisthetischen Eigensinn bestimmt. Aber durch diesen wird sie zu keinem für die Semiose und den Raum des Semiologischen exzentrischen Phänomen. 126 Ebd., 21. 127 Das zeichentheoretische Begriffsfeld, das die Bildtheorie terminologisch beleiht, ohne es theoretisch in sein Recht zu setzen, hat eine noch weit größere Extension. 121 Literatur Barthes, Roland. Die helle Kammer. Bemerkungen zur Fotografie, Frankfurt a.M. 1989. Barthes, Roland. «Die Fotografie als Botschaft». In: Ders. Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn, Frankfurt a.M. 1990. Belting, Hans. Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München 2001. Belting, Hans (Hg.). Bilderfragen. Die Bildwissenschaften im Aufbruch, München 2007. Boehm, Gottfried. «Zu einer Hermeneutik des Bildes». In: Hans-Georg Gadamer / Gottfried Boehm (Hg.). Seminar. Die Hermeneutik und die Wissenschaften, Frankfurt a.M. 1978, S. 444–485. Boehm, Gottfried (Hg.). Was ist ein Bild?, München 1995. Boehm, Gottfried. «Die Bilderfrage». In: Ders. (1995), S. 325–343 (= 1995a). Boehm, Gottfried. «Unbestimmtheit. Zur Logik des Bildes». In: Bernd Hüppauf / Christoph Wulf (Hg.). Bild und Einbildungskraft, München 2006, S. 243–253. Boehm, Gottfried. «Das Paradigma ‹Bild›. Die Tragweite der ikonischen Episteme». In: Belting (2007), S. 77–82. Boehm, Gottfried. «Iconic Turn. Ein Brief». In: Belting (2007), S. 27–36 (= 2007a). Boehm, Gottfried. «Augenmaß. Zur Genese der ikonischen Evidenz». In: Ders. u.a. (Hg.). Movens Bild. Zwischen Evidenz und Affekt, München 2008, S. 15–43. Boehm, Gottfried. «Das Zeigen der Bilder». In: Ders. u.a. (Hg.). Zeigen. Die Rhetorik des Sichtbaren, München 2010, S. 19–53. Böhme, Gernot. Theorie des Bildes, München 2004. Bolter, Jay David / Richard Grusin. Remediation. Understanding New Media, Cambridge (MA) 2000. Brandom, Robert B. Begründen und Begreifen. Eine Einführung in den Inferentialismus, Frankfurt a.M. 2001. Bredekamp, Horst / Sybille Krämer. «Technik und Kultur als Bedingungsgeflecht». In: Dies. (Hg.). Bild, Schrift, Zahl, München 2003, S. 11–22. 122 Cassirer, Ernst. Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil – Die Sprache, Darmstadt 1964. Danto, Arthur C. «Abbildung und Beschreibung». In: Boehm (1995), S. 125–147. Foucault, Michel. Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin 1978. Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1965. Gadamer, Hans-Georg. «Bildkunst und Wortkunst». In: Boehm (1995), S. 90–103. Geimer, Peter (Hg.). Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft Kunst und Technologie, Frankfurt a.M. 2002. Goodman, Nelson. Weisen der Welterzeugung, Frankfurt a.M. 1990. Grube, Gernot u.a. (Hg.). Schrift. Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine, München 2005. Grube, Gernot / Werner Kogge. «Zur Einleitung. Was ist Schrift?». In: Grube u.a. (2005), S. 10–21. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Dritter Teil (1830), Bd. 10, Frankfurt a.M. 1970. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Ästhetik III, Frankfurt a.M. 1986. Holenbusch, Susanne. «Einleitung. Vom Paradigma zu den Diskursen». In: Wolf (2003), S. 7–21. Holenstein, Elmar. Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus, Frankfurt a.M. 1975. Holert, Tom. «Evidenz-Effekte. Überzeugungsarbeit in der visuellen Kultur der Gegenwart». In: Matthias Bickenbach / Axel Fliethmann (Hg.). Korrespondenzen. Visuelle Kulturen zwischen Früher Neuzeit und Gegenwart, Köln 2001. Hubig, Christoph. «‹Dispositiv› als Kategorie». In: Internationale Zeitschrift für Philosophie 1 (2000), S. 35–47. Husserl, Edmund. Formale und Transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft, Halle 1929. Ingold, Felix Philipp. «Welt und Bild». In: Boehm (1995), S. 367–409. 123 Jäger, Ludwig. «Störung und Transparenz. Skizze zur performativen Logik des Medialen». In: Sybille Krämer (Hg.). Performativität und Medialität, München 2004a, S. 35–74. Jäger, Ludwig. «Transkriptive Verhältnisse. Zur Logik intra- und intermedialer Bezugnahmen in ästhetischen Diskursen». In: Gabriele Buschmeier u.a. (Hg.). Transkription und Fassung in der Musik des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2004b, S. 103–134. Jäger, Ludwig. «Versuch über den Ort der Schrift. Die Geburt der Schrift aus dem Geist der Rede». In: Grube u.a. (2005), S. 187–210. Jäger, Ludwig. «Vom Eigensinn des Mediums Sprache». In: Dietrich Busse u.a. (Hg.). Brisante Semantik. Neuere Konzepte und Forschungsergebnisse einer kulturwissenschaftlichen Semantik, Tübingen 2005a, S. 45–64. Jäger, Ludwig. «Schauplätze der Evidenz. Evidenzverfahren und kulturelle Semantik. Eine Skizze». In: Michael Cuntz u.a. (Hg.). Die Listen der Evidenz, Köln 2006, S. 37–52. Jäger, Ludwig. «Indexikalität und Evidenz. Skizze zum Verhältnis von referentieller und inferentieller Bezugnahme». In: Horst Wenzel / Ludwig Jäger (Hg.). Deixis und Evidenz, Freiburg u.a. 2008, S. 289–316. Jäger, Ludwig. «Intermedialität – Intramedialität – Transkriptivität. Überlegungen zu einigen Prinzipien der kulturellen Semiosis». In: Arnulf Deppermann / Angelika Linke (Hg.). Sprache intermedial. Stimme und Schrift – Bild und Ton. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache, Berlin / New York 2009, S. 301–323. Jäger, Ludwig u.a. (Hg.). Medienbewegungen. Praktiken der Bezugnahme (im Erscheinen). Jakobson, Roman. «Peirce, Bahnbrecher in der Sprachwissenschaft». In: Ders. Semiotik. Ausgewählte Texte 1919-1982, Frankfurt a.M. 1992, S. 99–107. Krämer, Sybille. «Sagen und Zeigen. Sechs Perspektiven, in denen das Diskursive und das Ikonische in der Sprache konvergieren». In: Zeitschrift für Germanistik 3 (2003), S. 509–519. Krämer, Sybille. «‹Operationsraum Schrift›. Über einen Perspektivwechsel in der Betrachtung der Schrift». In: Grube u.a. (2005), S. 23–60. Krüger, Klaus. «Das Bild als Palimpsest». In: Belting (2007), S. 133–163. 124 Lethen, Helmut. «Der Stoff der Evidenz». In: Michael Cuntz u.a. (Hg.). Die Listen der Evidenz, Köln 2006, S. 65–85. Lunenfeld, Peter. «Digitale Fotografie. Das dubitative Bild». In: Wolf (2002), S. 158–177. Mersmann, Brigitte. «Das Bild als Spur». In: Belting (2007), S. 195–215. Mitchell, William J. T. «Realismus im digitalen Bild». In: Belting (2007), S. 237–255. Peirce, Charles Sanders. Schriften II. Vom Pragmatismus zum Pragmatizismus, Frankfurt a.M. 1970. Peirce, Charles Sanders. Phänomen und Logik der Zeichen, Frankfurt a.M. 1983. Peirce, Charles Sanders. «Some Consequences of Four Incapacities». In: Ders. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition, Bd. 2, Bloomington 1984. Riedel, Peter. «Fotografische Referenz. Zur Konkretion des Indexbegriffes». In: Medienwissenschaft. Rezensionen – Reviews 3 (2002), S. 283–297. Rorty, Richard (Hg.). The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method, Chicago 1992. Scholz, Bernard F. «‹Toute représentation est faite pour la veuë›. Zu Möglichkeiten und Grenzen der frühmodernen begrifflichen Erfassung von Wort-Bild-Beziehungen». In: Matthias Bickenbach / Axel Fliethmann (Hg.). Korrespondenzen. Visuelle Kultur zwischen Früher Neuzeit und Gegenwart, München 2002, S. 108–128. Schürmann, Eva. Sehen als Praxis, Frankfurt a.M. 2008. Snyder, Joel. «Das Bild des Sehens». In: Wolf (2002), S. 23–59. Sober, Elliot. «Mental representation». In: Synthese 33 (1976), S. 101–148. Voßkamp, Wilhelm / Brigitte Weingart (Hg.). Sichtbares und Sagbares. TextBild-Verhältnisse, Köln 2005. Waldenfels, Bernhard. «Von der Wirkmacht und Wirkkraft der Bilder». In: Boehm u.a. (2008), S. 46–63. Wolf, Herta (Hg.). Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters, Bd. 1, Frankfurt a.M. 2002. Wolf, Herta (Hg.). Diskurse der Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters, Bd. 2, Frankfurt a.M. 2003. Wyss, Beat. Vom Bild zum Kunstsystem, Köln 2006. 125 Die Physis des Bildes Ludger Schwarte Bilder gestalten und prägen unser Weltverhältnis. Sie legen Äußerungs- und Handlungsformen fest.1 Sie sind «kulturelle Tatsachen». Bilder zählen zu den Grundlagen der kulturellen Welt. Aber was meinen wir, wenn wir von Bildern sprechen? Das deutsche Wort «Bild» hat, im Gegensatz zu der im Englischen üblichen Unterscheidung zwischen Picture und Image, den sehr seltenen Vorteil, nicht zu differenzieren. Es umfasst sowohl das, was wir im Kopf anschauen, wie auch das, was wir uns an die Wand hängen können. Wird mit «Bild» zumindest immer auch das gemeint, was die eine bildhafte Ansicht bedingt, ist keine Bildtheorie zufriedenstellend, die nicht auch die Eigenschaften von Bildnissen, von Zeichnungen, Gemälden, Statuen, Photos, Filmen usw., beschreibt. Bisher wird in bildtheoretischen Bemühungen der Körperbau, die Physis, die Statur, die Konstitution, die Figur des Bildes aber geflissentlich, fast schamhaft übersehen. Wir sollten zu erklären in der Lage sein, wie sich ein Bild in einem Gemälde verkörpern kann, und inwiefern die physische Konstitution von Bildern sie von anderen Dingen, die wir ebenso ansehen, unterscheidbar macht. Im Hintergrund eines solchen Zuganges auf die Physis des Bildes steht das «Primat des Objektes», wie Walter Benjamin und Theodor W. Adorno es auf korrespondierende Weise herausgearbeitet haben. Auch scheint eine vergleichbare Aufmerksamkeit in Heideggers Ter1 Cassirer (2001), 49: «Wenn alle Kultur sich in der Erschaffung bestimmter geistiger Bildwelten, bestimmter symbolischer Formen wirksam erweist, so besteht das Ziel der Philosophie nicht darin, hinter all diese Schöpfungen zurückzugehen, sondern vielmehr darin, sie in ihrem gestaltenden Grundprinzip zu verstehen und bewusst zu machen (...)». Wollte man eine unmittelbare Schau des geistigen Lebens hinter den Bildwelten erreichen, so wäre dies eine Negation der symbolischen Form. «Geht man dagegen den umgekehrten Weg, fasst man sie (...) als Funktionen und Energien des Bildes, so lassen sich an diesem Bilden selbst, so verschieden und ungleichartig die Gestalten sein mögen, die aus ihnen hervorgehen, doch gewisse gemeinsame und typischen Grundzüge der Gestaltung selbst herausheben». 127 minus «das abbildende Gemäldeding» auf. Meine zentrale Frage ist: Ist nicht ein Bild schon ein Bild, auch ohne dass jemand es entsprechend anschaut? Oder wird etwas nur dadurch zu einem Bild, dass ich es als ein Bild ansehe? Durch ein «Sehen-in», während ich eine mit Zeichen versehene Oberfläche betrachte? Was kennzeichnet das Bild als Ding unter Dingen? Die Frage scheint überflüssig, wenn man davon ausgeht, dass Bilder nur für ein sehendes Bewusstsein innerhalb eines Kommunikationsprozesses exis­ tieren. Entsprechend sollte ich mich auf die Art konzentrieren, wie Bilder etwas zur Darstellung bringen, repräsentieren oder symbolisieren. Doch entgeht der Aufmerksamkeit einiges an den Gemälden und Photos, wenn man sie lediglich an Ihrer Darstellungsleistung mißt und als Medien analysiert. Die in der Kulturphilosophie weit verbreitete Rede von «symbolischen Medien» impliziert, dass sich in Bildern zwei konträre Dimensionen überlagern: Die Nachahmung und die Darstellung. Bilder wären, als «symbolische Medien» betrachtet, einerseits in der Lage, durch die Symbolisierung etwas zur Darstellung zu bringen, was überhaupt nur in dieser singulären Gestaltung anschaulich werden kann. In dieser symboltheoretischen Perspektive tritt das Bild in seiner Eigenlogik, zumal auch in seiner Opazität, in den Vordergrund. Betrachtet man das Bild jedoch hinsichtlich seiner Medialität, so macht es sich selbst zumeist unsichtbar, transparent. Wir glauben, durch das Bild gleichsam hindurch zu blicken, auf einen Sachverhalt, den das Bild simuliert. Bilder wären, je nach Bildtyp in unterschiedlicher Weise, einerseits eingebunden in eine Symbolsprache und andererseits in eine Medientechnik. Diese Auffassung, dass Bilder symbolische Medien seien, halte ich für revisionsbedürftig. Und zwar vor allem, weil man aus dieser Warte die spezifische Wahrheitsfähigkeit der Bilder nicht in den Blick bekommt. Wie ich im Folgenden erläutern möchte, spielt diese Wahrheitsfähigkeit aber nicht nur in naturwissenschaftlichen und politischen Grenzfällen eine wichtige Rolle, sondern vielfach auch im Alltag: wenn der Arzt von mir ein Röntgenphoto macht, dann kann man das, was dort zu sehen ist, niemals jenseits dieses Photos sehen, und doch interessiert dabei nicht das Photo mit seinen Darstellungsqualitäten, sondern ob mein Knochen gebrochen ist oder nicht. Ich verlange nicht vom Arzt, dass er das Photo interpretiert, sondern dass er zuerst richtig hinschaut. Das Röntgenphoto ist weder ein transparentes 128 Medium noch ist es ein Symbol. Vielleicht aus dem Grund, dass vielfältigste Kommunikationsprozesse über Bildschirme kanalisiert und organisiert werden, ist sich die überwiegende Mehrheit der heutigen Bildtheorien darin einig, dass Bilder sichtbare Strukturen sind, die sich von den Bildträgern als ihren Medien abheben. In Oswald Schwemmers Buch Kulturphilosophie beispielsweise werden Bilder als symbolische Medien definiert. Ein Bild, so Schwemmer, sei eine «eigens angefertigte Konfiguration sichtbarer Formverhältnisse», die sich in einem Medium, der begrenzten Fläche, präsentierte. Es sei daher nicht nur Abbild, sondern erschließe Sichtbarkeit.2 Die Rede vom «symbolischen Medium» weist auf zwei Seiten des Bildes hin, die nicht auf der selben logischen Ebene liegen. Wer von Bildern als Symbolen spricht, unterstellt eine strukturelle Ähnlichkeit von Sprache und Bild. Was heißt es, ein Bild als Symbol oder als Konfiguration von Symbolen innerhalb eines Symbolsystems zu betrachten? Nehmen wir eine weit verbreitete Zeichnung, die in jedem öffentlichen Gebäude zu sehen ist. Wir können sie anschauen als Variante auf Magrittes Ceci n’est pas une pipe oder wir können sie schlicht als «Rauchen Verboten»Schild interpretieren. Wir hätten in diesem Fall das, was die Zeichnung uns zu sehen gibt, als Zeichen gedeutet. Nicht aber, wenn wir es lediglich als geometrisches Muster sehen, obschon es das ist, was wir zuerst sehen. Wer davon ausgeht, dass jenes Schild nur dann ein Bild ist, wenn ich darauf die Aussage «Rauchen verboten» erkenne, folgt einem zeichentheoretischen Bildbegriff. Der zeichentheoretische Ansatz geht davon aus, dass Bilder Zeichen sind, die eine Differenzierung in Dargestelltes, Darstellung und Darstellendes erlauben. Dabei kann durchaus offen bleiben, ob, wie Charles Sanders Peirces Begriff des «Ikon» nahelegt, eine gestufte Ähnlichkeit zum Bezeichneten gegeben ist oder ob, wie bei Goodmans Denotationsbegriff, für 2 Schwemmer (2005), 159, 161. Im Gegensatz zum «übersehenden Sehen» steht allerdings das «Malbild»: «Im Bild des Malers wie in seinem Blick wird sozusagen eine Basisdemokratie des überhaupt Sichtbaren errichtet, in der die Herrschaft der Gegenstände aufgehoben ist und das durch unser alltäglich übersehendes Sehen visuell Entrechtete und Vergessene wieder zum Vorschein gebracht wird» (Ebd., 169). 129 bildliche Repräsentation keine Ähnlichkeit erforderlich ist.3 Gleich welcher Gegenstand kann zum Zeichen werden, wenn ihm ein Sinn und eine Bedeutung zugewiesen werden.4 Viele alltägliche Bilder können als Zeichensysteme interpretiert werden. Doch Bilder sind nicht, wie Zeichen, in andere Medien transformierbar. Zeichen können ohne Bedeutungsverlust geschrieben, gelesen, in Blindenschrift ertastet oder in Zahlenkombinationen programmiert werden. Bilder aber müssen gesehen werden. Der Zeichengebrauch rekurriert daher nur auf konventionalisierte Bilder, gewissermaßen auf informatisierte Bildklischees. Dass Bilder ebenso wie Stühle oder Brot als Zeichen gesehen werden können, heißt aber noch nicht, dass Bilder Zeichen sind und dass bildliche Darstellungen mit Notwendigkeit an Extensionen geknüpft sind. Die Gestalt der bildlichen Darstellung kann auch nicht allein aus der semiotischen Pragmatik erklärt werden.5 Nun könnte man einwenden, dass ikonische Zeichen in bestimmten Ähnlichkeitsrelationen zu dem von ihnen Abgebildeten stehen. So wäre weder eine besondere Leistung des Betrachters noch ein konventionalisierter Zeichengebrauch oder eine Bezugnahme auf etwas Äußeres notwendig, wenn ich mich darauf beschränke anzunehmen, dass ein Bild etwas abbildet, indem es die sichtbaren Unterschiede, Aspekte, zum Beispiel die Umrissgestalt oder die Farbvolumen dessen enthält, was ich darauf erkennen soll, ob es dieses Dargestellte nun gibt (wie zum Beispiel ein Photo von mir genügend Merkmale meiner Erscheinung aufweisen muss), ob dabei ein Typ oder ein Allgemeinbegriff visiert wird (wie bei einem Bild vom Körperbau des Menschen oder das Bild einer durchgestrichenen Zigarette) oder ob es sich um eine Fiktion handelt (das Bild von Zeus). So muss man beispielsweise, bevor man die symbolische Bedeutung der Erlösung von den Sünden erfasst, auf einer christlichen Kreuzesdarstellung erst einmal den Menschen Jesus am Kreuz hängend erkennen. Diese Erkennbarkeit der Abbildung liegt in einer Gestaltähnlichkeit zwischen den Eigenschaften des Bildträgers und der Abbildung. Doch gibt es alle möglichen visuellen Repräsentationssysteme 3 4 5 Mit «zeichentheoretisch» sind neben Peirce und Goodman auch Roland Posner, Klaus Sachs-Hombach, Hans Dieter Huber u.a. gemeint. Siehe unter anderem Huber (2004). Vgl. Goodman (1995), 212f. Hierzu: Seel (2000), 277. Bildpragmatik entwickelt Scholz (2002). 130 und künstlich hergestellte Ähnlichkeitsrelationen, die keine Bilder sind, so dass eine solche Erklärung kaum triftig genannt werden kann. Bevor ich z.B. beim Rorschach-Test Formen deuten kann, muss ich die Tintenkleckse als Bilder sehen. Was heißt das? Wenn ich Tintenkleckse auf einem Papier als Bilder sehe, bedeutet das noch nicht, dass ich etwas darin erkenne. Zunächst sehe ich sie nur als eine Konfiguration von Sichtbarem. Wenn ich in einem öffentlichen Gebäude auf eine schematische Darstellung von Kreisen und Balken treffe, muss ich darin nicht sofort ein «RauchenVerboten»-Zeichen sehen, aber ich muss einen Zusammenhang des geome­ trischen Musters, eine Konfiguration von Formen in einer artifiziellen Präsenz erkennen. Der phänomenologische Ansatz innerhalb der Bildtheorie fokussiert auf den Gegenstand, der sich in der Zeichnung, im Gemälde, in der Photographie etc. zu sehen gibt: in unserem Beispiel also auf den Tintenklecks oder die Balken und Kreise des Verbotsschildes. Darauf zielt Husserls Idee eines Bildobjekts. Mit dem Begriff «Bildobjekt» wird die gesehene Oberflächenstruktur, die Darstellungsform bezeichnet, die das Merkmal von Bildern überhaupt abgeben soll. Ich muss erst die Form des Tintenkleckses sehen lernen, bevor ich ihn z.B. als Fledermaus deuten kann. Dieses Sehen ist daher kein Entziffern von Zeichen, es ist nicht schon von einer Regel oder einem Schema geleitet, sondern zunächst die Entfaltung eines Gegenwartsbewusstseins, das sich auf einen imaginären Gegenstand richtet. Dieser Gegenstand, also das, was Husserl «Bildobjekt» nennt, repräsentiert nicht. Es nimmt auf keinen äußeren Gegenstand Bezug, sondern zeigt Eigenschaften des Aussehens.6 Für Husserl geht das Bild erst aus den Akten des Ich hervor, das im Bildträger ein Bildobjekt erkennt. Jedoch gibt es bei Husserl eine Ausnahme: Die Wachspuppe, die nicht als Bild fungiert: Die Wahrnehmung des Puppendinges ist also nicht Unterlage eines Abbildungsbewusstseins; vielmehr erscheint bloß in eins mit der Puppe zugleich die Dame: zwei perzeptive Auffassungen, bzw. zwei Dingerscheinungen durchdringen sich, nach einem gewissen 6 Vgl. Wiesing (2005), 36. 131 Erscheinungsgehalt sich sozusagen deckend. Und sie durchdringen sich in der Weise des Widerstreites, wobei der aufmerkende Blick bald dem einen, bald dem anderen der erscheinenden, aber sich im Sein aufhebenden Objekte zuwenden kann.7 Der phänomenologische Ansatz beschreibt einen Prozess, bei dem das Bildobjekt in der Wahrnehmung aus sichtbaren Formrelationen generiert wird. Das Erscheinen eines Bildobjektes ist diesem Ansatz zufolge der wesentliche Unterschied zwischen einem Bild und jedem anderen Artefakt. Dabei disqualifiziert er jedoch ebenso wie der semiotische Ansatz das physische Bild als bloßen Bildträger, als Medium. Vom Bildmedium kann gesagt werden, dass es die Sichtbarkeit des Bildobjektes bedingt und zugleich dessen mögliche Verbreitung und Kommunikation. Das Medium materialisiert, speichert und überträgt das Bild. Es beeinflusst, wie das Bildobjekt gesehen werden kann. Es hätte aber nur eine technische Bedeutung, wenn es keine Bilder tragen und übertragen würde, wie die leere Leinwand oder der ausgeschaltete Fernseher. Daher rührt die Rede vom bloßen Bildträger. Gernot Böhme zufolge ist das Bild nicht an einen bestimmten materiellen Träger gebunden.8 Aus dieser Warte ist es gleichgültig, ob ich die Mona Lisa auf einem T-Shirt, einem Poster, einer Kaffeetasse oder im Louvre sehe, solange es nur dieselbe Mona Lisa ist. Dieser Ansatz berücksichtigt folglich auf Seiten des Bilddinges lediglich die transparente Infrastruktur, das Sinnfällige, und vernachlässigt seine opake Materialität im Übrigen vollständig. Weil der zeichentheoretische und der phänomenologische Ansatz aber nur die sinnfällige Formkonfiguration als bildkonstitutiv betrachten, disqualifizieren sie nicht nur das Bildding zum bloßen Bildträger, sondern sie verkürzen auch das sich dem Bildbewusstsein zeigende Bild auf die Geltung des gesehenen Bildobjekts, d.h. auf das Bestimmbare. Wichtig für die Konstitution des Bildes sind aber ebenso das Nicht-Sichtbare wie das Opake. Dass mir beim Rohrschach-Test eine schwarzgraue Konfiguration mit fledermaus- oder schmetterlingsähnlichen Zügen auffällt, gelingt nur, wenn 7 8 Husserl (1913), 443. Siehe auch 54, 172, 422f., 501. Und Husserl (1980), 1–108. Böhme (1999), 9, 46. 132 ich es vom bedeutungslosen weißen Umfeld abgrenze, das aber ein ebenso notwendiger Teil des Bildes ist, ohne den ich nichts erkennen könnte. Bevor wir sie in Form und Medium zerlegen, sollten wir berücksichtigen, dass Bilder vor allem Dinge sind: Dinge, die ein eigentümliches Spiel mit unserer Wahrnehmung anfangen, wie der leuchtende Kasten, den wir sehen, bevor wir ein Testbild erkennen. Anstatt lediglich auf eine mediale Pragmatik, auf sinnfällige Strukturen bzw. dargestellte Objekte zu fokussieren, sollten wir das Bild insgesamt gerade in seiner Unbestimmtheit in den Blick nehmen. Und anstatt Bilder als nur sichtbare Zusatzwelten zu betrachten, sollten wir die Wirkmächtigkeit der physischen Bilder kritisch überprüfen. Wenn der zeichentheoretische Ansatz den alltäglichen Bildgebrauch durchaus zu erklären vermag und der phänomenologische Ansatz beschreibt, inwiefern sich mir im Bild etwas Phantomartiges, ein Bildobjekt, darbieten kann, so schlage ich vor, noch eine Schicht darunter anzusetzen, dort, wo das Bildding und das Bildobjekt ununterscheidbar ineinander übergehen. Wenn wir das Bild vom Bildding ausgehend zu begreifen versuchen, so müssen wir in der Lage sein zu erklären, was dieses Bildding mit anderen Dingen gemein hat, so dass es als Ding unter Dingen, unabhängig von der Wahrnehmung und der kommunikativen Pragmatik, sein kann. Das bedeutet nicht, dass die Wahrnehmung nicht ebenso konstitutiv für das Bildding ist wie für Sternbilder oder für Musik, für die die Unterscheidung Konstellation und Lichtfleck oder Klang und Geräusch auch nicht ohne ein kulturspezifisches Wahrnehmungsraster zu haben ist. Und doch werden sie in ihrem Zusammenhang nicht erst durch die Wahrnehmung hervorgebracht. Diesem Bildding sind andererseits bestimmte Eigenschaften oder Gestaltungsmerkmale zueigen, die es von anderen Dingen unterscheiden und die auf besondere Weise wirken. Bilder definiert Klaus Sachs-Hombach für den semiotischen Gebrauch als artifiziell, flächig und dauerhaft. Diese Kategorien sind allerdings zu eingeschränkt: Das Kriterium des Artifiziellen gilt nicht für Spiegel- und Schattenbilder, die Annahme, dass Bilder vor allem flächig sein müssen, sortiert skulpturale und plastische Bilder aus;9 das Merkmal der 9 Siehe Sachs-Hombach (2003), 74ff. Zur Kritik an dieser Definition, siehe Schulz (2005), 83f. 133 Dauerhaftigkeit gilt nicht für ephemere und prozessuale Bildphänomene wie den Film. Auch Alexander Calders Mobiles zeigen Rückseiten, Grundstrukturen, Tiefenschichten und Bedingungen für die Sichtbarkeit von Flächen in momentanen Konstellationen, die mal diese, mal jene Figur der Instabilität und des Übergangs evozieren. Das Bildding ist nicht nur ein beliebiger Träger eines Bildobjektes. Vielmehr ist es gekennzeichnet durch Materialität, Dimensionalität und Licht. Die Materialität zeigt sich oft im Zusammenspiel von Farben und Textur, die Dimensionalität als Begrenztheit und Flächigkeit, das Licht in Beleuchtung, Glänzen und Schatten. Selbst dort, wo, wie im Falle des vermeintlich digitalen Bildes, das Bild aus nichts anderem generiert wird als einem Zahlenwert, treten diese Parameter zusammen, wenn uns ein Bild vor Augen tritt, wie flüchtig auch immer. Ähnlich wie sich das Geräusch mit dem Gehör verschränkt, so dass sich Klänge und Töne ergeben können, so gehen gesehene Gebilde aus einer Art Bild-Granulat hervor, das die Sicht affiziert. Die Wirkmächtigkeit des aus Materialität, Dimensionalität und Licht zusammengesetzten Bilddinges lässt sich deshalb weder auf die Attraktivität des Trägermediums noch auf eine strukturierte Oberfläche reduzieren. Bei wissenschaftlichen Bildern, aber auch bei jeder Urlaubsphotographie ist nicht nur das wichtig, was zu sehen ist, sondern zunächst: dass es sie, als Bilddinge, gibt. Schon hier, in diesem Auftreten und Sich-Manifestieren, und nicht erst im Zeigen liegt die spezifische Wahrheitsfähigkeit der Bilder. Materialität, Dimensionalität und Licht zusammengefügt, veranlassen das Sich-Ereignen der Bilddinge in der Wahrnehmung. Sie konfigurieren eine visuelle Kraft, die für Bilder kennzeichnend ist. Die Physis des Bildes materialisiert sich temporär. Dies kann am Besten beobachtet werden, wenn man Akte der Bildherstellung analysiert. Derartige Bildakte, wie man sie von kleinkindlichen Kritzeleien her kennt, zielen nicht oder nicht notwendig darauf, etwas abzubilden, sondern gehen in der Explosion der Farben und Formen, im Prozess des Welterschaffens auf. Weil Bilder weder statische Oberflächen sind, die plötzlich aus dem Nirgendwo vor uns auftauchen, noch Mengen visueller Symbole, die eine Bedeutungsintention zusammenfügt, sollten wir die Handlungsfähigkeit genauer 134 untersuchen, die sich auf den verschiedenen Ebenen in der Begegnung mit Bildern ins Spiel bringt. Ich schlage vor, dabei vier Prozesse zu differenzieren: I. Verkörperung Das Verkörpern ist ein räumlicher Figurationsprozess. Bilder exponieren sich in einer Ausstellungsarchitektur. Bevor sie als durchsichtiges Medium fungieren können, müssen sie zunächst einmal selbst als Materialkonstellation im Raum aufgefasst werden. Bilder treten uns im Kontrast zu ihrer Umgebung als solche entgegen und ziehen uns in ihre Gegenwart. Weil sie in Opposition zum Raum der Betrachtung stehen und daher nie unabhängig von diesem Kontrast als Bilder gesehen werden können, bringen sie eine besondere Erfahrung mit sich. Bilder sind dann nicht bloß Abbilder, Trugbilder, Illusionen, Repräsentationen. Sie sind auch nicht nur opake Medien.10 Als Verkörperungen sind sie Präsentationen physischer Dinge, sie sind welterschaffend, weil sie eine neue Sichtweise in die Welt bringen. Wie kommt es, dass wir nicht nur «im Bild» Wirklichkeit sehen, sondern dass die Wirklichkeit des Bildes selbst uns in spezifischer Weise entgegen tritt? Wie kommt es, dass wir, etwa im Falle des Dokumentarfilms oder auch der entlarvenden Photographie, aller Einsicht in die Manipulierbarkeit von Bildern zum Trotz diesen eine Evidenz zusprechen, weil sie uns etwas zu erkennen geben? Bilder sind Dinge in Aktion. Zwischen der allgemeinen Bildhaftigkeit der Dinge, die als Dinge einander ähneln und füreinander einstehen können, und den gemachten Bildnissen stehen die imaginativen Dinge – natürliche Konstellationen wie Spiegelungen, Wolkenformationen, Vogelschwärme, Farbflächen, aber auch Straßenszenen, in denen Unübersichtlichkeit und Versammlung ineinander übergehen. Diese momentanen Konstellationen, Verstörungen und Übergänge sind unwillkürlich entstehende Bilder, die nichts anderes zeigen als den Prozess ihrer Figuration. Hieran wird deutlich, dass an der Bildwerdung nicht nur die subjektive Einbildungskraft oder die künstlerische Technik, sondern auch die Akte der Dinge Anteil haben. 10 Zur Opazität als Teil der Repräsentation siehe Marin (2005); und Ders. (2001), 51f. 135 Wenn man die Installation des Ateliers von Fischli und Weiss in einer ihrer Ausstellungen gesehen und diese Arbeit womöglich schon als ready made abgebucht hat, bemerkt manch ein Besucher erst beim Hinausgehen, mit Blick auf das die Konstruktionsmaterialien aufzählende Schild, dass alles aus Polyurethan nachgebaut wurde. Die Farbtöpfe, das Radio, die Zigaretten, die Asche – alles aus Plastik. Dass es sich um Bilder handelt, bemerkt man daher erst, wenn man den Unterschied zur Replik oder zur Kopie erfasst hat. Verfremdung und Unähnlichkeit sind daher wesentliche Züge, die Bilder qualifizieren. So liegt Bildern eine vielschichtige Erscheinung zugrunde, die auf einem ereignishaften, plötzlichen Verkörperungsprozess aufbaut. Die Erscheinung dieses Körpers baut auf Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten mit anderen gegenwärtigen Dingen auf. Darauf mag sich eine intuitiv künstlerische Ähnlichkeitsrelation entfalten (a = b), eine imaginativ konventionelle Ähnlichkeitsrelation (a = a) oder eine symbolische Bezugname (a = x). II. Negation Dieser Verkörperungsakt ist zugleich eine Unterbrechung des alltäglichen Erfahrungskontinuums. Das Bildding stellt sich entgegen und grenzt sich ab, z.B. durch Rahmungen. Es kaschiert, was hinter ihm liegt, es negiert die Existenzweise der Welt, in der es erscheint. Durch die negative Arbeit des Bildes, sagt Georges Didi-Huberman, verliert der Blick des Betrachters seinen Halt in der unmittelbaren Erscheinungswelt.11 Das Visuelle des Bildes bricht in die Sichtbarkeit der Welt ein. Die Imagination der Betrachter wird von diesem Fremdkörper angezogen und destabilisiert. Das Bild negiert auf mindestens fünf verschiedenen Ebenen: a) Es negiert die Welt, aus der es heraussticht, b) es negiert auf der Ebene seiner Struktur, wenn es zum Beispiel aus einem Widerspruch hervorgeht, der als Unterschied von Grund und Oberfläche wahrnehmbar ist, c) es bietet eine Oberfläche als Raum der Erscheinungen dar, d) dieser Raum wird wiederum durchkreuzt 11 Didi-Huberman (1990). 136 von Gestalten aus einem imaginären Tiefenraum, die sich zu Zeichen verdichten können. Schließlich e) kann es auf Abwesendes verweisen. Das bedeutet auch, dass die Vorstellung zu kurz greift, derzufolge Bilder überhaupt definiert werden können als Darstellungen dessen, was sie selbst nicht sind.12 Bilder sind nicht erst durch die Abwesenheit dessen gekennzeichnet, was sie darstellen, denn die Möglichkeit einer Negation des Gegenstandes durch das Anschauungsphänomen hängt nicht nur von der Reflexion des Betrachters ab. Die imaginative Leistung des Betrachters baut auf den strukturellen Negationen des Bilddinges auf. Derartige Negationen zeichnen selbst solche Bilder aus, die die reale Präsenz dessen beanspruchen, was sie darstellen. III. Abdruck Die Materialität der Bildnisse zeigt die Spur eines Ereignisses, einer Kraft oder eines abwesenden Dinges. Schattenwürfe und Photographien sind Körperspuren, Abdrucke, Oberflächen, in denen sich verschiedene Energien einprägen. Auf diese Art und Weise können Bilder für uns nichtwahrnehmbare Strahlungen sichtbar machen (z.B. Wärme-, magnetische oder radioaktive Strahlung). So basiert nicht nur die «Vera Icon», sondern auch die Darstellung des Gehirns in der Magnetresonanztomographie auf diesem im Abdruck bewahrten Kontakt. Das Bild bewahrt die Form seiner Prägungskräfte, bildet sie nach. Die diagnostische Evidenz der Bilder des Gehirns belegt, dass Bilder als Spuren gelesen werden können, in denen sich erkenntnisrelevante Prozesse abdrücken.13 Die Spur der Gestaltung weist, als geschichtetes Material, einen historischen Index auf. Darin zeigt sich nicht nur Autorschaft. Es ist auch ein Abdruck der Zeit.14 Die Produktion von Bildern ist ein Prozess, bei 12 Brandt (1999), 10. Die Negation sei Sache der Anschauung, nicht der Gestaltung: «Erst durch diese reflektierte Negation des Betrachters selbst gibt es Bilder» (Ebd., 106). 13 Hagner (1994) und (1996). 14 Lazzarato (2002), 14f.: «Die Zeitkristallisationsmaschinen arbeiten im Inneren dieser Zeitlichkeit: sie repräsentieren die Welt nicht, sie kristallisieren sie durch Kontraktion und Ausdehnung der Zeit und tragen so zu ihrer Konstitution bei. Aber um dieses neue Verhältnis von Körper und Geist zu begreifen (wie der Geist auf den Körper wirkt und 137 dem Zeit eingefangen, verdichtet oder aufgetrennt und fragmentiert wird. Dieser Prozess prägt das Bild als Abdruck; es ist Zeugnis seiner Entstehungsgeschichte und bildet nicht zuletzt dadurch Geschichte ab. Arthur Goodspeed hat – darauf hat Peter Geimer eindrücklich hingewiesen – im Jahr 1890 das erste Röntgenphoto der Welt hergestellt, ohne es gewollt oder bemerkt zu haben. Goodspeed hatte im Verlaufe seiner Experimente an der Induktionsmaschine die Funkenentladung direkt auf Photoplatten aufgenommen und dabei auch elektrisch aufgeladene Münzen verwendet. Nach der Entwicklung dieser Platten hatte er diese seltsamen Scheiben gesehen und die Platten daher gesondert aufbewahrt, ohne sie sonderlich zu untersuchen. Als fünf Jahre später die Arbeit «Über eine neue Art von Strahlen» Wilhelm Conrad Röntgen weltweit bekannt machte, ging Goodspeed zurück in sein Laborarchiv, nahm die alten Photoplatten heraus und verstand, dass er unabsichtlich die ersten Röntgenphotos geschaffen hatte.15 Mit dieser Erkenntnis ändert sich aber nicht nur der Blick auf die Photoplatten oder ihre Sichtbarkeit. Er hatte diese Platten aufbewahrt, weil sie merkwürdige Spuren und Muster zeigten. Erst später fand er heraus, dass sie etwas abbildeten. Manchmal dauert es Ewigkeiten, bis die Bilddinge so gesehen werden können, wie es ihnen entspricht. Auch einzelne Details, die im Bild immer schon vorhanden waren, werden erst Ewigkeiten später wahrgenommen. Aber das Bild stellte sie immer schon vor Augen, und zog nur deshalb die Aufmerksamkeit auf sich. Gleichwohl ist nicht jedes Detail bedeutsam. Was Georges Didi-Huberman mit dem Begriff des «pan» belegt, ist der Ort in einem Gemälde, der das System der Darstellung unterbricht. Es ist ein reines Ereignis der Farbe, wie das kleine rote Rinnsaal unter Vermeers Spitzenklöpplerin. Ähnlich wie das punctum Roland Barthes zufolge die photographische Repräsentation, das studium, bedingt, lässt sich keine Darstellung auf dem Gemälde denken, an der nicht an irgendeiner Stelle die Farbe selbst unterhalb der Darstellung hervorträte. Das Hintergründige und das Opake sind Teil der Bildkonstitution. Ebenso wie das Unsichtbare, die Rückseite des umgekehrt), muss man jede Theorie der Repräsentation, die das Sein in Reales und Bild spaltete, ebenso aufgeben wie jede Phänomenologie, die die Objekte in den Raum und die Bilder in den Geist verlegt». 15 Siehe Geimer (2002), 331f. 138 Sichtbaren, die vermeintlich kontingenten Eigenschaften des Abgebildeten. Diese sind kein «visueller Lärm», den es herauszufiltern gälte, sondern das, was ein Bild ausmacht. Denn Bilder sind keine künstlichen Welten, in denen wir versinken, sie sind keine Kopien oder Klone. Dies wird schon in Wittgensteins Bildtheorie des Satzes deutlich. Denn Wittgenstein unterstreicht, dass neben der Logischen Form (der kohärenten Struktur), der Form der Abbildung (der Ähnlichkeit) auch die Form der Darstellung (der Unähnlichkeit) in Betracht gezogen werden muss, damit etwas als Bild fungieren kann. Bilder unterscheiden sich, im Prozess des In-Erscheinung-Tretens, von dem, dessen Spuren sie tragen. Es ist daher nicht erforderlich, ein permanentes doppeltes Bildbewusstsein zu unterstellen, das zwischen Bildträger und Bildobjekt hin und her wandert. Es ist ein geschichteter Prozess. Bevor wir das Bild in seiner Gegenwart wahrnehmen, müssen wir es antizipieren. Im Ereignis der Wahrnehmung tritt das Bild als Zukünftiges in eine Erwartung. Die Antizipation ist Teil des Imaginationsprozesses, bei dem die Aufmerksamkeit das Bild abtastet, auf verschiedene Aspekte fokussiert und die Details zu einem Ganzen zusammensetzt. Dieses Bildsehen wird gespeist von einem Vorratsspeicher an Bildern, die aus der Erinnerung abrufbar sind oder die, um in die Gegenwart der Aufmerksamkeit zu gelangen, getilgt und vergessen werden müssen. Neben diesen produktions- und rezeptionsästhetischen Momenten ist die Zeitlichkeit des Bildes selbst Grundlage seiner Wahrheitsfähigkeit: Die Bild-Zeit ist ein Augenblick, der sich in einer Dauer entfaltet, sie ist ein Ereignis, das sich aus Serien von Blickfragmenten in einer Montage zusammensetzt. Die Bild-Zeit ist ein Werden und Fließen, in dem plötzlich ein Jetzt steht und die Erfahrung staut. Wenn zu den Merkmalen des Bilddinges daher nach der Verkörperung und der Negation nun noch der Abdruck gerechnet wird, so impliziert dies folglich weder eine Abbildungsrelation noch die These eines Kausalverhältnisses zwischen der Darstellung eines Dinges x und desselben Dinges x als relevanter Ursache der Darstellung. Dies ist beispielsweise bei einer überbelichteten Photographie der Fall, die weder die Lichtquelle abbildet noch darstellt und doch Aufschluss über die Situation ihrer Entstehung bietet. Der Abdruck lenkt den Blick auf die Oberfläche. 139 IV. Bildung Ein Bild ist eine Setzung. Es verknüpft heteronome Eigenschaften von Dingen in einer Situation und gibt damit, anders als andere Dinge, vor, wie es zu betrachten ist, damit man es sieht. Indem es größere physische Aufmerksamkeit als andere visuelle Objekte, eine kultivierte Sorge der Annäherung und eine trainierte Imagination stimuliert, sind Bilder sowohl leichter zugänglich als auch schwieriger zu verstehen als andere kulturelle Artefakte. Je mehr man über Bilder weiß, desto mehr erfährt man, dass man erst lernen muss, wie man sie anzusehen hat. Ihre Physis zwingt uns dazu, die Dinge anders anzusehen, nämlich mehr als Potential und Reservoir denn als Funktionsgerät. Sie erheben Anspruch auf eine Ethik des Blicks, die den Bedingungen ihrer schieren Existenz nachspürt, um zu begreifen, dass wir Teil des Bildes sind, wenn wir es ansehen. Literatur Böhme, Gernot. Theorie des Bildes, München 1999. Brandt, Reinhard. Die Wirklichkeit des Bildes. Sehen und Erkennen – Vom Spiegel zum Kunstbild, München 1999. Cassirer, Ernst. Philosophie der symbolischen Formen, Bd. 11, Hamburg 2001. Didi-Huberman, Georges. Devant l’image, Paris 1990. Geimer, Peter. «Was ist kein Bild? Zur ‹Zerstörung der Verweisung›». In: Ders. (Hg.). Ordnungen der Sichtbarkeit, Franfurt a.M. 2002. Goodman, Nelson. Sprachen der Kunst. Ein Ansatz zu einer Symboltheorie, Frankfurt a.M. 1995. Hagner, Michael. «Hirnbilder. Cerebrale Repräsentationen im 19. und 20. Jahrhundert». In: Michael Wetzel / Herta Wolf (Hg.). Vom Entzug der Bilder, München 1994, S. 145–160. Hagner, Michael. «Der Geist bei der Arbeit. Überlegungen zur Visualisierung cerebraler Prozesse». In: Cornelius Borck (Hg.). Anatomien medizinischen Wissens, Frankfurt a.M. 1996, S. 259–286. 140 Huber, Hans Dieter. Bild, Beobachter, Milieu. Entwurf einer allgemeinen Bildwissenschaft, Ostfildern 2004. Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, Bd. 2/1, Tübingen 1913. Husserl, Edmund. «Phantasie und Bildbewusstsein». In: Husserliana XXIII, Den Haag 1980, S. 1–108. Lazzarato, Maurizio. Videophilosophie, Berlin 2002. Marin, Louis. Über das Kunstgespräch, Zürich / Berlin 2001. Marin, Louis. Das Opake der Malerei. Zur Repräsentation im Quattrocento, Zürich / Berlin 2005. Sachs-Hombach, Klaus. Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft, Köln 2003. Scholz, Oliver R. Bild, Darstellung, Zeichen, Freiburg 2002. Schulz, Martin. Ordnungen der Bilder, München 2005. Schwemmer, Oswald. Kulturphilosophie. Eine medientheoretische Grundlegung, München 2005. Seel, Martin. Ästhetik des Erscheinens, München 2000. Wiesing, Lambert. Artifizielle Präsenz, Frankfurt a.M. 2005. 141 Bilderschwund. Forschen mit optischen Datenquellen Christoph Hoffmann Vor einiger Zeit erhielt ich ein kleines Paket zugestellt. Der Inhalt: zehn CD-ROMs und ein dickes Bündel Papier. Auf den Datenträgern waren mehrere Stunden Videoaufzeichnungen aus verschiedenen biowissenschaftlichen Experimenten mit Insekten und Fischen gespeichert. Die beiliegenden Papiere lieferten teils Beschreibungen des Versuchsaufbaus und Angaben über die Forschungsziele, teils handelte es sich um Notizen und Protokolle aus dem Versuchsbetrieb. Das vor mir ausgebreitete Material stellte nur einen winzig kleinen Ausschnitt aus der Gesamtmenge von Aufzeichnungen dar, die der Zürcher Künstler Hannes Rickli seit den 1990er Jahren aus verschiedenen biowissenschaftlichen Laboratorien zusammengetragen hatte; anfangs noch aus Mülleimern, nachher über eine eigene Schnittstelle direkt von den Forschungsservern. Hieraus entstanden eine Reihe von Installationen, die im Herbst 2009 im Helmhaus in Zürich zu sehen waren, sowie ein großer Band, in dem das Material aus verschiedenen Perspektiven diskutiert wurde.1 Auf den Inhalt des erwähnten Pakets werde ich später zurückkommen. Für den Augenblick soll mir die geschilderte Szene nur gestatten, das Wort «Bilderflut» aufzugreifen. Denn was sich auf meinen Schreibtisch ergossen hatte, war in der Tat eine Bilderflut. Dieses Paket war nicht zufällig an mich adressiert. Hannes Rickli hatte mir im Rahmen seines Projekts Videogramme die Aufgabe zugedacht, aus der Sicht der Wissenschaftsgeschichte einen Kommentar zu dem Material zu schreiben. Er hätte aber im deutschsprachigen Raum ebenso gut ein Dutzend anderer Kolleginnen und Kollegen um diesen Gefallen bitten können. Denn kaum etwas hat in der jüngeren Wissenschaftsgeschichte und -forschung mehr Konjunktur 1 Vgl. Rickli (2011). 143 gehabt, als die Beschäftigung mit den Bildwelten der Natur- und Lebenswissenschaften. Skizze und Zeichnung, Diagramm, Graph, Holzschnitt und Lithografie, Fotografie, Röntgenapparat, CT und MRT, Film, Nebelkammer, CCD-Sensoren, Computergrafik, alle diese Verfahren und zahllose andere sind in den letzten dreißig Jahren ausgiebig in ihrem Einsatz im Forschungsprozess, in der Darstellung von Forschungsergebnissen und bei der Popularisierung wissenschaftlichen Wissens untersucht worden.2 Die Bilderflut auf meinem Schreibtisch lässt sich so betrachtet metonymisch für die inzwischen kaum mehr übersehbare Zahl von Publikationen zu diesem Thema nehmen. Es spricht für sich, dass Bruno Latours Aufsatz Drawing things together aus dem Jahr 1990 und Lorraine Dastons und Peter Galisons Aufsatz The Image of Objectivity aus dem Jahr 1992 zu den Texten gehören, die im Bereich der Wissenschaftsforschung in den letzten zwanzig Jahren am häufigsten zitiert worden sind.3 Auf den ersten Blick ist dies das Ergebnis einer gewandelten Erkenntnisabsicht.4 Mitte der 1970er Jahre begannen einige aus der Soziologie und Philosophie versprengte Forscherinnen und Forscher damit, die Naturwissenschaften etwa so zu untersuchen wie die Ethnologie eine fremde Kultur. Man bezog Posten in den Laboratorien, schaute den Akteuren bei ihren Experimenten und Messungen zu, befragte sie über ihre Verrichtungen und nahm an den Meetings teil. Etwas Ähnliches geschah in der Wissenschaftsgeschichte, wo man nun die Studien nicht mehr allein aus der Bibliothek heraus schrieb, sondern in die Archive eintauchte und aus den Hinterlassenschaften des Experimentierens und Beobachtens Fallgeschichten der Forschungsarbeit zusammensetzte. Diese Verschiebung ist unter einigen Formeln bekannt: etwa praktische Wende, Science in Action, Investigative Pathways oder Eigenle2 3 4 Hier eine kleine, nicht repräsentative Auswahl aus der Literatur: Fyfe / Law (1988); Lynch / Woolgar (1990); Le Grand (1990); Taylor / Blum (1991); Galison (1997); Jones u.a. (1998); Heintz / Huber (2001); Hennig (2001); Geimer (2002); Gugerli / Orland (2002); Dommann (2003); Francoeur / Segal (2004); Hinterwaldner / Buschhaus (2006); Landecker (2006); Voss (2007); Bredekamp u.a. (2008); Burri (2008); Wittmann (2008); Adelmann u.a. (2009); Wilder (2009); Nasim (2010). Vgl. Latour (1990) und Daston / Galison (2002). Vgl. hierfür Hagner (1997). 144 ben des Experiments. Dabei kamen unterschiedliche methodische und theoretische Konzepte ins Spiel, die sich aber in dem einen Punkt trafen, dass man beabsichtigte, um eine weitere gern gebrauchte Wendung zu benutzen, die black box Wissenschaft zu öffnen, die Wissenschaftswirklichkeit zu erfassen und nach den Umständen und Bedingungen der Geltungskraft von Erkenntnissen am Ort ihrer Entstehung Ausschau zu halten. Bei diesem Gang in die Praxis stellte sich heraus, dass ein ganz erheblicher Teil der wissenschaftlichen Arbeit anscheinend darin bestand, alle möglichen Arten von grafischen Aufzeichnungen zu erstellen und zu bearbeiten. Der eben schon erwähnte Bruno Latour berichtet rückblickend über seine erste, zusammen mit Steve Woolgar durchgeführte Studie Laboratory Life aus dem Jahr 1979: I was struck, in a study of a biology laboratory, by the way in which many aspects of laboratory practice could be ordered by looking not at the scientists’ brains (I was forbidden access!), at the cognitive structures (nothing special), nor at the paradigms (the same for thirty years), but at the transformation of rats and chemicals into paper (...). Focusing on the literature, and the way in which anything and everything was transformed into inscriptions, was not my bias, as I first thought, but was for what the laboratory was made.5 Beobachtungen wie diese legen nahe, dass das große Interesse der neuer­en Wissenschaftsforschung an allen möglichen Verfahren der Aufzeichnung – die Latour letztlich im Sinn hat, wenn er von «Inskriptionen» spricht – einfach nur deren Bedeutung in der Wissenschaftspraxis widerspiegelt. Die Bilderflut auf meinem Schreibtisch stünde demnach für den Normalbetrieb der Forschung ein. Ins Grundsätzliche gewendet begegnet dieser Punkt bei Hans-Jörg Rheinberger. In einem jüngst erschienenen Aufsatz bemerkt er einleitend: «Es ist wohl nicht zu weit hergeholt, wenn man behauptet, dass das Sichtbarmachen von etwas, das sich nicht von sich aus zeigt, das also 5 Latour (1990), 21f. 145 nicht unmittelbar evident ist und vor Augen liegt, den Grundriss und Grundgestus der modernen Wissenschaft überhaupt ausmacht».6 Inskriptionen als das Ergebnis von Prozessen der Sichtbarmachung wären nach dieser Auffassung nicht etwas, das zum Forschungsprozess nur hinzutritt. Inskriptionen wären vielmehr das erste Werkzeug des Forschens, unter dessen Gebrauch Phänomene und Vorgänge im Labor oder im Feld als Objekte der Forschung materiell verfügbar würden. Es fällt auf, dass weder Latour noch Rheinberger von Bildern oder Abbildungen sprechen. Stattdessen tauchten zwei andere, nahestehende, aber deutlich abgrenzbare Begrifflichkeiten auf: Zunächst war von Inskriptionen die Rede, dann von Sichtbarmachung. Daraus folgt nicht, dass Latour und Rheinberger Bilder, was auch immer damit im Besonderen bezeichnet wird, aus ihren Überlegungen ausschliessen. Diese werden nur einfach einer grösseren Klasse von Objekten beziehungsweise Praktiken subsumiert. Inskriptionen können auch Bilder sein und Sichtbarmachung kann auch in Bildern resultieren. Dennoch liegt man nicht ganz falsch, wenn man vermutet, dass hier absichtlich ein Bogen um den Ausdruck «Bild» geschlagen wird. Warum dies so ist, macht das folgende Statement deutlich: «Dort, wo es zur wissenschaftlichen Repräsentation kommt, sind wir also immer schon jenseits des Bildes als Abbild».7 In diesem «immer schon» drückt sich unübersehbar die sprachliche Geste der Dekonstruktion aus, mit der gerne liebgewonnene Gewissheiten verabschiedet werden. Und es ist auch bereits der Begriff gefallen, der die verwaiste Stelle einnimmt: der Begriff der Repräsentation. Die Gegenüberstellung von Repräsentation und Abbild deutet an, dass es mit diesem Begriff in unserem Kontext eine besondere Bewandtnis hat. Das eben zitierte Statement stammt aus einem Aufsatz Rheinbergers über Repräsentationen in der Molekularbiologie, dessen Titel in Anlehnung an Kleists berühmte Formel aber ebenso gut auch lauten könnte: Über das allmähliche Verfertigen von Wissenschaftsobjekten durch Verrichtungen des Repräsentierens. Denn in der Forschungspraxis kommt Repräsentieren nach Rheinbergers Ausführungen – und von dort weiter ausstrahlend auf das Feld der Wissen6 7 Rheinberger (2009), 127. Rheinberger (1997), 271. 146 schaftsstudien – «dem Wirklichwerden einer Sache» gleich, in dem Sinne beispielsweise, in dem in der Chemie von der Darstellung eines Stoffes gesprochen wird.8 Geht man hiervon aus, dann ist klar, dass mit Repräsentation nicht mehr herkömmlich ein Stellvertreterverhältnis bezeichnet wird, dass man vielmehr mit Repräsentation ein Handeln meint, eine «repräsentati­onale Aktivität», wie Michael Hagner das einmal genannt hat,9 in deren Ablauf repräsentiertes und repräsentierendes Objekt ineinander verwickelt sind. Bedient man sich im Forschungsprozess beispielsweise der Fotografie, dann liegt deren Bedeutung nicht zuerst darin, einen Sachverhalt festzuhalten, vielmehr bildet sich dieser Sachverhalt erst im Fotografieren und wenigstens zum Teil von den Bedingungen des Verfahrens gelenkt aus.10 Weiter zugespitzt folgt daraus, dass mit Repräsentieren mehr noch als ein Werkzeug ein Exis­ tenzmodus heutiger Forschung bezeichnet wird. Eben dies war ja bereits in Rheinbergers Feststellung angeklungen, dass Sichtbarmachen «den Grundriss und Grundgestus der modernen Wissenschaft überhaupt ausmacht». Es ist sicher nicht zu viel gesagt, dass Repräsentation in den Wissenschaftsstudien einige Zeit ein Kampfbegriff gewesen ist. In Reaktion hierauf hat der Wissenschaftsforscher Michael Lynch 1994 einen Aufsatz mit dem schönen Titel Representation is Overrated publiziert; vielleicht nicht ganz selbstironisch, denn vier Jahre früher, 1990, hatte Lynch den wegweisenden Sammelband Representation in Scientific Practice mitherausgegeben. Lynchs Argument bezieht sich nicht auf Visualisierungen, sondern auf sprachliche Darstellungen und es lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass Sprache im Kontext des Labors mindestens so sehr performativen wie beschreibenden Charakter hat, dass Sprechen hier ebenso dabei hilft, Sachverhalte zu bewerkstelligen wie auszudrücken.11 Der Schlag ging allerdings etwas ins Leere, insofern unter Repräsentation in der Wissenschaftsforschung, zumindest wenn man Rheinbergers Verständnis voraussetzte, ja gerade ein produktiver Prozess begriffen wurde. Nichts an Aktualität verloren hat hingegen Lynchs Forderung, sich klarer zu machen, wovon jedes Mal die Rede ist, wenn wir von 8 9 10 11 Ebd., 266. Hagner (1997), 338. Vgl. am Beispiel der Forschungspraxis von Ernst Mach Hoffmann (2009). Lynch (1994), 141–145. 147 Repräsentation sprechen.12 Selbst dann, wenn mit Repräsentieren explizit nicht Abbilden, Vertreten, Wiedergeben gemeint ist, fällt hierunter immer noch eine Menge ziemlich diverser Praktiken. Ein Stück Gewebe zu präparieren, die Struktur eines Biomoleküls mit Hilfe eines Grafikkits am Bildschirm durchzuprobieren oder die Bahnen von Beta-Teilchen mit der Nebelkammer hervorzubringen, stützt sich jeweils nicht nur auf ganz unterschiedliche Techniken, die damit verbundenen Tätigkeiten stehen auch für ein je anderes «Wirklichwerden einer Sache» ein. Ich will aber nicht die Unterschiede im Einzelnen durcharbeiten, sondern einen ganz bestimmten Punkt herausgreifen. Vielleicht nämlich wird die repräsentationale Aktivität, allerdings anders als Lynch glaubte, in der Wissenschaftsforschung doch überschätzt. Mir scheint, Latour hatte teilweise recht, wenn er, wie zitiert, für einen Augenblick erwog, ob es nur sein bias sei, dass er alle Tätigkeiten im Labor auf das Verfertigen von Inskriptionen zulaufen sah. Vermutlich ortete Latour die Gefahr eines solchen bias darin, dass ihm als Philosophen und Anthropologen Prozesse der «Inskription» gewiss näher stehen als andere Elemente der Laborarbeit, etwa der Umgang mit Ratten und Chemikalien. Ich meine hingegen, dass weniger die disziplinäre Herkunft als das übergeordnete Erkenntnisinteresse den Fokus der Untersuchung möglicherweise beeinflusst hat. Denn mit der Absicht, die Praxis zu erfassen, werden notwendig all jene Aspekte der «Wissenschaftswirklichkeit» privilegiert, die Spuren hinterlassen oder zumindest zur Sprache kommen und dann mittels Notizbuch und Tonband festgehalten werden können. Es liegt entsprechend auf der Hand, dass mit dieser Parteinahme für alles sinnlich Erfassbare solche Forschungsoperationen ins Abseits geraten, die sich nicht in Inskriptionen manifestieren. Wie ich nun an zwei Beispielen zeigen möchte, werfen diese «unsichtbaren» Forschungsoperationen die Frage auf, ob man in Bezug auf sie noch von repräsentationaler Aktivität sprechen kann. Die Tragweite dieser Frage dürfte durch das bisher Gesagte hinreichend umrissen sein. Meine Beispiele haben dabei den Vorteil, dass sie auf den ersten Blick geradezu den Eindruck von Musterfällen repräsentationaler Aktivität machen. Hierin steckt aber, und darin liegt der Vorteil dieser Beispiele, eine lehrreiche Verkennung. 12 Ebd., 148. 148 Ich kehre damit zurück zu der Bilderflut auf meinem Schreibtisch. Wie bereits erwähnt war es meine Aufgabe, zu diesem Material einen Kommentar zu schreiben. Es handelte sich um eine Auftragsarbeit. Ich hatte mir den Gegenstand nicht selbst ausgesucht, er war an mich herangetragen worden. Ich erwähne dies, um klar zu machen, wie die Situation damals beschaffen war. Mich verband nichts mit dem Material außer einer Mischung aus Neugierde und Ratlosigkeit. Als ich die CDs auf dem Videoplayer meines Rechners durchklickte, verstand ich nicht, was ich sah, und die beiliegenden Papiere halfen auch nicht weiter. Nur ansatzweise gelang es mir, die Informationen dort mit den Vorgängen auf meinem Bildschirm in Verbindung zu setzen. Meine Antwort auf diese Situation war ziemlich schlicht. Ich legte nach dem ersten Hineinpicken einen Großteil der CDs beiseite und konzentrierte mich auf ein einziges Experiment: Eine Untersuchung über akus­ tische Kommunikation bei Fischen. Hier sah ich das gesamte mir vorliegen­de Video­material durch, machte mir Notizen und hielt alles fest, was ich für bemerkenswert hielt. Wie sich wenig überraschend in der Diskussion mit dem Leiter des betreffenden Forschungsprojekts herausstellte, waren die Vorgänge und Begebenheiten, die mir aufgefallen waren, für ihn in seiner Arbeit eher Randmomente. Ich hatte also das Material mit den falschen Augen angesehen. Gemeint ist damit zunächst, dass ich das Material nicht so ansah, wie ein Mitglied der Forschungsgruppe. Mit Ludwik Fleck gesagt,13 war ich nicht fähig, es im Denkstil eines Fischökologen zu analysieren. Ich habe es aber auch nicht als Wissenschaftsforscher angeschaut, denn dafür fehlte mir die innere Bindung, die selbst gewählte Forschungsfrage. Ich habe es letztlich so angeschaut wie einen Dokumentarfilm im Fernsehen, in den man beim Zappen hineingeraten ist und sich nun fragt, worum es hier geht. Stellen Sie sich ein Becken vor: Grundriß 2 x 2 m, auf dem Boden liegen einige Zylinder aus Ton, ein Wassereinlauf und ein Hydrofon, das unter die Wasseroberfläche ragt (Abb. 1).14 Darin schwimmt ein Fisch, erst am Rand entlang, dann verkriecht er sich in einer der an beiden Enden offenen Tonröhren, kommt wieder heraus, schwimmt zum Beckenrand, wieder an diesem entlang, 13 Vgl. Fleck (1980). 14 Vgl. für die Versuchsanordnung Rickli (2011), 175. 149 Abb. 1: Hydrofon (heller Punkt am Kabel, unten rechts), Sauerstoffausströmer (unten links), zwei Lautsprecher (unten links, Mitte), Wasserzulauf (oben links), div. Hohlziegel, Steine, zwei Infrarotleuchten (unten links, oben rechts). Screenshot, Akus­tische Kommunikation bei der Trüsche Lota lota, Universität Konstanz, Aufnahmen und Kooperation Philipp Fischer © 2011 Philipp Fischer / Hannes Rickli. dann stößt der Fisch mit einem Gegenstand im Becken zusammen, es gibt ein Geräusch. Die Szene dauert etwa eine Minute. Man schaut sie sich ein zweites und ein drittes Mal an, hält das Bild an, fährt langsam vor und zurück. Offenkundig ist der Fisch mit dem Hydrofon kollidiert. Nun achtet man vielleicht auch auf die Kameraposition und auf das Licht oder man fragt sich, warum sich der Fisch fast immer am Rand des Beckens aufhält oder warum das Becken so leer ist; keine Pflanze, kein anderer Fisch zu sehen. Wichtig ist hieran aber nur, dass nichts von all diesen Überlegungen und Beobachtungen für ein Mitglied der Forschungsgruppe, die mit diesen Aufzeichnungen arbeitet, von Bedeutung wäre. Erst mit der Zeit ist mir jedoch klar geworden, dass 150 es mit den «falschen Augen» noch viel weiter geht. Nicht nur mangelte es mir an der Schulung, um die Videofilme «richtig» in Betracht zu ziehen. Das, was ich getan hatte, dieses stundenlange Hinstarren, war auch nicht das, was die Forscher mit dem Material machten oder zumindest machen würden, wenn das Experiment endlich einmal ordentlich am Laufen wäre. Niemand im Laboratorium würde sich das bis zu 24 Stunden am Tag über Wochen abgespeicherte Material vollständig, durchgängig anschauen – nicht weil dafür keine Zeit wäre, das auch, sondern weil an dem Material nur Bruchteile von Sekunden interessieren. So gab es auch in dem Ausschnitt, von dem ich eben berichtet habe, gar nichts zu bemerken. Aus der Art, wie ich mich zu dem Material verhalten habe, geht hervor, dass ich doch nicht einfach als unbeleckter Ignorant hingeschaut habe, sondern in die Falle meiner Profession getappt bin. Ich habe die Videoaufzeichnungen vorbehaltlos für Zeugnisse repräsentationaler Aktivität genommen. Dabei habe ich zunächst, dumm genug, nicht berücksichtigt, dass es in der Untersuchung nicht um ein visuelles Phänomen geht, sondern um ein akustisches, um die sogenannten «Fischtöne» – einer wird als Tok-tok bezeichnet, andere als Knurren, Quak und Knarren – und um die mögliche Funktion dieser Fischtöne als Kommunikationsträger. Im Mittelpunkt steht deshalb die synchron zum Bild aufgezeichnete Tonspur. Aber auch diese wird keineswegs komplett durchgehört, sondern vorab am Rechner auf interessante Frequenzmuster abgesucht. Erst wenn ein solches gefunden wird, kommt das Bild ins Spiel. Zunächst wird nachgeschaut, welche Ursache das zum Frequenzmuster gehörende Geräusch hat, ob es von den technischen Einrichtungen im und um das Versuchsbecken herum herrührt, ob es unabsichtlich durch den Fisch im Becken verursacht worden ist, wie in dem geschilderten Ausschnitt durch den Zusammenstoss mit dem Mikrofon, oder ob es sich tatsächlich um einen Fischton handelt. Die Sache ist aber noch komplizierter, da man auch nicht weiß, welche der Geräusche, die der Fisch aktiv von sich gibt, Kommunikationsträger sind. Im Blick aufs Bild interessiert deshalb in den Fällen, in denen das Geräusch vom Fisch stammt, weiter, ob gleichzeitig irgendeine Aktion oder Reaktion des Fisches beobachtbar ist. Denn die Prämisse lautet, dass Kommunikation und Verhalten bei Fischen ineinandergreifen, dass Fische also nicht einfach absichtslos vor sich hin «blubbern» können. 151 Die Details dieses Identifizierungsprozesses spare ich heute aus.15 Meine Aufmerksamkeit gilt einzig dem Umgang der Forschenden mit den primären Video- und Audiodateien. Dass in dem vorliegenden Versuch so gewaltige Mengen an Material entstehen, hängt mit drei Umständen zusammen: Die Phänomene, die interessieren, sind selten, zwei bis drei Fischtöne pro Stunde sind schon eine sehr gute Rate. Sie sind darüber hinaus (im Augenblick noch) nicht vorhersagbar und ihre Produktion soll auch nicht durch Interventionen der Forschenden angereizt werden. Es bleibt darum gar nichts anderes übrig, als für jeden Beobachtungstag stundenlang Bild und Ton abzuspeichern. In einer späteren Phase soll dieser Prozess aber erheblich ökonomischer ablaufen. Erstes Ziel der Versuche ist es, einen Akustikfilter zu programmieren, der alle bis dahin identifizierten Fischtöne automatisch herausgreift. In seinem Kern besteht dieser erste Schritt darin, das vorhandene Material in «wichtige» und «unwichtige» Vorgänge aufzutrennen und die als «wichtig» gekennzeichneten im weiteren als kleine gekoppelte akustisch-optische Sequenzen dauerhaft zu speichern. Diese Aufgabe kann mit Hilfe von Ohren und Augen bewerkstelligt werden. Wie die beabsichtigte Automatisierung belegt, kann sie aber ebenso gut durch einen Algorithmus erfolgen, der Kamera, Mikrofon und Rechner in einen geschlossenen Zusammenhang bringt. Die Möglichkeit, diesen Arbeitsschritt in eine programmierbare Routine zu übersetzen, besagt zugleich etwas über die Funktion, die Augen und Ohren in dem noch nicht automatisierten Procedere zukommt. Es geht an dieser Stelle des Forschungsprozesses nicht um ein Sehen und Hören im starken Sinne, um ein ausdauerndes «Hinhören» auf den übertragenen Ton und ein intensives «Studium» der Videobilder, sondern um einen von wenigen Kriterien gesteuerten Prozess der Filterung und Verknüpfung von Signalen. Der Punkt, der mich beschäftigt, wird an meinem zweiten Beispiel noch deutlicher werden. Auch dieses Beispiel verdanke ich der Arbeit von Hannes Rickli, es wird aber gleich verständlich werden, warum sich davon keine Spur auf den eingangs erwähnten CDs fand. Das Forschungsunternehmen, von dem zu berichten ist, lässt sich grob dem Bereich der Neuroinformatik 15 Vgl. Hoffmann (2011). 152 zuschlagen.16 Forschungsziel war es, die neurophysiologischen Grundlagen der visuell-motorischen Steuerung der Flugbewegungen bei der Taufliege (Drosophila melanogaster) aufzuklären und die biologischen Regelprinzipien ingenieurstechnisch anzuwenden. Einen wichtigen Aspekt in dieser Untersuchung bildet die Sammlung von Daten über die Stellung der Flügel bei wechselnden Geschwindigkeiten. Diese Daten können auf verschiedenen Wegen gewonnen werden, besonders gute, nämlich realistische, den natürlichen Verhältnissen nahekommende Daten gewinnt man dabei durch das sogenannte Freiflug-Verfahren. Mit freiem Flug hat dieses Verfahren freilich wenig zu tun. Für die Untersuchung wird die Fliege in einen kleinen, ca. 1 Meter langen, 50 cm hohen und breiten Windkanal gebracht, in dem eine leichte Gegenströmung herrscht. Auf die Seitenflächen des Windkanals können, wie auf einer Filmleinwand, als künstlicher Horizont sogenannte Streifenmuster projiziert werden, die von der Fliege als eine Art visueller Geschwindigkeitsmesser verarbeitet werden. Abänderung der Streifenbreite, das heißt der Frequenz des Hell-Dunkel-Wechsels, führt zu Abänderung der Fluggeschwindigkeit. Um diesen Vorgang kontrolliert zu untersuchen, wird die Fliege in ihrem Flug kontinuierlich von zwei Kameras verfolgt. Aus den optischen Signalen kann die aktuelle Geschwindigkeit errechnet werden und in einer Schleife in Echtzeit der künstliche Horizont, also das «Fliegenkino» auf den Seitenwänden, so verändert werden, dass die Fliege «gebremst» oder «beschleunigt» wird. Gleichzeitig ist eine dritte hochauflösende Digitalkamera so ausgerichtet, dass sie jeweils die Stellung der Flügel und den Neigungswinkel des Körpers einfängt. Die Sache klingt in meiner Darstellung ziemlich simpel, in der Praxis behindern aber mannigfaltige Störquellen und limitierende Umstände die Untersuchung. Schon eine kleine Staubflocke im Windkanal kann beispielsweise nicht nur die Fliege ablenken, sondern ebenso die beiden Kameras, die die im Flug befindliche Fliege verfolgen bzw. tracken. Für unseren Zusammenhang interessant an dieser Arbeit ist, dass das System vollkommen optisch organisiert ist, dass es vollkommen auf die visuelle 16 Vgl. für die Versuchsanordnung Rickli (2011), 157. Für Forschungsziele, Vorgehensweise und erste Resultate siehe ausführlich Fry u.a. (2008). 153 Orientierung der Fliege abgestellt ist, dass auch der Flug der Fliege von den Mitgliedern der Forschungsgruppe jederzeit visuell verfolgt werden kann, dass aber niemals in dem ganzen Ablauf eine integrale Videoaufzeichnung der im Flug befindlichen Fliege stattfindet. Die optischen Signale, welche die zwei Videokameras des Tracking-Systems liefern, werden überhaupt nicht in Bilder verwandelt und sie werden auch nicht aufgezeichnet, sie laufen einfach durch den Rechner, der das «Fliegenkino» steuert, durch. Das von der dritten, hochauflösenden Kamera übertragene Signal, wird zwar aufgezeichnet, aber auch hier entsteht niemals ein Bild im Ganzen. Es wird auch keine kurze, aber zusammenhängende Sequenz aus dem Zeit-Raum-Kontinuum herausgegriffen wie im Falle des Fischsettings, vielmehr werden aus dem ganzen übertragenen optischen Signal nur einzelne interessante Segmente, einzelne Pixel festgehalten, die auch nicht visuell inspiziert werden, sondern wiederum die Grundlage für einen rechnergesteuerten Auswerteprozess bilden, an dessen Ende numerische Daten zur Flügelstellung und zur Fluglage der Fliege stehen. Nun ist klar, warum auf den CDs kein Material aus dieser Untersuchung zu finden war: Es gibt keine Aufzeichnungen aus dem Experimentalbetrieb, die sich «anschauen» lassen, es gibt nur einige Abfälle aus Tests mit der Versuchsanordnung. Wir sind hier mit einer Weise des Forschens konfrontiert, die sich in wichtigen Teilen unsichtbar abspielt. Das heißt nicht, dass die untersuchten Phänomene für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar sind. Selbstverständlich könnte man sich Flügelstellung und Fluglage der Fliege in Slow-Motion auf einem Videomonitor ansehen. Gemeint ist vielmehr, dass dieser Teilschritt des Forschungsvorgangs nicht auf Sicht gestellt ist, sondern, wie schon am Fischsetting vermerkt, in einem geschlossenen System zwischen Apparaturen stattfindet. Gegenüber dem Fischsetting kommt dabei noch hinzu, dass die Verarbeitung der optisch detektierten Signale nur teilweise auf ihre weitere, dauerhafte Fixierung abzielt, teilweise aber der Selbststeuerung der Versuchsanordnung dient. Etwas Ähnliches lässt sich in der heutigen auf bildgebende Verfahren gestützten Radioonkologie bemerken. Die von den Detektoren des Computertomografen gelieferten Signale werden als Daten teilweise herkömmlich in Bilder umgesetzt, teils werden aber auf derselben Datenbasis The154 rapiepläne entworfen und auch umgesetzt.17 Zwar bewegen wir uns mit der medizinischen Bildgebung nicht mehr im Kontext der Forschung, aber der Grundzug ist derselbe. Daten, die auf der Auswertung (hier im weiteren Sinne) optisch detektierter Signale gründen, gewinnen nicht notwendig noch als visuell erfahrbare Darstellungen Präsenz. Diese Spannung zwischen einer geradezu unermesslichen Zahl von Bildern, die von optisch basierten Settings potentiell generiert werden, und dem Umstand, dass davon häufig nur noch Bruchteile gespeichert und in Betracht gezogen werden, gilt es zu würdigen. Die Bilderflut auf meinem Schreibtisch könnte man deshalb, zugespitzt gesagt, auch als letzte Regung einer gerade untergehenden Epoche des bildbasierten Forschens verstehen. Sie lässt uns glauben, es käme im Forschungsprozess weiterhin auf das Bild an, während dessen Rolle für die Gewinnung von Erkenntnissen schon erheblich im Schwinden begriffen ist. Die Formel: Images scatter into data, data gather into images, auf die Peter Galison vor einigen Jahren das Verhältnis von Daten und Bildern im wissenschaftlichen Alltag des digitalen Zeitalters gebracht hat, beschreibt unter Umständen nur eine vorübergehende Situation auf dem Durchgang zu einer Forschungspraxis, die wesentlich stärker darauf ausgerichtet ist, Daten mit Daten zu verknüpfen und aus Daten neue Daten zu gewinnen.18 So pauschal wäre das aber nicht richtig. Abgesehen von den Unterschieden in einzelnen Bereichen der Wissenschaften verschwinden die Prozesse der Inskription, der Sichtbarmachung keinesfalls, sie tauchen jedoch erst an einem späteren Punkt in der Kette der Forschungsoperationen auf. Im Falle des Fischsettings werden die archivierten Ausschnitte aus dem Rohmaterial sehr genau auf charakteristische Muster von Geschehensabläufen untersucht. Im Falle des Fliegensettings kehren grafische, auf das Sehen berechnete Inskriptionen wieder, wenn die gespeicherten Daten über Flügelstellung und Fluglage in quantitative Modelle umgesetzt werden, wenn also aus Zahlen mit Hilfe von Werkzeugen wie Diagrammen Erkenntnisse hervorgebracht werden. Dessen ungeachtet lässt sich festhalten, dass immer mehr Operationen im Forschungsprozess ohne repräsentationale Zwischenschritte auskommen. 17 Vgl. Badakhshi (2006). 18 Galison (2002), 322. Zur Herausbildung einer «datengeleiteten Forschung» in der Molekularbiologie siehe Rheinberger (2007), 123f. 155 Man kann sogar sagen, dass es beim Speichern und Prozessieren von Daten streng genommen nicht einmal zu einer Inskription kommt. Diese Feststellung klingt, zugegeben, kontraintuitiv, ist es doch üblicher Sprachgebrauch, dass Daten «geschrieben» und «gelesen» werden. Mir scheint aber, dass in der näheren Ausfüllung des Begriffs der Inskription eine Voraussetzung gemacht wird, die in unserem Fall nicht erfüllt wird. Nach Latour fixieren Inskriptionen Aspekte des Forschungsobjekts und gestatten es, diese vom Ort der Untersuchung abzulösen. Eine gute Inskription zeichnet sich dadurch aus, dass sie zum immutable mobile taugt.19 Sie hält ein Forschungsobjekt fest und kann gleichzeitig unbegrenzt zirkuliert werden. Ein Protokoll, ein Foto, eine aufgezeichnete Kurve kann man an jedem beliebigen Ort hervorholen, man kann sie als Belege anführen, man kann auf sie verweisen, statt das Forschungsobjekt in seiner ganzen Anordnung mit sich zu führen, man kann diese Inskriptionen untereinander und mit anderen vergleichen, kombinieren usw. Dieses «man» ist aber niemand anderes als der Forscher oder die Forscherin. Inskriptionen sind, wenn man so will, rezeptiv verfasst. Sie blühen auf und werden erst zu Inskriptionen, wenn ein paar Augen oder besser mehrere Paare Augen sie in Betracht ziehen und mit ihnen etwas anstellen. In diesem Sinne sind Daten, so lange sie im Speicher liegen, keine Inskriptionen, weil keine Interaktion mit einem menschlichen Akteur stattfindet. Hier deutet sich zugleich eine Wendung meiner Beobachtung ins Allgemeine an. Es scheint so, dass repräsentationale Aktivität für Wissenschaftsgeschichte und -forschung die Beteiligung einer Forschungsperson voraussetzt. Für Latours Begriff der Inskription ist dies eben gezeigt worden, für Rheinbergers Begriff der Sichtbarmachung braucht dies nicht größer ausgeführt werden. Im Akzent auf Sichtbarkeit ist ein Forscher oder eine Forscherin, die wahrnimmt, von vornherein in den Vorgang eingeschlossen; keine Sichtbarkeit ohne Hinsehen. Meine zwei Beispiele zeigen jedoch, dass (1) nicht jede optisch basierte, auf Kameras oder bildgebende Verfahren gestützte Wissenschaftspraxis notwendig auf das Auge baut und damit zur Sache einer «visuellen Epistemik»20 wird. Und meine zwei Beispiele führen damit (2) auf ein 19 Latour (1990), 26. 20 Hässler / Mersch (2009), 10 und 13-18. 156 Dilemma. Denn nehme ich an, dass es zur repräsentationalen Aktivität einen menschlichen Akteur braucht, der in die Hervorbringung einer Sache der Forschung, ihrem «Wirklichwerden» verwickelt ist, dann fallen in meinen Beispielen beachtliche Teile der Forschungsoperationen aus dieser Aktivität heraus. Zugleich ist aber offensichtlich, dass diese Operationen – Korrelieren, Extrahieren, Speichern, Berechnen – die heute in der Wissenschaftsforschung gängige Bestimmung des Repräsentationsbegriffs als Formierung und Begrenzung des Forschungsobjekts bestens erfüllen. Es lässt sich nun einwenden, dass es sich hier um ein Scheinproblem handelt: Dass die Operationen zwar ohne Beteiligung menschlicher Akteure ablaufen, aber von diesen Akteuren geplant und durch die Anordnung der Apparaturen und die Programmierung der ablaufenden Routinen geprägt sind. Es lässt sich dann aber ebenso gut einwenden, dass diese Art der Beteiligung der Forschungsperson am Geschehen nicht recht gut mit dem Eindruck in Deckung zu bringen ist, der uns von der Charakteristik repräsentationaler Aktivität vermittelt wird. Obwohl man dem trivialen Abbildverständnis von Repräsentation entkommen ist, obwohl, wenn von den Bildwelten der Forschung gesprochen wird, sehr zurecht die operativen und performativen Funktionen von Repräsentationen herausgestrichen werden, bleibt man beim Verständnis der Rolle von Forschungspersonen in der repräsentationalen Aktivität in einer ziemlich konventionellen passiven, wahrnehmenden, betrachtenden Auffassung stecken. Und mehr noch: Man kann sich die Gesamtaktivität «Repräsentation» gar nicht ohne diese Teilaktivität «Rezeption» vorstellen. Wir können nun entweder diese Begrifflichkeiten auf unsere Beispiele ausdehnen und davon sprechen, dass die von den Detektoren gelieferten Signale vom Rechner nicht zu Daten verarbeitet, sondern als Daten rezipiert werden. Was die Frage aufwirft, ob Rechner wahrnehmen können, und im nächsten Schritt, welche Seinsweise wir Rechnern zuordnen wollen. Wir können die geschilderten Situationen des Forschens als Spezialfälle repräsentationaler Aktivität einkapseln oder wir nehmen hin, dass repräsentationale Aktivität zwar weiterhin einen sehr wichtigen Vorgang, aber nicht mehr einen umfassenden Grundzug heutiger Forschung bildet. Im letzten Fall müsste man dann zwischen Repräsentationsarbeit einerseits und Datenarbeit andererseits unterscheiden, müsste neben Inskriptionen durch Sichtbarmachung 157 auch die Präskripte nicht sichtbarer Operationen studieren. Man müsste nicht mehr (nur) über die Bildwelten der Forschung nachdenken, sondern über Daten, nicht allgemein über Daten, sondern über Daten im Forschen: Was definiert Daten, wie ist ihre Wirklichkeit beschaffen, wie werden Daten gewonnen, was passiert beim Übergang vom Signal zum Datum, was beim Übergang vom Datum zur Spur, zur Inskription? Zugang zu diesen Fragen zu finden, ist nicht ganz einfach, denn anders als Visualisierungen, Bilder und Inskriptionen, richten sich Daten nicht an uns. Ob eine Fotografie, ein Diagramm, eine Formel, eine Notiz, ein Präparat usw., sie sind auf ihre Rezeption angewiesen und auf diese Rezeption hin zugerichtet. Daten sind hingegen selbstgenügsam. Sie kommen ohne unsere Teilnahme aus. Literatur Adelmann, Jan u.a. Datenbilder. Zur digitalen Bildpraxis in den Naturwissenschaften, Bielefeld 2009. Badakhshi, Harun. «Körper in/aus Zahlen. Digitale Bildgebung in der Medizin». In: Hinterwaldner / Buschhaus (2006), S. 199–205. Bredekamp, Horst u.a. (Hg.). Das technische Bild, Berlin 2008. Burri, Regula. Doing Images. Zur Praxis medizinischer Bilder, Bielefeld 2008. Daston, Lorraine / Peter Galison. «Das Bild der Objektivität» (1992). In: Geimer (2002), S. 29–99. Dommann, Monika. Durchsicht, Einsicht, Vorsicht. Eine Geschichte der Röntgenstrahlen 1896–1963, Zürich 2003. Fleck, Ludwik. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv (1935), Frankfurt a.M. 1980. Francoeur, Eric / Jérôme Segal. «From Model Kits to Interactive Computer Graphics». In: Soraya de Chadarevian / Nick Hopwood (Hg.). Models. The Third Dimension of Science, Stanford 2004, S. 402–429. Fry, Steven N. u.a. «TrackFly. Virtual Reality for a Behavioral System Analysis in Free-Flying Fruit Flies». In: Journal of Neuroscience Methods 171 (2008), S. 110–117. 158 Fyfe, Gordon / John Law (Hg.). Picturing Power. Visual Depiction and Social Relations, London 1988. Galison, Peter. Image and Logic. A Material Culture of Microphysics, Chicago 1997. Galison, Peter. «Images Scatter into Data, Data Gather into Images». In: Bruno Latour / Peter Weibel (Hg.). Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion, and Art, Cambridge (MA) 2002, S. 300–323. Geimer, Peter (Hg.). Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie, Frankfurt a.M. 2002. Gugerli, David / Barbara Orland (Hg.). Ganz normale Bilder. Historische Beiträge zur visuellen Herstellung von Selbstverständlichkeit, Zürich 2002. Hagner, Michael. «Zwei Anmerkungen zur Repräsentation in der Wissenschaftsgeschichte». In: Hans-Jörg Rheinberger u.a. (Hg.). Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur, Berlin 1997, S. 339–355. Hässler, Martina / Dieter Mersch. «Bildlogik oder Was heißt visuelles Denken?». In: Dies. (Hg.). Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft, Bielefeld 2009, S. 8–62. Heintz, Bettina / Jörg Huber (Hg.). Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen Welten, Zürich 2001. Hennig, Jürgen. «Chancen und Probleme bildgebender Verfahren für die Neurologie». In: Freiburger Universitätsblätter 40 (2001), Heft 153, S. 67–86. Hinterwaldner, Inge / Markus Buschhaus (Hg.). The Picture’s Image. Wissenschaftliche Visualisierung als Komposit, München 2006. Hoffmann, Christoph. «Representing Difference. Ernst Mach’s and Peter Salch­er’s Ballistic-Photographic Experiments, 1886/87». In: Endeavour 33 (2009), Heft 1, S. 18–23. Hoffmann, Christoph. «Eigenleben im Experiment. Zur Erforschung ‹natürlicher› Systeme». In: Rickli (2011), S. 46–55. Jones, Caroline A. u.a. (Hg.). Picturing Science, Producing Art, New York 1998. Landecker, Hanna. «Microcinematography and the History of Science and Film». In: Isis 97 (2006), S. 121–132. Latour, Bruno. «Drawing Things Together». In: Michael Lynch / Steve Woolgar (Hg.). Representation in Scientific Practice, Cambridge (MA) 1990, S. 19–68. 159 Le Grand, Homer. «Is a Picture Worth a Thousand Experiments?». In: Ders. (Hg.). Experimental Inquiries. Historical, Philosophical and Social Studies of Experimentation in Science, Dordrecht 1990, S. 241–270. Lynch, Michael. «Representation is Overrated. Some Critical Remarks about the Use of the Concept of Representation in Science Studies». In: Configurations 2 (1994), Heft 1, S. 137–149. Lynch, Michael / Steve Woolgar (Hg.). Representation in Scientific Practice, Cambridge (MA) 1990. Nasim, Omar. «Observation, Working Images and Procedure. The ‹Great Spiral› in Lord Rosse’s Astronomical Record Books and Beyond». In: British Journal for the History of Science 43 (2010), S. 353–389. Rheinberger, Hans-Jörg. «Von der Zelle zum Gen. Repräsentationen der Molekularbiologie». In: Ders. u.a. (Hg.). Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur, Berlin 1997, S. 265–279. Rheinberger, Hans-Jörg. «Wie werden aus Spuren Daten, und wie verhalten sich Daten zu Fakten?». In: Nach Feierabend 3 (2007), S. 117–125. Rheinberger, Hans-Jörg. «Sichtbar Machen. Visualisierung in den Naturwissenschaften». In: Klaus Sachs-Hombach (Hg.). Bildtheorien. Anthropologische und kulturelle Grundlagen des Visualistic Turn, Frankfurt a.M. 2009, S. 127–145. Rickli, Hannes (Hg.). Videogramme. Die Bildwelten biologischer Experimentalsysteme als Kunst- und Theorieobjekt, Zürich 2011. Taylor, Peter J. / Ann S. Blum (Hg.). «Pictorial Representation in Biology». In: Biology & Philosophy 6 (1991), Heft 2, S. 125–134. Voss, Julia. Darwins Bilder. Ansichten der Evolutionstheorie 1837 bis 1874, Frankfurt a.M. 2007. Wilder, Kelley. Photography and Science, London 2009. Wittmann, Barbara. «Das Portrait der Species. Zeichnen im Naturkundemuseum». In: Christoph Hoffmann (Hg.). Daten sichern. Schreiben und Zeichnen als Verfahren der Aufzeichnung, Zürich / Berlin 2008, S. 47–72. 160 Die Identität des Andern. Henri Bergson und die Pariser Weltausstellung 1889 Beat Wyss I. Der Raum als Irrtum Wir brauchen keine Weltausstellungen mehr. Im Zeitalter von Fernsehen und Internet ist der stets verfügbare Blick auf die «ganze Welt» zur banalen Gewohnheit geworden. Doch wie überholt sie heute auch anmuten mögen, die Weltausstellung als Institution eröffnete die erste performative Kulturtechnik, die versuchte, die kulturellen, ökonomischen, sozialen und poli­ tischen Erscheinungen der Globalisierung vor einer großen Öffentlichkeit in Szene zu setzen. Wenn wir unter Globalisierung den weltweit unmittelbaren und gleichzeitigen Austausch von Information und Kommunikation verstehen, so bildeten die Weltausstellungen den ersten Versuch, die Welt als homogenen Ort der Erfahrung lesbar zu machen. Ist der Abbau raumzeitlicher Distanz eine Errungenschaft des technischen Fortschritts? Hier möchte ich im Sinne der Mentalitätengeschichte eine Gegenposition entwickeln zu einer mechanistischen Auffassung, wonach die Technologie die Grundlage der Globalisierung sei. Die Auffassungen über die Ausdehnung der Erde waren durch die Jahrtausende starken Schwankungen ausgesetzt. Amerika wurde mehrmals «entdeckt» und auch wieder vergessen von denen, die etwa im eurasischen Raum siedelten. Erst im Zeitalter von Kolumbus bricht die Kenntnis von der Beschaffenheit der Erde nicht mehr ab und gewinnt einen Umriss, den wir heute für selbstverständlich nehmen. Man mag im Sinne einer mechanistischen Epistemologie betonen, dass der Buchdruck und die Weltumseglungen im selben Zeitalter stattfanden. In der Tat war die stetige Vermehrung des Wissens vom Erdball nur möglich, weil die Seefahrer, dank Johannes Gutenberg, die Entdeckungen ihrer Vorgänger nachlesen konnten. Die koloniale Welteroberung erfolgte in einer 161 unerbittlichen Zangenbewegung zwischen Theorie und Praxis. Doch eine vergleichende Kulturwissenschaft lehrt uns, dass technische Kenntnisse nicht notwendigerweise in Herrschaftspraktiken übersetzt werden. China kannte das Druckverfahren schon vor der ersten Jahrtausendwende christlicher Zeitrechnung, die Erfindung von Kompass und Schießpulver geschah wohl unabhängig und etwa gleichzeitig wie in Europa. Doch nur hier wurden gedruckte Seekarten, Kompass und Schießgewehr zu Instrumenten der Welteroberung. Zum technischen Wissen gehört immer auch ein Wille zur Macht. Nur in Europa gab es den Anspruch, über den eigenen Kulturkreis hinaus zu greifen. Selbst wenn Christoph Kolumbus Königin Isabella und König Ferdinand von Spanien nicht hätte überzeugen können, die Expedition für einen Westweg nach Indien zu finanzieren, es hätte eine andere Allianz sich ergeben, die zur Entdeckung Amerikas führte. Der italienische Abenteurer bekam den Auftrag schon allein um die Möglichkeit auszuschließen, dass die französische Krone mit einer Expedition erfolgreich zuvorkäme. Dass die Welt zu erobern war, weil es sonst die anderen tun würden: dieser Wettbewerb um die Hegemonie unter den europäischen Großmächten war der Motor für den Prozess der Globalisierung, in dessen Sog wir noch heute stehen. Kurzum: Globalisierung beginnt da, wo das Wissen über die Beschaffenheit der Erde unumkehrbar wird und die Entfernungen in den gewohnheitsmäßig befahrenen Eroberungs-, Handels- und Kriegsrouten zu schrumpfen beginnen. Im Kolonialismus des 19. Jahrhunderts fand die Globalisierung ihren Höhepunkt. In dieser Zeit entwickelte sich auch das Bedürfnis, «die ganze Welt» für die Massen darstellbar und erlebbar zu machen. Die technischen Möglichkeiten, welche die Weltausstellungen boten, mochten zwar neu sein, ihre Semantik knüpfte aber an die longue durée von Inszenierungen, wie wir sie auch heute noch bei internationalen Sportanlässen vor den Fernsehzuschauern beobachten können. Abbildung 1 zeigt den Umzug der Vietnamesen an der Exposition Universelle von 1889. Die Landesvertreter einer Weltausstellung stellten sich dem Publikum vor in typischer Tracht und musikalischer Begleitung. Das Ritual des introitus zieht sich von römischen Triumphzügen über kirchliche Prozessionen bis zu den Eröffnungszeremonien Olympischer Spiele. 162 Abb. 1: Umzug der Vietnamesen an der Esplanade des Invalides, No. 621 Ein Unterschied bestand darin, dass es noch kein Fernsehen gab, um das Ereignis den nicht Anwesenden in Bildern zu übertragen. Aber es gab die Eisenbahn, welche die Besucher das Ereignis vor Ort erleben ließ. 32.250.297 Besucher kamen 1889 nach Paris. Mit 61.722 Ausstellern aus 54 Nationen und 17 französischen Kolonien erwirtschaftete die gigantische Schau sogar einen Nettogewinn von acht Millionen Francs für die damals noch junge Republik Frankreich. Die Expo 1889 war getragen von einem ungebrochenen Fortschrittsglauben und dem kolonialen Optimismus, mittels der modernen Zivilisation weltweit die beste aller möglichen Welten zu schaffen. Unter den deutschen Ausstellern war ein gewisser Carl Benz aus Karlsruhe, Ingenieur, der für seine Erfindung warb: einen dreirädrigen Wagen, der «von selbst» fuhr, ein auto mobil. Es fand kaum Beachtung. Populär hingegen war die neue Generation von Fahrrädern, deren Modelle sich der heutigen Form annäherten. Der Star unter den Erfindern aber war Thomas Alva Edison aus den USA. Neben dem Phonografen und dem dampfgetriebenen Elektrodynamo präsentierte er die Kohlefadenglühlampe, deren Verkauf inzwischen 1 Die folgenden Illustrationen stammen aus der Zeitschrift L’exposition de Paris 1889. 163 nach 120 Jahren aus Gründen des Umweltschutzes eingeschränkt wird. Überhaupt: Elektrizität war der «clou» der Expo Universelle 1889. Bis heute ist sie die Bedingung der Möglichkeit aller gegenwärtigen Technologie. Elektrizität ist eine Energie, für deren Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit die raumzeitlichen Distanzen des Erdballs eine vernachlässigbare Größe darstellen. Abb. 2: Edisons Phonograf in der Galerie des Machines, No. 39 164 Im Jahr jener Weltausstellung publiziert der dreißigjährige Henri Berg­ son sein Essai sur les données immédiates de la conscience. Die Zeit war reif für diesen Gedanken. Sich die Welt als ein sensomotorisches Erlebnis vorzustellen, in der die Bewegung das Kommando übernimmt, während Raum und Zeit als abstrakte Kategorien der Messbarkeit an Bedeutung verlieren. Die Weltausstellung lässt sich verstehen als eine spektakuläre Erscheinungsform des Bergsonianismus, denn sie ermöglichte die Vermittlung von Sinneswahrnehmungen, deren Quellen nicht, wie gewohnt, im raumzeitlichen Kontinuum des Wahrnehmenden standen. Da gab es Edisons Phonografen, an dessen Stand Gedränge herrscht. Zwei Herren warten geduldig, bis sie an der Reihe sind, ein Paar Kopfhörer an die Ohren zu drücken, um, vorgebeugt, Geräuschen zu lauschen, die aus einem Apparat kommen, den ein junger Operator bedient (Abb. 2). Wohin blickt der Hörer, der etwas vernimmt, was nicht im Raum ist? Der Zeichner, Paul Desteu, hat solche Menschen in der Galerie des Machines genau beobachtet. Sie scheinen ihre Umwelt zu vergessen und schauen irgendwie verzückt in die Luft. Der wartende Herr mit Melone und Kurzmantel nimmt diese Haltung schon vorweg, wenn er selbstvergessen in sich hineinhört in Erwartung des technischen Wunders: dass Musik an seine Ohrmuscheln pocht, die in einer anderen Zeit und in einem ganz anderen Raum erzeugt worden ist. Das Bild verzückter Expo-Besucher mit Kopfhörer erinnert mich an jene Zeit, gut hundert Jahre später, als das Mobiltelefon aufkam. Ich lebte damals gerade in Rom, wo der Umgang mit dem cellulare spektakuläre Formen annahm. Der in aller Öffentlichkeit Telefonierende verwandelte sich in ein solipsistisches Wesen, das in seinem eigenen Universum lebte, während es mitten auf der Straße in sein winziges Gerät am Ohr hinein weinte, lachte und schrie. Die Passanten, wenn nicht gerade auch mit ihrem telefonino beschäftigt, nahmen von den Veitstänzern keine Notiz. Dass man Zustände der Verzückung in der Römer Öffentlichkeit für normal hielt, konnte ich, der zurückhaltende Schweizer, mir nur damit erklären, dass solche Szenen zwischen Erleuchtung und Besessenheit hierorts schon auf barocken Altarbildern vorgelebt wurde. Neben dem Fernhören gab es an der Expo auch schon Fernsehen avant la lettre in Gestalt von Dioramen. Im Pavillon der französischen Forstverwaltung gab es drei illusionistisch beleuchtete Landschaftsbilder zu sehen. 165 Die Raumwirkung wurde dadurch verstärkt, dass der Besucher die Szene von einer verdunkelten Rampe aus betrachtete. Den Zauber der black box hat der Zeichner für das Journal de l’Exposition trefflich übersetzt, wenn er das Interieur des Dioramas in die Außenfassade des Pavillons hineinmontiert (Abb. 3). Die Damen in modisch eng geschnürten, reich drapierten Röcken, mit Hüten, wie auch die Herren in ihren dunklen Straßenanzügen, sie alle sind buchstäblich «ver-rückt», erscheinen vom Pariser Champ de Mars in ein unwegsames Felssturzgebiet in den französischen Alpen versetzt, wo sie jetzt die Befestigungsarbeiten auf der Aussichtskanzel bequem studieren können. Den Flaneuren an der Pariser Weltausstellung erteilt so moderne Ingenieurskunst eine Lektion in der Beherrschung von Wildnis. Die neuen Reproduktionsmedien entstehen parallel zu einer philosophischen Erkenntnistheorie, welche die a priorischen Kategorien von Raum und Zeit verabschiedet. Im Jahr der Weltausstellung 1889 unterzieht Bergson die transzendentale Ästhetik Immanuel Kants einer Kritik. Mit ihr habe der Philosoph aus Königsberg nichts anderes festgeschrieben als die Auffassung des gewöhnlichen Bewusstseins, wonach der Raum eine Größe darstellt, die unabhängig und isolierbar sei von den Dingen, die er umgibt. Dieses Raumbewusstsein unterscheide den Menschen vom Tier. Für einen erwachsenen Lachs, der zur Vermehrung an die Laichstelle seiner Gattung zurückkehrt, ohne den Weg zu kennen, gibt es ein sensomotorisches Sich-Bewegen im Raum, das ohne Maß und Zahl auskommt. Ein Körper bewegt sich von einer Position zur anderen im Rahmen einer Dauer (durée), die nur für den Betrachter von außen als räumliche Abfolge erscheint. Im Körper selbst erlebt sich Bewegung als mentale Synthese, als psychischer Prozess ohne Ausdehnung.2 Nachmessen lässt sich nicht die Bewegung, sondern nur deren Positionen im Raum. Bergson unterscheidet so eine homogene und eine heterogene Seite der Bewegung: Homogen ist der durchlaufene Raum, der sich als messbare Quantität darstellen lässt, heterogen hingegen der Akt des Durchlaufens, der reine Intensität ist, eine Qualität, der nur im Bewusstsein Wirklichkeit zukommt. Da man an einer Bewegung nur deren Positionen im durchlaufenen Raum nachmessen kann, misst die 2 «un processus psychique et par suite inétendu», siehe Bergson (1927), 82. 166 klassische Mechanik im Grunde immer nur Stadien der Bewegungslosigkeit. In diesem Sinne drücken algebraische Gleichungen einen fait accompli, ein erzieltes Resultat aus. Zu diesen «erreurs de l’associationisme»3 sollte Bergson später auch den Film zählen. Das neue Medium, das um die Jahrhundertwende die Massen mit Abb. 3: Pavillon der französischen Forstverwaltung, No. 37 3 Ebd., 100. 167 scheinbar bewegten Bildern verblüfft, lässt eigentlich das Wesen der Bewegung verkennen, weil diese in der Tat immer schon in Positionen zerlegt ist. Sie besteht zunächst aus 18, dann aus 24 unbewegten Phasenbildern, die pro Sekunde auf Leinwand projiziert werden. In seiner Schrift L’évolution créatrice von 1907 unterscheidet Bergson zwischen realer Bewegung bei konkreter Dauer und unbeweglichen Schnitten plus abstrakter Zeit und gibt dieser den Namen «illusion cinématographique». Gilles Deleuze hat später Bergsons Konzept der durée zu einer dekonstruktiven Filmtheorie ausgebaut. Die kinematografische Illusion bezeichnet ein anthropologisches Bedürfnis des Menschen, sich durch Bilder täuschen zu lassen. «Soll das heißen, dass – Bergson zufolge – der Film lediglich die Projektion, die Reproduktion einer konstanten, universellen Illusion ist? Dass man immer schon gefilmt hat, ohne es zu wissen?»4 Diese Vermutung von Deleuze eröffnet die Kritik einer mechanistischen Theorie, wonach eingleisig immer nur das Medium das Bewusstsein bestimme. In Bergsons Denken verkehrt sich die Auffassung von der Realität. Real ist nicht die messbare Raumzeit, sondern die inkommensurable Intensität von Abb. 4: Eine Spazierfahrt im fauteuil roulant, No. 36 4 Deleuze (1989), 14. 168 Dauer. Begriffe und Zahlen überspielen geradezu das unmittelbare, das le­ben­dige Bewusstsein pseudomorph mit ihren abstrakten Formeln.5 Die reale Dauer ist reine psychische Intensität. Soll diese etwa in Gestalt eines Kunstwerks ausgedrückt werden, unterlegt man ihr unwillkürlich die Idee von Raum und Zeit.6 Homogener Raum und heterogene Dauer werden erlebbar in der Erfahrung der Simultaneität, die Bergson als «intersection du temps avec l’espace» definiert. Simultaneität ist, wie die Bewegung, «le symbole vivant d’une durée en apparance homogène».7 Ein Vergnügen, speziell den Damen empfohlen, war es, zwischen vier und fünf Uhr abends, zur happy hour, sich auf einem der fauteuils roulants durchs Gewühl fahren zu lassen (Abb. 4). Hier wurde aus der Bewegung der Reibungsverlust durch körperliche Anstrengung herausgefiltert, sodass sich der Beobachter ganz dem sensomotorischen Strom des Wahrnehmens überlassen konnte. Ein Menschenalter bevor der Fernseher erfunden wird, gab es dieses Bedürfnis, im Lehnstuhl durch die Welt zu zappen, die, auf Zeit zwar nur, an einem Ort, in Paris, stattfand. Der Expobesucher ist ein solipsistisches Sinnenwesen in Bewegung, das simultan Couscous aus Algerien schmecken, den Fellmantel eines Lappländers betasten, Indische Gongs hören, das Ozon einer elektrischen Entladung riechen und Samoanerinnen tanzen sehen kann. II. Das kulturelle Siegelstadium Die Exposition Universelle bildete den utopischen Vorschein einer Welt jenseits der riesigen Distanzen, die den Erdball geografisch voller natürlicher Hindernisse erscheinen lassen. Damit komme ich zur Hypothese zurück, wo­‑ 5 6 7 Vgl. Bergson (1927), 98. Vgl. ebd., 79: «La vraie durée, celle que la conscience perçoit, devrait donc être rangée parmi les grandeurs dites intensives, si toutefois les intensités pouvaient s’appeler des grandeurs; à vrai dire, ce n’est pas une quantité, et dès qu’on essaie de la mesurer, on lui substitue inconsciemment de l’espace». Der Lebensphilosoph versäumt aber nicht zu bemerken, dass die Begriffe Raum und Zeit überschattet seien von der «Erbsünde» des Messens («entachés d’un vice originel»), siehe ebd., 91. Ebd., 82. 169 Abb. 5: Die Eseltreiber an der rue du Caire, No. 24 nach die Abschaffung der physischen Distanz nicht Nähe bringt, sondern die unmittelbare Wahrnehmung von Fremdheit verdichtet. Am Nullpunkt der Distanz beginnt die Differenz. Urzelle des Exotismus an den Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts waren die sogenannten ethnologischen Dörfer. In Paris hießen sie seit 1878 rue du Caire und erfreuten sich großer Beliebtheit als Vergnügungszentrum (Abb. 5). Hier gab es Kaffeetrinken für die Damen, Bauchtänze für die Herren, Kamelreiten für Kinder. Hier fand der Besucher bestätigt, was er sich unter der großen weiten Welt immer schon vorgestellt hatte. Bis zu 1.000 Angestellte arbeiteten in der «Straße von Kairo», einer Kulissenstadt mit dem maurischen Charme, den wir heute noch in den Bauten des Club Méditerrané antreffen. Wie schon erwähnt, wird im Prozess der Globalisierung räumliche Distanz abgebaut und dabei kulturelle Differenz freigelegt. Wie gehen die Gesellschaften seit dem 19. Jahrhundert damit um? Im Gegensatz zu einer postkolonialen Theorie, die eher statisch zwischen Tätern und Opfern unterscheidet, möchte ich zeigen, dass sich selbst die Kultur der europäischen Kolonialstaaten einer allmählichen «Kreolisierung» unterzieht. Ursprünglich 170 Abb. 6: Eingang zur Weltausstellung am Quai d’Orsay, No. 13 geprägt zur Beschreibung kultureller Phänomene in den Kolonien Portugals von Cap Verde, Guinea-Bissau, Angola bis Brasilien und Guyana, wird der Begriff in den letzten Jahren auch angewandt für die Beschreibung postkolonialer Mischkulturen überhaupt. Ich möchte ihn noch weiter ausdehnen und erklären, dass Kreolisierung ein Prozess ist, der auch die Kulturen AltEuropas erfasst hat. Globalisierung ist ein dialektischer Prozess, der mit der Verwestlichung der Welt zugleich eine Orientalisierung des Westens hervorbringt. 171 Das Portal beim Quai d’Orsay, das aussieht wie eine fantastische Mischung aus laotischer Pagode und Portal für ein Elefantengehege, ist nichts anderes als der Haupteingang zu jener Weltausstellung 1889, die dem hundertsten Geburtstag der Französischen Revolution und dem Triumph des technischen Fortschritts huldigte (Abb. 6). Es gibt, mit Hegel gesprochen, eine List postkolonialer Vernunft. Die Kolonisierung der Welt dringt spätestens im 19. Jahrhundert in die kulturelle Identität der Kolonisten ein. Die Weltausstellungen bilden das Laboratorium einer allmählichen Subversion von selbsternannter Hochkultur und Primitivität. Die Riesenspektakel waren angelegt als Leistungsschau der Kolonialmächte, die neben den Errungenschaften des technischen Fortschritts als Kontrast die kolonisierten Untertanen in landesüblichen Behausungen beim Maisstampfen, Holzschnitzen und Tanzen vorführten. Der Eiffelturm bot ein Sinnbild für die Überlegenheit Europas über die schäbigen Negerhütten der Kanaken und Senegalesen, die bei der Esplanade des Invalides aufgebaut waren. Den Völkern, deren Leistung es im Lauf der Geschichte nicht über ein Strohdach hinausgebracht hatte, konnte nichts Besseres geschehen, als von der fortschreitenden Menschheit bevormundet zu werden. Abbildung 7 zeigt nicht etwa den Palast eines fernöstlichen Märchenprinzen, sondern den Pavillon für Kinder, wo die Eltern ihren Nachwuchs während der Ausstellung betreuen lassen konnten. Hier gab es auch eine Ausstellung zur Geschichte der Erziehung, mithin ein durchaus ernsthaftes und gerade in Frankreich auch ein katholisches Thema. Dem heiter-hybriden Bau ist das nicht mehr anzusehen. In diesem Zusammenhang muss vom kulturellen Spiegelstadium gesprochen werden. Das Spiegelstadium nach Jacques Lacan8 beschreibt die Selbstwahrnehmung eines Kleinkinds zwischen sechs und achtzehn Monaten über die Identifikation eines Gegenübers als Gestalt, entsprechend zur eigenen Erscheinung. Sie entspricht der Wahrnehmung seines Spiegelbildes. Zum ersten Mal erlebt sich das Kleinkind, noch bevor es vor seinem Ebenbild aufrecht stehen, geschweige denn, bevor es «Ich» sagen kann, die Einheit seines Körpers im Anderen. Die Koordination seiner Gestalt als äußeres Erschei‑ 8 Vgl. Lacan (1949), 1–7. 172 Abb. 7: Kinderpalast und Theater der Weltausstellung, No. 23 nungsbild geht der inneren Koordinierung der Glieder voraus. Das Kleinkind macht sich im Spiegelstadium jenes erblickte Alter Ego zum ersten Ideal-Ich, mit dem es sich narzisstisch identifiziert. Entscheidend ist der «imaginäre» Charakter der Identifikation. Den Ursprung vom Ich vertritt ein Imago. Über das Bild meiner selbst, sei es im Spiegel, sei es in meinem Gegenüber, einem Andern, stellt sich eine analoge Beziehung her zwischen Organismus und Gegenstand, zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung, zwischen «Innenwelt» und «Umwelt». Im Spiegelbild entdecke ich mein Inneres als Gegenstand.9 Dieser Gedanke ist geeignet, vom individuellen auf den kollektiv-kulturellen Prozess der kulturellen Identität übertragen zu werden. Es würde hier zu weit führen, die ethischen und politischen Dimensionen einer Konstruktion des Anderen fortzuspinnen wie es Frantz Fanon in Les damnés de la terre (1961), Jean-Paul Sartre in L’être et le néant (1944) und Emmanuel Levinas in Le temps et l’autre (1946) vorgedacht haben. Es gelte die These: Die interkulturelle Begegnung ist ein Spiegel, der mich als Innenwelt in den Kontext der Umwelt versetzt. Auch in diesem 9 Ebd., 4: «Thus, to break out of the circle of the ‹Innenwelt› into the ‹Umwelt› generates the inexhaustible quadrature of the ego’s verifications». 173 Sinne hat Henri Bergson vorgedacht, wenn er von einer doppelten Wahrnehmung der Welt spricht. Es gibt einerseits die von innen heraus erlebte durée und andererseits die Erfahrung meiner Selbst als Körper im Raum, gespiegelt durch meine Umwelt, durch die Anderen. Die Anderen im Raum, die ich wahrnehme, bilden «une multiplicité distincte».10 Somit zeigt sich das Leben immer doppelt: im direkten inneren Erleben und als Spiegelung durch meine Umwelt.11 «Ainsi se forme un second moi qui recouvre le premier».12 Das erste Ich ist dieses umittelbare Selbst, das seine Dauer erlebt, während jenes zweite Ich mir von den Anderen im Raum her zurückgespiegelt wird. Aus einem «Selbst» («même») wird ein «Anderer» («autre»).13 Ich werde mir selber ein Anderer, während ich mich als einen wahrnehme, der sich im Raum bewegt. Schon Bergson entwickelt also einen Gedanken, der mit Rimbauds berühmtem Satz «Je suis un autre» Karriere machen sollte: Lacan hat ihn aufgenommen, wenn er betont: «Le je n’est pas le moi». Im Spiegelstadium kommt es zu einer Ich-Spaltung zwischen je und moi. Das je (je spéculaire) entspricht dem sozialen Ich, dem kontrolliert-kontrollierenden, dem Ich als Maske der Persona, durch die ich erfahre, wie ich selber von anderen gesehen werde. Im moi (moi idéal) identifiziert sich das Je mit dem Größen-Selbst, dem, was Freud «Ideal-Ich» nennt. Dieses moi ist zwar im je spéculaire bereits angelegt, stellt aber eine «sekundäre Identifikation» dar, eine narzisstische Identifikation des je spéculaire mit seinem Ideal, das unerreichbar bleibt.14 Das Ideal-Ich ist ein Bild, das vom Anderen her gespiegelt erscheint. Dieses Imago, dem ich mich anzunähern versuche, liegt, wie der Andere selber, außerhalb meines eigenen Körpers. Ein Akt des Spiegelstadiums ist die symbolische Einverleibung des Andern, was ich «kulturellen Kannibalismus» nenne. Dies beginnt in seiner wörtlichen Bedeutung; der Einverleibung des Andern durch Konsum. Die Gastronomie 10 Bergson (1927), 89. Es gibt dabei eine doppelte «multiplicité»: eine in der «temps-qualité où il se produit, ou dans le temps-quantité où il se projette». Siehe ebd., 96. 11 Vgl. ebd., 102: «La vie consciente se présente sous un double aspect, selon qu’on l’aperçoit directement ou par réfraction à travers l’espace». 12 Ebd., 103. 13 Ebd., 90. 14 Siehe dazu Evans (1996), 139–143 . 174 Abb. 8: Imbissbuden am Quai d’Orsay, No. 42 erzielte an den Weltausstellungen die größten Gewinne; Imbissbuden mit Landesspezialitäten waren die populärsten Treffpunkte. Exotisch essen: Das ist eine zivilisierte Form, die Kultur des Andern zu kannibalisieren. Weltläufig sein heißt: einen starken Magen haben, während über den Provinzler das Sprichwort geht: «Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht». Abbildung 8 versetzt uns in die Gegend des Spanischen Pavillons: Hier werden herzhafte Tapas unter der Allee des Quai d’Orsay gereicht, während ein vietnamesischer Rischka-Fahrer im Hintergrund für multikulturelles Kolorit sorgt. Im Essen wird die Distanz zur Welt physisch überwunden. Körperhafte Dinge im Raum verschwinden in mir. Das Essen in Gemeinschaft ist ein Ritual, das ein Sich-Näherkommen begleitet. Seien es Geschäftspartner, seien es Liebende: Übereinkünfte werden mit einem guten Essen besiegelt. Diese Kulturtechnik gehört zu den anthropologischen Konstanten, die weltweit von allen Menschen sofort verstanden werden. Spanien war überhaupt nur mit einem Degustationstempel vertreten an jener denkwürdigen Weltausstellung 1889, an der schon die Jahreszahl verdächtig war. In der Tat feierte die junge Republik Frankreich den hundertsten Geburtstag der Französischen Revolution. Kein Wunder, dass die europäischen Monarchen die Veranstaltung boykottierten. Dies hatte für 175 die Ausstellung einen durchaus globalisierenden Effekt: Es dominierten die Staaten und Kolonien jenseits von Europa. Queen Victoria ging dagegen soweit, ihren Diplomaten, Lord Lytton, am Tag der Eröffnung zurückzurufen. Spanien war also in bester Gesellschaft, wenn es neben dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn, Belgien, Luxemburg, Monaco, Holland und Portugal nur mit einem inoffiziellen Pavillon für gastronomische Produkte vertreten war. Im Innern des Fresstempels herrschte die Rhetorik der abundancia. Wie keine andere Nation ruht die spanische Warenästhetik auf barocker, ja gegenreformatorischer Grundlage. Während andere Länder ihre Produkte protes­ tantisch-puristisch zurecht legen, liegen hier Trophäen von Weinflaschen, Schinkenbergen, Eingemachtem in bauchigen Töpfen, als wäre alles von der Allegorie der Fortuna direkt aus dem Füllhorn geschüttet worden. Eine architekturgeschichtliche Lektion in Sachen Stil-Kannibalismus lässt sich an der Fassade des spanischen Nahrungsmittelpavillons ableiten. Zitiert werden Zierformen der mudayyan, der «Unterworfenen», der steuerpflichtigen Araber in den christlichen Gebieten der iberischen Halbinsel. Flach wie ein Teppich breiten sich die abstrakten Zierformen über der Fassade aus, die Komposition des unendlichen Rapports herrscht vor und findet im Stalaktitenfries in der Dachzone einen krönenden Abschluss. Der Farbwechsel erinnert an die Alhambra, farbig leuchtende Fayencen durchsetzten die Außenhaut der Fassade wie Edelsteine. Doch unwillkürlich verrät sich das Herrschaftsverhältnis in dieser neo-morisken Architektur. Die Ziegelmauer, jene von den Arabern erlernte Bautechnik, beschränkt sich auf das Untergeschoß. Die belle étage adelt abendländische Neugotik in Form von zweilanzettigen Maßwerkfenstern, während das moriske Motiv des Vielpasses in der Zwerggalerie ins nämliche Untergeschoß verbannt ist. Diese historistische Architektur hat den kolonialen Akt der reconquista semantisch verinnerlicht. Die Kannibalisierung einer Fremdkultur findet seinen Abschluss, wenn das unterworfene Andere als das Eigene ausgegeben wird. Maurische Vergangenheit ist dann altspanische Tradition geworden. 176 Abb. 9: Paul Gauguin, Krug in Form eines Selbstporträts, 188915 Kannibalisierung beschränkt sich nicht auf konventionelle Stilmaskeraden. Die Kunst der Avantgarde verfährt in gleicher Weise. Im Winter 1889, die Exposition Universelle hatte eben ihre Pforten geschlossen, modellierte Paul Gauguin ein Selbstporträt in Form eines Trinkgefäßes (Abb. 9). Das Abbild seines Kopfs erscheint als Opferschale für einen unbekannten Kult. Angeregt wurde die sonderbare Form durch Erinnerungen an seine Kindheit, die er mit der Familie in Peru verbracht hatte. Seine Mutter sammelte präkolumbianische Keramik, darunter Kopfgefäße der Mochita-Indios. Die nar15 Peru, Peabody Museum, Harvard University. 177 zisstische Identifikation mit dem Andern im kulturellen Spiegelstadium zeigt viele Facetten, die wir in der gebotenen Kürze nicht beschreiben können. Eine davon vollzieht sich in Gauguins Werk: Die Existenz des Andern macht mir bewusst, dass auch ich ein Anderer bin. Zwei Jahre nach der Expo reiste der Maler nach Tahiti, um der Exotik der schönen Mädchen nachzureisen, die in jener Metropole der Spektakel aus vergänglichen Kulissen gearbeitet hatten. Was die Kunst betrifft, so zeitigte diese örtliche Verschiebung, getrieben von einem imaginären Wunsch, eine erneuernde Wirkung. Was das Privatleben des Künstlers betrifft, so fielen dessen Erfahrungen ernüchternd aus. Das Ideal-Ich lässt sich in keinem Abenteuer, so real es auch sei, je erhaschen. Literatur Bergson, Henri. Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris 1927. Deleuze, Gilles. Das Bewegungs-Bild, Kino 1, Frankfurt a.M. 1989. Evans, Dylan. An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis, London 1996. Lacan, Jacques. «The mirror stage as formative of the function of the I (1949)». In: Ders. Écrits. A selection, Paris 1977, S. 1–7. 178 Mediale Konfigurierung eines Ereignisses. Der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 Dietrich Erben Es gehörte zum Konsens in der politikwissenschaftlichen Forschung, dass der Terrorismus eine «Kommunikationsstrategie»1 sei. Diese Überzeugung wird zum Schlagwort mit dem viel zitierten Satz von Brian Jenkins, der als Terrorismusberater für die US-Regierung fungierte, wonach «Terroristen wollen, dass viele Leute zuschauen, nicht, dass viele Leute sterben».2 Mochte diese Formel denn überhaupt von analytischem Gehalt sein, so hat sie sich spätestens mit den Massenmorden als terroristischen Akten erledigt. Offensichtlich beruht das Verständnis vom Terrorismus als einer medial vermittelten, symbolischen Gewalt auch auf der linguistischen und ikonischen Wende in den ästhetischen und historischen Wissenschaften. Diese beruht – grob gesagt – auf der Behauptung, dass sprachliche oder visuelle Kommunikation ein geschlossenes Referenzsystem ist, hinter dem die wie auch immer geartete historische Realität nicht mehr zu erreichen ist. Man muss dieser Zuspitzung aber nicht folgen. Die Anschläge auf das Welthandelszentrum in New York waren kein Bild, sondern eine Handlung höchst verschiedener Akteure. Sie waren auch dann kein Bild, als wir als Fernsehzuschauer dem Töten beiwohnen konnten, und die Fernsehbilder die Gleichzeitigkeit von Geschehen und Abbildung sicherstellten. Auf der Faktizität des Attentats, die Medienwissenschaftler und Kunsthistoriker in bisweilen erschreckender Weise aus den Augen verloren haben, 1 2 Waldmann (1998), 13: Einleitende Definition: «Terrorismus, das gilt es festzuhalten, ist primär Kommunikationsstrategie». Vgl. ebd. 48, 56ff., 191. «Terrorists want a lot of people watching, not a lot of people dead»; Interview mit Brian Jenkins 1988; www.lib.uci.edu/quest/index.php?page=jenkins. 179 Abb. 1: Das World Trade Center beim Anflug des zweiten Flugzeugs auf den Nordturm, TV-Stills soll beharrt werden, wenn im Folgenden von der medialen Vermittlung der Ereignisse vom 11. September 2001 die Rede ist. Dabei richtet sich das Augenmerk nicht auf die Intentionen der Attentäter und damit auch nicht auf deren Absicht, eine globale Medienöffentlichkeit zu erreichen. Es geht um die unmittelbaren Folgen der Attentate auf der Ebene der Bildlichkeit, das heißt um Bildentwürfe als Teil des Umgangs der US-amerikanischen Gesellschaft mit dem Terrorismus. Das Interesse gilt dem Prozess, in dem sich das Geschehen des Attentats zu einem historischen Ereignis konfigurierte, und der Frage, in welcher Weise dieser Prozess als gesellschaftliche Konsensbildung aufzufassen ist. Damit sind im Grunde auch die inhaltlichen und methodischen Akzente der folgenden Überlegungen angedeutet. Unter medialer Konfigurierung verstehe ich – in Analogie zur Computersprache – einen Vorgang der Systemanpassung: Die Bilder, die das New Yorker Attentat am 11. September 2001 hervorbrachte und die seither produziert wurden, um das Ereignis bildlich zu repräsentieren, wurden in Medien und Politik schrittweise mit einem Kommentarrahmen versehen, indem sie konventio- 180 nellen Bilderfahrungen und Verständnisgewohnheiten angepasst wurden.3 Man hat sie damit aber auch auf politische Interessen einjustiert und zu Bildakteuren aufgewertet. Dabei wurden sie auf der einen Seite der bloßen alltäglichen Vorgänglichkeit enthoben und sie dienten dazu, das Geschehen vom 11. September als historisches Ereignis zu konstituieren. Auf der anderen Seite wurde das Ereignis durch Bilder mit historischen Vergleichen angereichert, um das Ereignis selbst verstehbar zu machen und um daraus Handlungsoptionen für die Zukunft zu begründen. I. Die Rekapitulation der Vorgänge und die Bildpolitik Die Betrachtung der aus einer Filmsequenz geschnittenen Fotos erzeugt beim Betrachter den Reflex, die Bilder gemäß der eigenen Erinnerung zum Geschehensablauf zu komplettieren (Abb. 1). Nachdem das erste von den Selbstmordattentätern entführte Flugzeug um 8.46 Uhr Ortszeit in den nördlichen Turm des Welthandelszentrums in New York gerast war, wurde das zweite Flugzeug eine Viertelstunde später in den Südturm gelenkt. Aus südlicher Richtung aufgenommen zeigen die Bilder den bereits getroffenen Nordturm, aus dem Rauchschwaden steigen, und den Anflug sowie den Einschlag des zweiten Flugzeugs in den anderen Turm. Die Explosionen im Einschlagbereich der von den Terroristen als Raketen benutzten Passagiermaschinen führten zum Zusammensturz der in ihrem äußeren Erscheinungsbild identischen Zwillingshochhäuser. Als am Morgen des 11. Septembers 2001 um halb elf Uhr Ortszeit der zweite Turm des World Trade Centers in sich zusammenstürzte, waren nach dem Einschlag des ersten Flugzeugs knapp zwei Stunden vergangen. Das Niedersinken des Südturms und dann des zuerst getroffenen Nordturms vollzog sich wie in einer Zeitlupe, die vom Riesenmaß der 417 Meter hohen Türme erzeugt wurde und deren Dimensionen zuletzt noch einmal sichtbar werden ließ. Von den Türmen blieb am ehemaligen Standort der Hochhäuser an der Südspitze von Manhattan ein immenses Ruinenfeld zurück, für das in Analogie zum Epizentrum einer 3 Allgemein zur Bildpolitik vgl. Hofmann (2006). 181 Atombombenzündung die Bezeichnung ground zero gebräuchlich wurde. Die Schuttmassen bargen für Monate die Überreste der Toten. Nach offiziellen Angaben sind bei den Attacken 3.066 Menschen ums Leben gekommen, mehrere zehntausend Menschen wurden verletzt. In vieler Hinsicht sind die Anschläge vom 11. September 2001 in der Geschichte des Terrorismus ein bis dahin neuartiges Ereignis gewesen.4 Gleichzeitig stehen sie aber auch als drastische Steigerung in der Kontinuität eines kriegs- oder bürgerkriegsartigen Terrorismus, der seinerzeit schon seit gut anderthalb Jahrzehnten zu beobachten gewesen war. Diese ambivalente Einschätzung betrifft wenigstens vier Faktoren: 1. die zerstörerische Dimension der Anschläge auf die USA; 2. die ihnen zugrunde liegende Planungsstrategie; 3. die weltpolitischen Folgen der Attentate und nicht zuletzt 4. ihre unmittelbar erzeugte und bis heute andauernde mediale Gegenwart. Die gesamte, mit insgesamt vier Flugzeugen geplante Attentatserie beruhte auf einem vorher nicht bekannten Maß an geheim gehaltener Logis­ tik und Koordination. Die weltpolitischen Konsequenzen stehen mit einem immens gesteigerten, weltweiten zivilen Sicherheitsbedarf und mehreren Militärinterventionen seitens der USA außer Frage. Gleichzeitig bleiben die Kontinuitäten zu bedenken, denn natürlich haben sich die Lebensrealitäten der überwältigenden Mehrzahl von Menschen gar nicht oder allenfalls beiläufig verändert. Am 11. September eskalierte ein Ausmaß an terroristischer Gewalt, die auch schon vorher hätte ernst genommen werden müssen. Alles in allem ist der viel beschworene Satz, nach dem 11. September sei «die Welt nicht mehr wie vorher», zugleich richtig und falsch. Die Formel hatte von Anfang an einen beschwörenden Gestus und ihr haftet der Beigeschmack einer instrumentellen Phrase an. Wer sie aufruft, meint: Was noch nicht ist, wird schon noch werden. 4 Die Literatur zu den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 in den USA stellt sich mit zahllosen Beiträgen von der politischen Analyse über den individuellen Erfahrungsbericht bis zur idiosynkratischen Verschwörungstheorie als kaum überschaubar und höchst disparat dar. Die hier zugrunde liegende historische und politische Einschätzung der Ereignisse verdankt maßgebliche Anregungen Rapoport (1988); Münkler (2002); Sofsky (2002); Waldmann (2003); Pedahzur (2005); Schneckener (2006); Wright (2007); Sageman (2008). 182 Eine ähnliche Ambivalenz von Alt und Neu, wie sie das Geschehen selbst kennzeichnet, gilt auch für die Bilder von den Attentaten und der Zeit danach.5 Die Bildgeschichte dokumentiert sich in der Fülle visueller Mitteilungen in der Spannbreite vom Video über das Pressefoto und die Internetsequenz bis zum Kunstbild. Üblicherweise sind Terrorattentate erst im Augenblick, in dem die destruktiven Folgen sichtbar sind, öffentlich und damit für die Bildberichterstattung zugänglich. So will es die Logik des Überfalls, der Terrorattentate immer gehorchen. Hingegen waren am 11. September durch die serielle Abfolge der Anschläge nicht nur die Folgen der Zerstörung sichtbar. Wie es die Fotos zeigen, richteten sich die Kameras auf den Moment der zerstörerischen Aktion selbst, die in ihrem sequentiellen Ablauf die terroristische Willkür der Verbreitung von Schrecken noch steigerte. Die Bildlichkeit der gesamten Attentatserie war von Beginn an von den Aufnahmen der Twin Towers in New York dominiert. Dies hatte vor allem mit dem Simultanwert der Aufnahmen zu tun, durch die man als Fernsehzuschauer in Echtzeit den Angriffen, der Destruktion und den Rettungsmaßnahmen beiwohnen konnte. Die Filmaufnahmen machten in ihrem dokumentarischen Status nicht nur die Zerstörung der Wolkenkratzer ablesbar, mit dem Sehen war auch das Wissen um eine Unzahl von Menschen verbunden, die während des Betrachtens der live ausgestrahlten Bilder durch die Zerstörung der Gebäude starben. Man hat von Anfang an konstatiert, dass die Filmsequenzen von den in die Hochhäuser hinein rasenden Passagierflugzeugen jedweden Erklärungskontext des Geschehens verweigerten.6 Flugzeuge und Hochhäuser sind höchst unterschiedliche Werkzeuge. Während erstere Bestandteile eines hoch technisierten Massenverkehrssystems sind, beherbergten die Wolkenkratzer im New Yorker Financial District die Büros einer hoch verdichteten Finanzbürokratie. Die Passagierflugzeuge und die Türme wurden ineinander zerrieben, waren aber in ihrer parallelen Zerstörung rational nicht aufeinander zu beziehen. Die in den Stunden nach den Anschlägen nicht enden wollende, 5 6 Zur medialen Vermittlung und zur Bildlichkeit des 11. Septembers vgl. Schicha / Brosda (2002); Schwerfel (2002); Fricke (2003); Beuthner u.a. (2003); Leggewie (2004); Werckmeister (2005); Kröner (2008). Dies konstatieren bereits die ersten Augenzeugenberichte und Analysen; vgl. die Sammlung von Aufsätzen in: Morrison u.a. (2001). 183 über weite Strecken unkommentierte Wiederholung der Aufnahmen zielte offensichtlich darauf ab, das Geschehen als realen Vorgang überhaupt erst einsichtig zu machen. Es mag sein, dass die permanente Wiederholung die wohl bei jedem Zuschauer auf Anhieb vorhandene Assoziation an einen fiktiven Filmplot, dessen Spannungsmoment ja entscheidend in seiner Plötzlichkeit und Einmaligkeit liegt, tilgen sollte. So kam es zunächst zu einer Paralyse der Filmreportage, die durch den tatsächlichen Ablauf des Geschehens in groteske Nähe zu Actionfilmen gelangt war. Durch die andauernde Wiederholung der Filmsequenzen mit eingeblendeten Kommentarstreifen distanzierte sich die Reportage wieder vom Thriller. Vielleicht schwerer als die Orientierungslosigkeit, die durch die Überlagerung zweier Filmgenres zustande kam, wog es, dass in den ersten Bildern keine Akteure erkennbar hervortraten. Eine Selbstmitteilung der Attentäter nach ihrer Tat war durch die Suizide der Terroristen ausgeschlossen, es gab aber auch keine schriftliche oder bildliche Botschaft der terroristischen Zentrale. Anders als frühere Terrorbewegungen hielt es von den verantwortlichen Hintermännern niemand für nötig, sich zu erklären oder die Tat zu rechtfertigen. Da ideologische und religiöse Begründungen auch lange danach ausblieben, fehlte für die ersten Fernsehbilder der Attentate zunächst auch ein Verständnisrahmen. Nach dem ersten Erstaunen über den Realitätsgehalt der Bilder sprach aus ihnen nichts anderes als die schiere Gewalt des Faktischen. Auf die faktizistische Bildlichkeit der ersten Stunde und das Schweigen der Akteure antworteten bildliche Kommentierungen. Schon einen Tag nach den Attentaten wurde die Fotografie von drei Feuerwehrleuten, die in den Ruinen des World Trade Centers die amerikanische Flagge hissen, publiziert (Abb. 2). Die Fotografie ist in vieler Hinsicht ein Traditionsbild mit Identifikations- und Appellcharakter, als solches ist sie auch ein Gegenbild zu den ersten Fernsehaufnahmen. Sie stammt von dem Fotografen Thomas E. Franklin und wurde am 12. September 2001 erstmals als Titelfoto der Zeitschrift The Record veröffentlicht. Allein schon die gegenüber dem Fernsehfilm traditionsgebundene Gattungswahl des Pressefotos zeigt, dass das Bild nicht nur einen dokumentarischen Wert verbürgen soll, sondern auch für einen individuellen Betrachter kalkuliert ist. Dies gilt umso mehr für die Darstellung selbst. Drei Feuerwehrleute haben in schwerer Montur in den Ruinen 184 Abb. 2: Thomas E. Franklin, Feuerwehrleute beim Hissen der amerikanischen Flagge in den Ruinen des World Trade Centers 2001, Pressefotografie des World Trade Centers Stellung bezogen, sie folgen offensichtlich dem militärischen Reglement der Flaggenparade. Zwei hantieren gemeinsam am Seilzug der halb gehissten Nationalfahne. Der dritte Feuerwehrmann hat sich 185 etwas abseits gestellt und den Kopf noch weiter als die beiden anderen in den Nacken geworfen, um die Aktion zu beaufsichtigen und ihrem Abschluss erwartungsvoll entgegenzusehen. Es bleibt offen, ob die Männer die Flagge auf Halbmast setzen wollen oder ob sie bis zum Ende des Mastes hoch gezogen werden soll. Die Gruppe ist auf einem diagonal ansteigenden Schuttplateau in Positur gegangen, dessen Kontur von der Linie der drei Köpfe nachgezeichnet wird. Der Fahnenmast ist in der Gegendiagonale aufgerichtet, wobei das Sternenfeld der Flagge genau im Bildzentrum fixiert ist. Eine den linken Bildrand vertikal durchmessende Säule stabilisiert dieses Gefüge architektonisch. Die bereits mit diesen Mitteln erzeugte Bildordnung wird schließlich durch die scharfe, durch Licht und Staub überzeichnete Modellierung der Personengruppe vor dem diffusen Hintergrund gewährleistet. Die Schuttberge sind unscharf aus dem Fokus der Kameralinse gerückt und türmen sich formatfüllend als Steilwand unbestimmbarer Ausdehnung auf. Dem rückwärtigen Chaos scheint eine Szenerie provisorischer, aber immerhin rudimentär wieder gewonnener Ordnung regelrecht abgerungen. Kaum hat man sich diesen Bauplan der Bildregie vor Augen geführt, so stellen sich Nachfragen im Hinblick auf die motivischen und inhaltlichen Dimensionen des Fotos. Offen bleibt etwa die Herkunft des Flaggenmasts. Er mag ins Ruinenfeld geschleppt worden sein oder es mag sich um eine aus den Trümmern herausgelesene Stange handeln, die mit einem Rollenzug zum Flaggenmast improvisatorisch zurechtgerüstet wurde. Bei beiden Optionen bleibt die schiefe Aufrichtung allerdings auffällig genug. Man kann außerdem eine dünne Stange erkennen, die offenbar als zu leicht befunden und zur Seite gestellt wurde. Dieser Sorgfalt bei der Auswahl der Utensilien entspricht am Ende das zeremonielle Reglement, das über der gesamten Szenerie des Flaggenappells waltet. Die Feuerwehrleute sind während ihrer gefährlichen Rettungs- und Sicherungsarbeiten in den Ruinen des Welthandelszentrums in einem gemeinschaftlichen, patriotischen Akt des Innehaltens vor Augen gestellt. Die scheinbare Momentaufnahme erweist sich endgültig als ein Produkt minutiös kalkulierter Bildregie, als sie sich – natürlich – einer älteren Bildformel verdankt. Es handelt sich um Joe Rosenthals berühmtes Foto aus dem Zweiten Weltkrieg, das die Aufpflanzung der amerikanischen Flagge auf Iwo 186 Jima am 23. Februar 1945 zeigt. Rosenthals Foto erinnert an die verlust­reiche Eroberung der Pazifikinsel, die die Landung der Amerikaner in Japan einleitete. Die Aktion einer fünfköpfigen Gruppe von Soldaten, die in energischem Vordringen eine Fahnenstange ins öde Gelände einrammen, ist eine durch und durch nachgestellte Inszenierung. In vielfältigen Reproduktionen rückte das Foto in den populären Bestand der amerikanischen National­ikonografie ein.7 Es wurde nach dem Krieg als Briefmarke ausgegeben. Im Marinedenkmal auf dem Soldatenfriedhof in Arlington erfuhr es eine monumentale Steigerung zur Bronzegruppe. Edward Kienholz hat es auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges einer kritischen Revision unterzogen, als er in dem Environment The Portable War Memorial (Köln, Museum Ludwig) die Gruppe zu einer Figurenassemblage technoider, leerer Hüllen umfunktionierte. Auf diese Weise im Bildgedächtnis verankert, genügte der Aufruf weniger Signalmotive, um bei dem Aktionsbild der New Yorker Feuerwehrleute mit dem schräg gestellten Flaggenmast als Sammelpunkt einer Gruppe von Uniformierten die historische Referenz unmissverständlich mitzuliefern. Für die Bedeutung des Fotos hat diese Referenz immense Folgen. Erst durch den Rückverweis auf die Ikonografie des Zweiten Weltkriegs wird es dem Betrachter ermöglicht, die Leerstellen des Bildes zu schließen und letztlich das Attentatsgeschehen des 11. Septembers als historisches Ereignis – nämlich in Analogie zu den Schlachten des Zweiten Weltkriegs – einzuordnen. Das Foto der Feuerwehrleute erscheint vor der Folie des «Iwo Jima»-Fotos auf eine ganz paradoxe Weise als ein ziviles, aber gleichermaßen triumphales Eroberungsbild. Dieser Gehalt hat wesentlich mit dem Ruinenfeld des ground zero zu tun, das nun in der Gattungstopik des Schlachtenbildes ebenso als Schlachtfeld wie als erobertes Territorium zu begreifen ist.8 Ruinenbilder von Hochhäusern dieser Dimensionen erwiesen sich nach dem 11. September als ein neuer Anblick. Moderne Hochhäuser waren mit ihrer geschichtslosen Oberfläche zuvor nicht als Ruinen denkbar gewesen. Natürlich wurden auch Hochhäuser immer wieder in Sprengungen niedergelegt, bei solchen Zerstörungen handelt es sich aber um planmäßig organisierte Abbruchkampagnen, 7 8 Vgl. Marling / Wetenhall (1991); Scorzin (2003); Schmidt (1988); zur Fotografie von Jenkins vgl. Mügge (2005). Vgl. Hüppauf (2002). 187 bei denen von den Bauten in der Regel keine Ruine, sondern eine säuberlich ausgebreitete Schutthalde übrig bleibt. Nach dem 11. September hat man sich recht bald an die Sprengung der Wohnsiedlung Pruitt-Igoe in Saint Louis erinnert. Diese war von Minoru Yamasaki, dem Architekten der Twin Towers, geplant und knapp zwei Jahrzehnte nach ihrer Fertigstellung im Jahr 1972 schon wieder gesprengt worden. Die Rhapsoden der Postmoderne feierten das Foto als Fanal des Scheiterns der funktionalistisch­en Moderne.9 Im Gegensatz zu solchen Sprengungen haben die Attentate auf das Welthandelszentrum gigantische Ruinenreste hinterlassen. Sie waren für die Rettungskräfte gefährlich wie Minenfelder. Am Tag der Attentate und in den darauf folgenden Tagen starben 343 Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit in den Ruinen. Das Foto von den Feuerwehrleuten wies der Wahrnehmung eine Richtung, die Ruinen als Überreste eines Schlachtfeldes nach dem Bombardement aufzufassen. Diese Konnotation wird schließlich überlagert von der Topik des eroberten Territoriums. Denn nach dem Eindringen der Terroristen in das Staatsgebiet der USA dokumentiert das Bild eine symbolische Rückeroberung des Landes. Auch dieser fundamentale Gehalt des New Yorker Fotos begründet sich entscheidend aus dem Rückverweis auf die Bildlichkeit des Zweiten Weltkriegs. Ging es bei der Aufrichtung des Sternenbanners auf Iwo Jima um die territoriale Eroberung des Pazifikraumes, so wird dieselbe symbolische Handlung im New Yorker Bild für die Restituierung der territorialen Integrität des Landes in Dienst genommen. Erst so wird es erklärbar, dass das New Yorker Foto auch wieder zurück ins Kriegsgeschehen eingespeist werden konnte. Dies dokumentiert ein Anfang Dezember 2002 aufgenommenes Foto von Soldaten der amerikanischen Invasionstruppen in Afghanistan, die der geläufigen Regieanweisung gemäß die Nationalflagge aufrichten. Bei der Flagge handelt es sich um ein Geschenk der New Yorker Feuerwehr, die sie zusammen mit der Stadtfahne von New York den Invasionstruppen vermachten. Die noch viele Jahre später in Autos und an Gebäuden aufgehängte und damit im New Yorker Stadtbild allgegenwärtige Fotografie der Feuerwehr9 Zur Geschichte der Fotos von der Sprengung des Wohnkomplexes Klotz (1999), 76f. sowie die Fotoillustrationen in Jencks (1977) und Wolfe (1981). 188 leute in den Ruinen des World Trade Centers macht eine Mitteilung, deren Verständnisrahmen in den öffentlichen politischen Diskussionen und offiziellen Verlautbarungen abgesteckt ist. Zugleich erfahren diese Debatten in dem Bild eine sinnfällige Umsetzung und Bekräftigung. Die Titulierung der Attentate als «Krieg» gegen die USA war schon in den ersten Schlagzeilen aufgetaucht und wurde spätestens drei Tage später Teil der offiziellen politischen Doktrin eines militärischen Gegenschlags. Diese Strategie wurde in den darauf folgenden Monaten unter dem Stichwort des globalen war on terror zum zentralen außenpolitischen Paradigma der Bush-Administration erhoben.10 Die eminente Tragweite dieser Entscheidung hat sich in den Jahren seit 2001 mit den Interventionen in Afghanistan und im Irak gezeigt. Der Gleichsetzung von Terrorismus und Krieg wurde zusätzlich Vorschub geleistet durch den historischen Vergleich der Anschläge mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, der die USA im Dezember 1941 zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg veranlasste. Insofern erscheint es als ein konsequenter bildstrategischer Zugriff, für das New Yorker Foto eine Bildepisode aus dem Pazifikkrieg zu reaktivieren. Das Foto, das auf ein militärisches Gepräge weitgehend verzichtet, erscheint so als ein Appell an die amerikanische Zivilgesellschaft, sich der Kriegsoption als Antwort auf die Attentate anzuschließen. Gleichermaßen entscheidend ist, dass sowohl auf der Ebene der politischen Debatten wie auf der Ebene der bildlichen Äußerungen eine Historisierung des Geschehens vollzogen wurde. Die Attentatserie wurde in eine historische Kontinuität eingereiht und die Bildlichkeit war wieder in den Stand gesetzt, den zunächst ausgebliebenen, nun freilich auch erheblich ideologisierten Verständigungsbedarf über das Ereignis zu befriedigen. Die Historisierung der Attentate im Sinne von deren Zurückbindung in eine geschichtliche Kontinuität blieb bei ihrer bildlichen Kommentierung und Deutung ein Grundanliegen. Sie konnte freilich weit weniger staatstragend ausfallen als auf dem Foto von den Feuerwehrleuten. Im bildlichen Niederschlag, den das Ereignis jenseits der ikonisch erstarrten Fotografien bald nach den Attentaten gefunden hat, gehört eine im Internet veröffentlichte 10 Die Literatur zum war on terror ist mittlerweile immens; vgl. nur die neueren Untersuchungen aus kriegsideologischer und mediengeschichtlicher Sicht Jackson (2005); Steuter / Wills (2008); Mackiewicz (2008); Steger (2008). 189 Abb. 3: Auszug aus der Bildsequenz «Touristguy», Oktober 2001, im Internet veröffentlichte Bildserie Sequenz von Fotomontagen zu den irritierendsten und eindrücklichsten Zeugnissen. Die Serie wurde Anfang Oktober 2001 ins Netz gestellt und umfasste mehrere Dutzend Bilder. Danach wurde sie beträchtlich erweitert und auch in Teilen überarbeitet. Die Abbildung zeigt eine Montage der ersten Fassung vom Oktober 2001 (Abb. 3). Die Bildfolge stellt einen Mann, der als Touristguy abrufbar ist, fast identisch wiederkehrend, ausdruckslos und eigentümlich blasiert vor einer Bildchronik von Katastrophen dar. Die Explosion des Zeppelin in Lakehurst 1937, der Absturz der Concorde-Maschine in Paris 2000, die Atombombenabwürfe in Japan 1945, die Zerstörung des World Trade Centers 2001 – die Ereignisorte scheinen dem Touristguy jenseits seiner Anwesenheit nicht viel zu bedeuten. Auf dem Dach des World Trade Centers findet er sich fatalerweise noch rechtzeitig zum Anflug des Flugzeugs ein. Es mag sich erübrigen, auf die einzelnen Bilder detaillierter einzugehen. Die Serie verleugnet ja keineswegs den Charakter des zusammen gelesenen, eilig fabrizierten Trashs, wie er dem ephemeren Medium des Internets auch nur zu angemessen ist. Im Gegenzug stellt sich die Bildsemantik aber als ganz und gar nicht banal heraus. Der Tourist ist ein Wiedergänger durch die Historie, der durch Zeiten 190 und Räume hindurch stets zur Stelle ist. Der enzyklopädische Sammler von Sensationen erweist sich darüber hinaus auch als ein Aktivist des globalen Sightseeing. Das New Yorker Attentat, das immerhin den Anlass für die retrospektive Ausarbeitung der Bildfolge gab, reiht sich völlig unauffällig in die Serie ein. Das Ergebnis führt einen auf Abwege. Denn die Historisierung des Geschehens leistet nicht der Relativierung der einzelnen abgebildeten Ereignisse Vorschub, sondern fügt nur jeder Katastrophe eine weitere hinzu. Mit dieser Einreihung der Terroranschläge des 11. Septembers in eine nicht enden wollende Chronik von Katastrophen wird durch die Bildserie eine ins absurde Extrem vorangetriebene Konventionalität der New Yorker Attentate behauptet. Der so verstandene Rekurs auf eine geschichtliche Konvention ist bereits im Bildtypus der Fotomontagen angelegt. Offensichtlich ist die Formel des Andenkenfotos, die ihre Wurzeln im Reiseporträt des 18. Jahrhunderts hat, geradezu insistierend monoton reproduziert. Ein berühmtes Beispiel ist das von Wilhelm Tischbein 1787 gemalte Porträt, das Goethe vor den antiken Ruinen in der römischen Campagna zeigt (Frankfurt, Städelsches Kunst­ institut). Gemäß dem populären Bildtypus soll die Postierung des Reisenden an einem signifikanten Ort seine Augenzeugenschaft und darüber hinaus die innere Affinität des Reisenden mit dem Ziel der Reise beglaubigen. Das Schema der Zuordnung von Person und Hintergrund signalisiert den neuen, durch die Reise gewonnenen und erweiterten Erfahrungshorizont. Nun sind auf den Fotomontagen im Hintergrund des Internet-Touristen aber nicht dauerhafte Wahrzeichen abgebildet, sondern plötzlich hereinbrechende Ereignisse. Die für den arglos Anwesenden letztlich tödlichen Katastrophen werden in der Bildfolge arretiert, das Ereignis wird mit einem monumentaldauerhaften Wahrzeichen gleich gesetzt. Da es sich bei den Ereignissen um Katastrophen handelt, wird auch deren Wahrzeichenwert ins Destruktive gewendet. Die ebenso distanzierte wie aussichtslose Hintergründigkeit des Bildes vom emblematischen Wanderer geht zu den offiziell verordneten Bildwelten über das New Yorker Ereignis auf denkbar weite Distanz. Auch hier wird eine Historisierung erkennbar, nun ist sie aber nicht mehr in den Dienst der Affirmation gestellt, sondern bietet einen illusionslosen Gegenentwurf. 191 Abb. 4: John Baldessari, Two Highrises (With Disruption) / Two Witnesses (Red and Green), 1990. Übermalte Farbfotografie, Los Angeles, Museum of Contemporary Art. 192 Trotz dieser skeptischen, geschichtskritischen Tendenz äußert sich auch in der Bildserie der Fotomontagen das Grundanliegen geschichtlicher Einordnung und Historisierung. Die Attentatserie des 11. Septembers war nicht nur ein Gewaltausbruch gegen Menschen, sondern auch ein Anschlag auf Geschichtsbilder. Dadurch, dass in der Bildserie ein Geschehen zum Wahrzeichen und ein Ereignis zum Monument umformuliert werden, verweist sie auf das Problem des Ereignisses selbst. II. Der Begriff des Ereignisses Es ist ein seltsamer Zufall, dass die Differenz von historischem Ereignis und Alltagsgeschehen in einer Fotomontage von John Baldessari ausgerechnet am Beispiel der Zerstörung des World Trade Centers bildlich durch­exerziert wurde. Die Fotomontage entstand bereits 1990, also lange vor den Anschlägen (Abb. 4).11 Das Doppelbild zeigt im oberen Teil ein Personenpaar in der Kleidung der späten 60er Jahre, ein Mann steht neben einer Frau mit Hand- und Einkaufstasche. Vor die Gesichtsfelder sind ein roter und grüner Punkt gesetzt, ein bei Baldessari wiederkehrendes Motiv, das seine Herkunft im Blick durch den Sucher einer Kamera oder in den bei Sehtests verwendeten Probefarblinsen hat. Die Gesichter werden durch die in den Grundfarben aufgemalten Venylpunkte fokussiert aber auch verborgen. Die kreisrunden Leerstellen verdecken die Gesichter, und der Betrachter ist durch die gleichzeitige Markierung und Tilgung der Gesichter herausgefordert, sich die Physiognomien der Personen vorzustellen. In der unteren Bildhälfte erscheinen die Twin Towers im Moment der Destruktion. Unter einem vom Himmel hereinrasenden Feuersog zerbersten die oberen Bereiche der Türme und scheinen sich in den Schlieren der Materialfragmente ineinander zu verschlingen. Die Zwillingstürme und das Personenpaar darüber sind axial aufeinander bezogen. Bei allen offensichtlichen Kontrasten ist es die Paarbildung als Verkörperung einer perfektionierten oder zumindest konventionell akzeptierten Ordnung, die Baldessari zu deren künstlerischer Infragestellung 11 Vgl. Aigner (1999), 125; zum Werk vgl. Baldessari (1999); Ders. u.a. (2009). 193 provoziert hat. Die angespannte Beziehung zwischen der oberen und unteren Bildhälfte ist auch im Bildtitel aufgenommen: Two Highrises (With Disruption) / Two Witnesses (Red and Green). So wie in der Fotomontage anonyme Figur gegen Figur gestellt ist, so sind im Titel Begriff gegen Begriff gesetzt. Durch den Titel wird auf das in beiden Fotos latent vorhandene gemeinsame Thema angespielt. Gezeigt werden eine banale Alltagssituation und das katastrophale Ereignis. Beide treten in Baldessaris Arrangement in einen formalen und inhaltlichen Dialog mit offenem Ausgang. Beide Bilder bilden Ausschnitte aus Handlungssträngen ab, es bleibt aber unklar, ob sich diese verknüpfen lassen. Baldessaris combined photograph verweist durch die Parallelität der Abbildung auch auf die mögliche Simultaneität des Geschehens: In der Imagination des Betrachters passieren das Alltagsgeschehen und das katastrophale Ereignis gleichzeitig. Baldessaris Werk reflektiert eine Differenz, die auch in der historiographischen Methodendebatte während der letzten drei Jahrzehnte wieder in den Vordergrund gerückt ist und im Zuge derer der Ereignisbegriff eine nachdrückliche Aufwertung erfahren hat.12 Als ein entscheidendes Kriterium dieses Begriffskonzepts erscheint die Tatsache, dass Ereignisse als ebenso unerwartet wie außergewöhnlich wahrgenommen werden. Nach einer Formulierung von Reinhart Koselleck zeitigt jedes Ereignis «mehr und zugleich weniger als in seinen Vorgegebenheiten enthalten ist: daher seine jeweils überraschende Novität».13 Die Qualitäten des Überraschenden und Außerordentlichen prägen beim Ereignis jedoch nicht nur das Verständnis einzelner Zeitgenossen, sondern erreichen einen sozial geteilten, kollektiven Erfahrungs- und Erwartungshorizont, der durch breit vermittelte Geschichtstraditionen und gemeinsam verbindliche Konventionen konturiert wird. Ereignisse sind – so hat sie Andreas Suter bezeichnet – «kulturelle Schöpfungsleistung kollektiver Akteure».14 So wie sie in der zeitgenössischen Wahrnehmung aus der Wirklichkeit hervorbrechen, kommt ihnen selbst ein die Realität verändernder Charakter zu. Beruht einerseits die Individualität 12 Vgl. Koselleck / Stempel (1973); Verhein (1990); Blänker / Jussen (1998); Suter / Hettling (2001); Erben (2002); Hölscher (2003). 13 Koselleck (1973), 566. 14 So die Definition von Suter (1998), 210. 194 und Veränderungskraft von Ereignissen auf ihrer Differenz zu längerfristig angelegten Strukturen, so verändern Ereignisse andererseits die strukturellen Gegebenheiten, aus denen sie hervorgegangen sind. Am 11. September wurde die anfänglich erlebte Singularität des Ereignisses im Diktum, «die Welt sei nicht mehr wie vorher», in eine Formel gefasst. Mit der Einschätzung des Singulären geht die Wahrnehmung einher, dass ein Ereignis in alle Lebensbereiche diffundiert. Auch diese Vorgänge waren nach dem 11. September beispielhaft in der Berichterstattung der Zeitungen nachzuvollziehen. Das Ereignis bestimmte nicht nur die harten Sektoren der Berichterstattung von Politik und Wirtschaft, sondern auch die Bereiche von Kultur und Sport bis hinein zu den vermischten Meldungen. Der Wahrnehmung eines durch das Ereignis ausgelösten beschleunigten Wandels entsprechen schließlich ebenfalls kollektive Formen der Bewältigung. Dazu gehört eine mehr oder minder konsensfähige Verständigungsformel für die Bezeichnung des Geschehens. Dies war nach dem 11. September an der schrittweisen Eindämmung der Begriffsvielfalt abzulesen. Gegenüber den biblischen Analogien wie Doomsday, den kulturkritischen Benennungen wie Clash of Civilisations oder den sprachlichen Hybridbildungen wie Terrorangriff oder Kamikaze-Attacken setzte sich am Ende der Kriegsbegriff als Bezeichnung für die Angriffe durch.15 In dem Maße, in dem er dann definitorisch die Oberhand gewann, folgte er nicht nur manifesten politischen Interessen. Mit ihm wurde auch das Ereignis zur Geschichtstradition in Relation gesetzt. Diese Verständigungsprozesse und Bewältigungsstrategien sind auf mediale Vermittlung regelrecht angewiesen. Auch diese konstituiert den Ereignisbegriff. Wenn ein Geschehen nicht publik wird, ist es kein Ereignis. Die Bewertung eines Geschehens als Ereignis verdankt sich einer zutiefst visuellen Form der Wirklichkeitserfahrung. Ereignisse sind sowohl in ihren Handlungsträgern, in ihrem Aktionsverlauf wie in ihren Folgen sichtbar. Dies gilt auch für die Aktionen und Destruktionen, die Akteure und Opfer des 11. Septembers. Mehr als Texte dies zu leisten im Stande sind, wird das Ereignis durch die Anschauung glaubhaft. Nicht nur die Fernsehbilder der Angriffe, sondern auch die von den Attentaten provozierten bildlichen Kom15 Hierzu die Dokumentation Die erste Seite (2001). 195 mentare dienten dazu, das Ereignis des 11. Septembers in seiner Evidenz zu konstituieren. Dies verweist eindringlich auf die etymologische Wurzel der historischen Erkenntniskategorie des Ereignisses im Begriff des Eräugens (lat. evidere). Blickt man noch einmal auf die ersten Fernsehbilder der Attentate zurück, so gehört es sicherlich zu den zentralen Aporien, mit denen der Betrachter konfrontiert war, dass die von der Realität erzeugten Bilder einerseits aus den genannten Gründen als bisher ungesehen erlebt wurden, dass sie aber andererseits in der Imagination schon vorweg genommen waren. Die Zerstörung der Hochhäuser des Welthandelszentrums war seit der Fertigstellung der Türme in zahlreichen Kunstwerken zum Thema gemacht worden, und diese Werke entstanden aus jener «terroristischen Imagination, die in uns allen wohnt».16 Es mag genügen, aus der Fülle von Beispielen aus Literatur, Film und Bildender Kunst auf die Fotomontage von John Baldessari hinzuweisen. III. Die Bildmotive und die Frage der Motivation Solche Imaginationen und die Bilder, die von den Attentaten in den dokumentarischen Medien selbst erzeugt wurden, sagen nichts über die Motive der Attentäter und über die Gründe für die Auswahl ihrer Ziele. Die Spekulationen darüber begannen unverzüglich. Dabei evozierten die Bilder des Anschlags wissenschaftliche Gegenbilder, und die Kunstgeschichte griff geradezu reflexhaft zum Bildvergleich. Die Antworten fielen einigermaßen grundsätzlich aus. Einer der häufigsten Vergleiche war die Gegenüberstellung der Twin Towers und mittelalterlicher Stadttore oder Doppelturmfassaden von Kathedralen. Man reibt sich verblüfft die Augen. Solche geradezu absurden Bildassoziationen wären nicht der Rede wert, würden sich mit ihnen nicht weitreichende Deutungsabsichten verbinden. Der Bildvergleich unterstellt auf der einen Seite dem Architekten der Twin Towers solcherart historische Reminiszenzen als Teil seiner Planungsidee. Auf der anderen Seite wurde zugleich insinuiert, die Terroristen hätten ihre Attacken gegen die Idee 16 Baudrillard (2002), 12. 196 westlicher Urbanität ebenso gerichtet wie gegen die christlichen Grundlagen des Abendlandes. Weder die Bilder noch unser Wissen von den Aktionen selbst reichen für solche Behauptungen aus. Der Entwurf des Welthandelszentrums war für lange Jahre ebenso umstritten wie die Bauplanung und -errichtung, die von den Vorwürfen der Korruption, der Gentrifizierung des Stadtviertels und der ökologischen Verantwortungslosigkeit begleitet waren. Erst allmählich fanden die Türme bei der Stadtbevölkerung Akzeptanz und etablierten sich wegen ihrer Aussichtsplattformen als touristische Attraktion. Als der Architekt Minoru Yamasaki die Hochhäuser, die im Jahr 1973 nach nur achtjähriger Bauzeit eingeweiht wurden, entwarf, stellte er sich selbstbewusst in die Tradition des Hochhausbaus seit der klassischen Moderne.17 Bereits Le Corbusier konzipierte nach dem ersten Weltkrieg seine kühnen Stadtentwürfe mit Hochhausrastern, schon hier marschieren die einzelnen Türme mit völlig identisch­en Fassaden auf. Ludwig Mies van der Rohe postierte 1951 am Ufer des Michigansees in Chicago seine North Lake Shore Drive Apartments als Zwillingstürme, die in spannungsvoller Gegenüberstellung ähnlich wie später die am Hudson gelegenen Twin Towers in New York die Stadtsilhouette akzentuieren. Kurz darauf realisierte er ebenfalls in Chicago die Commonwealth Apartments als Doppeltürme. Der Gedanke der völlig identischen Spiegelung eines Hochhauses mochte bei Yamasaki auch durch das serielle Bildprinzip der Pop Art angeregt worden sein. Seit den frühen 1960er Jahren schuf Andy Warhol seine berühmten Porträtreihen im Siebdruckverfahren, in denen er das Verschwinden des Einzelnen in der Masse und die Selbstbehauptung des Individuums gegen seine anonyme Vervielfältigung gleichermaßen zum Thema machte. Ähnlich ist bei den Zwillingstürmen auf ambivalente Weise die Individualität des Solitärs durch die Doppelung sowohl aufgehoben als auch bekräftigt. Die Hochhäuser wurden nicht aus dem Geist der Kathedralbaumeister errichtet, sondern stehen in der Tradition eines aktualisierten Funktionalismus, der sich die Maximierung bei der Ausnutzung des Baugrundes und die bildhaften Qualitäten von Architektur zum Programm gemacht hat. 17 Zu Entstehung, Form und Nutzung des Gebäudes vgl. Gillespie (2001); Andrieux / Seitz (2002). 197 Es gibt bislang weder ein Indiz noch einen Beweis dafür, dass sich die Terroristen des 11. Septembers 2001 bei der Auswahl ihres New Yorker Ziels von anderen Motiven als desjenigen des logistischen Erfolgs leiten ließen. Dies umfasst die Garantie medialer Aufmerksamkeit ebenso wie die radikale Indifferenz im Hinblick auf das eigene Leben und die Anzahl der Opfer. Die Attentate des 11. Septembers zielten auf Negation: An dieser Einsicht kommt gerade auch die seitdem unternommene akribische historische Analyse der Attentate nicht vorbei. Der islamistische Terrorismus ist geprägt von der Inanspruchnahme einer antagonistischen Ideologie, die sich politischer und religiöser Identifikationsmittel reduktionistisch bedient. Die Ideologeme folgen der Notwendigkeit, extrem vielfältige, geographisch weit gestreute transnationale Milieus – der Bogen spannt sich von Pakistan und Afghanis­ tan über Saudi-Arabien, Irak, Iran und den Jemen und Äthiopien bis Ägypten und Nordafrika – zu homogenisieren. Innerhalb des terroristischen Netzwerks handelt es sich meist um adhoc-Koalitionen, deren Programmatik sich auf formelhafte Ziele wie die Berufung auf den Ur-Islam und die Verwirklichung islamischer Würde jenseits von Staat und Nation in Analogie zum Gottesstaat. Eines der wenigen konkreten institutionellen Ziele besteht in der Errichtung des Kalifats.18 All dies kann nicht davon absehen lassen, dass der internationale Terrorismus im strengen Sinn unpolitisch ist. Er ist weder mit einem intentionalen Politikbegriff, der vor allem die Handlungsinte­ressen und -strategien bei der Organisation von Entscheidungen beschreibt, noch mit einem kommunikativen Politikbegriff, der auf ein Verständnis von der Gesamtheit gesellschaftlicher Austauschprozesse abzielt, vereinbar. Der Terrorismus lässt absichtsvoll keinen Raum für verhandelbare Forderungen und bricht mit der Übereinkunft rationaler Verständigung.19 Eine solche Einschätzung zieht auch Konsequenzen dahingehend nach sich, wie die visuellen Zeugnisse der Attentate zu verstehen sind. Sie zeigen die Durchsetzung und die Folgen einer Massendestruktion, die von Seiten der Akteure die vorsätzliche Wahl der verwendeten zerstörerischen Mittel voraussetzt. Jede Absicht, aus den Bildern eine über diese Mitteilung hin18 Vgl. die in Anm. 4 genannte Literatur. 19 Zu dieser Bewertung Enzensberger (1993); Ders. (2006). Zum Politikbegriff vgl. die lexikalischen Hinweise: Sellin (1997); Schulze (2010). 198 ausgehende Symbolik herauszulesen, läuft Gefahr, den Attentaten selbst eine Programmatik zuzuschreiben, die ihnen vermutlich nicht zukommt. IV. Monument und Ereignis: Denkmal- und Wiederaufbaupläne Kein Ereignis – so kann man als Faustformel festhalten – ohne Denkmal. Schon zwei Wochen nach den Attentaten wurde eine Denkmalkommission eingesetzt, die darüber befinden sollte, wie des Ereignisses in monumentaldauerhafter Form zu gedenken sei. Man stellt mit ziemlicher Verblüffung fest, in welchem Ausmaß die Analogie zum Zweiten Weltkrieg auch die Wiederaufbau- und Denkmalprojekte für den ground zero bestimmten. Die ersten Überlegungen der New Yorker Denkmalkommission waren von Rückgriffen auf Erinnerungsformen geprägt, die aus den Jahren des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit bekannt sind. Dies galt für die anfängliche Idee, das Welthandelszentrum in seinen Ruinenresten zu bewahren, ebenso wie für das zunächst erwogene Projekt, die Türme völlig zu rekonstruieren, um mit ihrer ökonomischen Funktion auch ihren Wahrzeichenwert zu restituieren. Für die Ruinen-Option mag nur an die im Zweiten Weltkrieg zerstörte und dann als Ruinenmahnmal bewahrte Kathedrale in Coventry oder an die Berliner Gedächtniskirche erinnert sein. Die zweite Option lässt an den Wiederaufbau zerstörter Städte insbesondere in Osteuropa – wie Warschau oder St. Petersburg – denken. Deutschland hat diese Wiederaufbaudebatte bekanntlich erst im Zuge der Restauration des Gesamtstaates nach 1989 erreicht. Offensichtlich bildete sich in solchen von der New Yorker Denkmalkommission erörterten, historisierenden Rückgriffen auf Erinnerungsmodi, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg eingebürgert haben, erneut die politische Intention ab, die Terrorangriffe als kriegerische Akte zu klassifizieren. Gerade deshalb blieb auch ein Unbehagen gegenüber diesen konzeptionellen Vorschlägen für das Erinnern zurück. Dies gilt auch für das Projekt, die Türme des Welthandelszentrums mit Scheinwerferprojektionen als ephemerfeierliche Lichtarchitektur wiedererstehen zu lassen. Die Lichtinstallation der Twin Towers wurde zum ersten Jahrestag der Anschläge einmalig realisiert. Sie entging nicht der öffentlichen Kritik, weckte sie doch auf fatale Wei199 se Erinnerungen an die von Flakscheinwerfern als Lichtgehäuse erzeugten «Lichtdome», in denen ab 1934 auf dem damaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg nächtliche Kundgebungen abgehalten wurden. Die Kritik ist bei dem ersten, ebenfalls zum Jahrestag öffentlich ausgestellten Versuch, der Erinnerung dauerhaft-monumentale Gestalt zu verleihen, vernichtend ausgefallen. Die Tumbling Woman des New Yorker Künstlers Eric Fischl tauchte in der Woche, in die der erste Jahrestag der Anschläge fiel, vor dem Rockefeller Center in Manhattan auf (Abb. 5). Sie wurde dort in Absprache zwischen der Galeristin Fischls und dem Rockefeller Center postiert. Nachdem das Werk erhebliche Kritik in der Öffentlichkeit auf sich zog, hat das Center selbst umgehend dementiert, die Figur in Auftrag gegeben zu haben. Sie wurde nach einer Woche mit einer Stellwand verhüllt und am Nachmittag des 18. September 2002 wieder fort geschafft. Heute befinden sich die fünf Exemplare, die von der Statue gegossen wurden, in Privatsammlungen. Die lebensgroße Bronzestatue stellt eine gestürzte nackte Frau beim Aufprall auf den Boden dar. Der Ikonografie wurde mit einer sentimental anmutenden Inschrift auf einer Bodenplakette, bei der es sich um ein Gedicht des Künstlers handelt, aufgeholfen: «We watched, / disbelieving and helpless, / on that savage day / People we love / began falling / helpless and in disbelief». In der konfliktträchtigen Rezeption der Statue verstärkten sich wechselseitig die Widersprüche des Werks und die Aporien innerhalb einer Öffentlichkeit, die weder damals noch heute zu einem Konsens über Formen und Inhalte der Erinnerung gelangt ist. Dem Künstler selbst wurde vorgeworfen, er sei zur künstlerischen Auseinandersetzung mit den Attentaten nicht berechtigt, da er sich am 11. September nicht in New York aufgehalten habe. Die Anfeindungen gegenüber Fischls Statue bezogen sich auf die Motivwahl ebenso wie auf die gegenständliche Bildsprache. Der Künstler verletzte das Tabu der Darstellung der Menschen, die sich aus den Fenstern der Hochhäuser zu Tode stürzten. Deren Bilder waren schon früh aus den Endlosschleifen des Fernsehens verschwunden, und man findet sie kaum in den vielen Fotobüchern, die zum 11. September erschienen sind. Verbreitung fand zwei Tage nach den Attentaten das Foto von Richard Drew mit dem Titel The Falling Man, das einen zum Schemen distanzierten Menschen im Sturz vor dem völlig abstrakten Streifen200 Abb. 5: Eric Fischl, Tumbling Woman, 2002, Bronzeplastik © Eric Fischl lineament der Gebäudefassade zeigt und durch die Fernsicht auf den Stürzenden sowie durch Retouchen am Bild den Schrecken des Geschehens an das Erleben des Betrachters zurück verweist. Fischl bewahrt hingegen eine nahsichtige Gegenständlichkeit und geht mit seiner Stürzenden sogar noch einen Schritt weiter. Denn er stellt nicht den Sturz, sondern den Aufprall dar. Er legt es darauf an, mit einem Bild zu provozieren, für das es keine Darstellungskonventionen gibt und verstrickt sich doch zugleich in einer konventionellen Formensprache. Die Aktdarstellung entrückt das Opfer in eine unangemessene Zeitlosigkeit. Die geknickte Körperhaltung erinnert an die aus aktuellem Anlass invertierte Statuarik einer Sitzfigur in der Art von Michelangelos Ignudi an den Deckenfresken der Sixtinischen Kapelle. Schließlich spielt die Figur in ihrer gegenständlichen Prägung auf eine Ikonografie des Jüngsten Gerichts an, die den Sturz der Verdammten als gerechte, durch den Teufel vollzogene Strafe der Sünder vorführt. Die Opfer der Anschläge – so lässt sich das aus der Formensprache des Werks dargelegte Bildargument verstehen – erleiden den Sturz aus eigener Schuld. Damit hat sich der Künstler in kaum mehr aufzulösende Widersprüche hineinbegeben, die in der öffentlichen Kritik teils aufgenommen, teils auch polemisch zugespitzt wurden. Das Werk, das als ein 201 erstes Denkmal geplant war, wurde von der Öffentlichkeit delegitimiert und als Monument der Erniedrigung der Opfer aus der Öffentlichkeit verbannt. Fischls Figur und die sich daran entzündende Empörung hatten in den Monaten nach den Attentaten symptomatischen Charakter. An der Statue lässt sich beispielhaft ablesen, dass die künstlerische Verarbeitung der Ereignisse zumindest mit den traditionellen Mitteln der Kunst nicht gelungen ist. Durch die Tumbling Woman wurde eine amerikanische Öffentlichkeit alarmiert, die noch auf der Suche nach geeigneten Formen des öffentlichen Gedenkens an die Anschläge war und bis heute ist. Darüber hinaus fügt sich die Statue Fischls auch in eine breite Front der Ablehnung bündig ein, die sich gegenüber den ersten Plänen für den Wiederaufbau der Trade Towers formierte. Die ersten Entwürfe für die Neubauung des Grundstücks, auf dem das World Trade Center gestanden hatte, wurden im Juli 2002 vorgestellt. Es handelte sich um einen Masterplan des New Yorker Büros Beyer-BlinderBelle, das den Auftrag von der nach der Zerstörung der Bürotürme gegründeten Lower Manhattan Development Corporation (LMDC) erhalten hatte, worüber die Öffentlichkeit nicht informiert worden war. Nun wurde der Ruf nach der Ausschreibung eines internationalen Wettbewerbs umso lauter. Von einer Bürgerinitiative, die unter dem Veranstaltungstitel Listening to the City einen ganztägigen Kongress organisierte, wurde nicht nur den Plänen des Investors eine Absage erteilt, sondern auch die Kernpunkte eines differenzierten Bauprogramms formuliert. Gefordert wurde eine Wettbewerbsausschreibung sowohl für die Gebäude als auch für eine Gedenkstätte. Verlangt wurde sowohl eine wahrzeichenhafte Gestalt der neuen Hochhausbauten als auch die Mischnutzung der Gebäude, die neben Büros auch Wohnungen und Bildungsinstitutionen beherbergen sollten. Die plebiszitäre Euphorie dieser Initiative konnte bereits damals nicht übersehen lassen, dass neben den technischen Problemen die juristischen Grundlagen für die Kooperation und die geteilte Planungsverantwortung zwischen der New Yorker Port Authority als dem Grundstücksbesitzer und dem Immobilientycoon Larry Silverstein als dem Pächter des World Trade Centers nicht geklärt waren. Als im Januar 2002 in der New Yorker Galerie von Max Protetch eine Ausstellung mit Architekturprojekten zum Wiederaufbau des Areals eröff202 net wurde, handelte es sich dabei um einen weiteren Schritt plebiszitärer Eigen­initiative und Selbstbeteiligung seitens einer kritischen Öffentlichkeit. Bereits der Titel der Ausstellung, Unofficial Design Proposals, signalisierte die Distanz zu den Kommunalbehörden sowie zu den Investoren. Die mehr als fünfzig Architekturbüros, die sich weltweit beteiligten, verstanden ihre Entwürfe zunächst als Diskussionsvorschläge für die Wiederbebauung und sie nutzten die Präsentation darüber hinaus auch als Möglichkeit, sich als Kandidaten für einen Auftrag ins Spiel zu bringen. Mehrere funktionale und formale Aspekte werden bei der Durchsicht der Projekte als zentrale Anliegen der Architekten deutlich: Die Option einer variierten Rekonstruktion des alten World Trade Center wurde nach wie vor aufrecht erhalten, jedoch mit einem Konzept erweiterter privater und öffentlicher Nutzungen verbunden. Entsprechend der Erwartung, die Neubauten müssten wie die zerstörten Vorgängerbauten eine städtebaulich dominierende Baugruppe darstellen, halten die Architekten an der Gebäudetypologie des Hochhauses fest, doch den Entwürfen steht – wenn man so will – der Schrecken ins Gesicht geschrieben. In zahlreichen Projekten sind auf der einen Seite die Tragwerksstrukturen so ausgelegt, dass sie einem erhöhten Horizontaldruck wie bei einem Flugzeugaufprall standhalten, auf der anderen Seite sollen gebündelte Turmsysteme oder Gitterstrukturen Verbindungen zwischen den Türmen und Fluchtwege nach unten gewährleisten. Diese Ideen bildeten die Grundlage für den weltweit offenen Wettbewerb, der im August 2002 von der Lower Manhattan Development Corporation und der New Yorker Port Authority ausgelobt wurde. In mehreren Verfahrensschritten wurden am Ende sieben Architekturbüros mit der weiteren Ausarbeitung ihrer Projekte beauftragt. Zu ihnen gehörte das Berliner Studio Daniel Libeskind, das im Februar 2003 den Zuschlag erhielt. Nach wenigen Monaten wurde Libeskind dem Hausarchitekt von Larry Silverstein, David Childs vom Büro Skidmore Owings & Merrill, zur Seite gestellt. Dem Hochhausbauer Childs wurden schließlich die Kompetenzen als alleiniger Entwurfsarchitekt und Projektleiter übertragen, während Libeskind nur noch in beratender Funktion fungiert. Der Neubau der Hochhäuser und der Gedenkstätte wird seit 2004 verwirklicht. Das Ausgangsprojekt von Daniel Libeskind sah einen Kranz von 203 sechs Hochhäusern vor, die sich in der Art einer Treppe zu einer spitzen Nadel in die Höhe schrauben (Abb. 6). Die Gebäudegruppe flankiert die leeren Betonwannen der ehemaligen Twin Towers. Deren schrundige Betonwände sollten so belassen werden, wie sie nach dem Abtragen des Schutts und der Ruinen hervortraten. Man kann die Hohlform als Ruinenrest der Türme Abb. 6: Daniel Libeskind, Entwurf für das WTC, 2002, Rendering 204 selbst oder als eine Negativform von deren ehemaliger Existenz auffassen. Damit bilden sie auch einen Reflex auf die ersten Ideen, die Türme als Ruinen zu bewahren und sie als Lichtarchitektur zu fingieren. Die Denkmalkonzeption greift mit dieser leeren Hohlform maßgeblich auf den Prozesscharakter des Ereignisses vom 11. September zurück. Denn das Denkmal verdankt sich – so sollen wir glauben – nicht einer kreativen Kunstanstrengung, sondern die Katastrophe selbst hat den Gedenkort hervorgebracht. Der Ort der Destruktion und der Relikte der Verschwundenen sollten sichtbar bleiben. Das Kies und die Schuttreste, die am Boden des Betonkraters belassen werden sollten, wären mit der Asche von Toten vermischt gewesen. Hier gab es vehementen Widerspruch von Seiten der Opferorganisationen, der das Vorhaben zu Fall brachte. Während sich dieser Teil der Denkmalkonzeption gerade in seinem Formreduktionismus als durchaus diskutabel dargestellt hätte, entgehen die weiteren Elemente nicht einer banalen Rhetorik des patriotischen Symbolismus. Mit ihm wird dem Totengedenken eine Metaphorik des Optimismus entgegengehalten. Das pfeilförmige Hochhaus wird 1776 Fuß (540 Meter) hoch sein, wobei die Ziffer der Höhenbemessung an das Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung erinnern soll. Es stand freilich beim Entwurf Libeskinds noch im Wortsinne in den Sternen, was ein bedeutsames historisches Datum mit einer Gebäudehöhe zu tun haben soll und wie der Turm, dessen Gipfel die Gardens of the World mit der Nachschöpfung der Weltklimazonen hätte aufnehmen sollen, technisch zu realisieren gewesen wäre. Die geplante Pfeilform versteht der Architekt als eine direkte Reminiszenz an die Silhouette der Freiheitsstatue. Der Tower of Freedom ist so in eigentümlicher semantischer Redundanz ein Denkmal des Denkmals der Statue of Liberty. Auch zwei Plätze sind Bestandteil dieser urbanistisch bemessenen Bedeutungsmaschinerie. Euphemistisch als Keil des Lichts und als Park der Helden benannt, sollten die Platzanlagen an jedem 11. September jeweils an dem Moment, als das erste Flugzeug einschlug und als der zweite Turm niedersank, ohne Schatten sein. Libeskind wurde unverzüglich nachgerechnet, dass sich diese Konstellation wegen der vorhandenen Randbebauung gar nicht ergibt. 205 Der Grundstein für das von David Childs überarbeitete Projekt für den Tower of Freedom wurde nach erheblichem Druck seitens der Stadt New York und der Öffentlichkeit endlich im Jahr 2007 gelegt. Errichtet wird nun ein sich nach oben verjüngender und verdrehender Büroturm auf rombenförmigem Grundriss. Über dem 60. Stockwerk schließt eine Aussichtsplattform in 335 Metern Höhe den bewohnten Teil des Turmes ab. Darüber setzt sich das Gebäude mit einem fast 200 Meter hohen halboffenen Aufbau fort, in den Windturbinen zur Stromversorgung des Hochhauses installiert werden sollen. Ein darüber aufgepflanzter Sendemast ragt als spitze Nadel bis in die symbolische Höhe der 1776 Fuß hinauf. In der Childs-Version ist die große, zum Himmel strebende triumphale architektonische Geste des Wolkenkratzers mit nationalen Konnotationen also noch geblieben. Aber ebenso unverkennbar ist im ikonologischen Gehalt des Projekts der Aspekt der Erinnerung an das Attentat und an die Toten in den Hintergrund getreten gegenüber schieren Renditeerwägungen sowie gegenüber dem Anspruch, dem Großbau zu ökologischer Akzeptanz zu verhelfen. Der Ökologie- hat den Erinnerungsdiskurs abgelöst. Von Libeskinds ursprünglicher Kristallspirale aus Hochhäusern, die sich in stilistischem Einklang zum Tower of Freedom hinauf winden sollten, ist fast nichts mehr übrig geblieben, nachdem 2006 die Entwürfe für die Einzeltürme an verschiedene Architekten (Büros Norman Foster, Richard Rogers und Fumihiko Maki) vergeben wurden. Abb. 7: Peter Arad und Michael Walker, Reflecting Absence, Entwurf für die WTC Memorial Plaza in New York, 2004, Rendering 206 Für den Gedächtnispark liegt seit Januar 2004 ein Entwurf von Michael Arad und Peter Walker vor (Abb. 7). Der Gedenkort wird ergänzt um einen Museumsbau, der vom Osloer Architekturbüro Snohetta gestaltet wird. Der Memorial Plaza liegen die zwei quadratischen Becken der footprints der Twin Towers zugrunde. Wasser fließt an den Beckenrändern herab und sammelt sich in einer mittleren Vertiefung. Die Wandungen sind von unterirdischen Wandelgängen umgeben, die zum Wasser hin offen sind und mit Schrift­tafeln mit den Namen der Opfer ausgestattet werden. Die beträchtlichen Freiflächen zwischen den footprints werden Pinienwäldchen zieren. Das Ganze ist zunächst einmal eine radikale Abkehr von der Rhetorik des Libeskind-Entwurfs. Mit den Schrifttafeln der Opfer sind aber die Anklänge an Soldatendenkmäler offenkundig, allen voran natürlich das Vietnam-Denkmal in Washington. Das meditative Flair der Anlage und die schlichte Tatsache, dass ein Gedenkort mit einem Brunnen verbunden wird, zeigt Parallelen zur gegenwärtigen Gedenkpraxis, die heute an der Umgebung der Baustelle zu beobachten ist. Mehrere von den Explosionen entwurzelte Bäume wurden denkmalhaft gefasst und dienen als Gedenkorte. Auf eine naive, den Außenstehenden befremdende Weise kommt die Metapher der Entwurzelung zum Zuge, und das abgestorbene Naturrelikt soll die abwesenden Toten stellvertretend vergegenwärtigen. Es wäre zu überlegen, ob sich nicht auch noch eine solche memoriale Naturmetaphorik den Konventionen der Erinnerung an Kriegszerstörungen verdankt, die zum Beispiel durch zahllose Ruinenfotos, in denen tote Bäume als Menetekel der Verwüstung in Szene gesetzt sind, tradiert werden. Die Feuerwehrleute sind mittlerweile aus den Opferverbänden ausgeschert und haben sich mit einem eigenen Denkmal selbständig gemacht. Es handelt sich um eine bronzene Umsetzung des Fotos der Feuerwehrleute in den Ruinen des World Trade Centers, allerdings in monströs aufgeblähtem Kolossalformat und kläglicher plastischer Umsetzung.20 Jenseits der schieren Einfallslosigkeit mag man in diesem Vorhaben, bei dem die Entsprechung zum Nachbau des «Iwo Jima»-Fotos mit dem Soldatendenkmal in Arlington gesucht wurde, noch einmal das hartnäckige Beharren auf der Analogie zum 20 Stan Watts und Kim Company: To Lift a Nation, 9/11 Living Memorial, Emmitsburg (Maryland), National Emergency Training Center. Statuengruppe aus Bronze, 2008. 207 Zweiten Weltkrieg als Deutungsrahmen für das Ereignis des 11. Septembers erkennen. Die hier beschriebene mediale Konfigurierung des Ereignisses ist als Teil einer umfassenden Geschichtspolitik zu verstehen. Sie wurde für mehrere Jahre zu deren zentralem Argument. Die Medienvermittlung wurde von der amerikanischen Öffentlichkeit wie von den Regierungsinstanzen gleichermaßen getragen, wobei die Verteilung der Rollen in unterschiedlichen Phasen kaum zu bestimmen ist. Denn das strategische Operieren mit Geschichtsdeutungen zur Legitimierung politischer Projekte findet als staatliches Regierungshandeln gerade bei der Bereitstellung von Bildproduktionen im Rahmen einer politischen Kommunikation und sozialen Mobilisierung statt, die die gesamte Gesellschaft durchdringt. Geschichtspolitik zielt in recht breitem Interesse auf die Stabilisierung von Gesellschaften in krisenhaften Übergängen nach Ereignissen, die unvermittelt hereinbrechen, aber langfristige strukturelle Folgen haben. Auffällig bleibt bei alledem die Tatsache, dass die so verstandene Geschichtspolitik mit vergleichsweise eindimensionalen, aber höchst effizient platzierten Bildformeln operierte. Ansonsten ist das Urteil über die gegenwärtigen Bebauungspläne zwiespältig. Nach einigen Jahren lässt sich ein deutlicher Wandel in der Erinnerungskultur des 11. Septembers beobachten. Wenn nun die geschichtsträchtig-numinosen Künstlereingebungen, mit denen Libeskind in jeder Hinsicht hoch hinaus wollte, dem Pragmatismus der Investment-Architektur von David Childs und der Kundenfreundlichkeit des Memorial Site Platz gemacht haben, so kann man darin zweifelsohne ein Indiz sehen, dass die jahrelange, offizielle Nötigung zur Betroffenheit allmählich nachlässt. Das wäre die positive Einschätzung. Die despektierliche Lesart liefe darauf hinaus, dass das aktuelle Kriegsgeschehen in Afghanistan und im Irak ganz in den Vordergrund gerückt ist. Die Militarisierung der Gesellschaft in den USA, die wir nun seit Jahren in allen zivilen Lebensbereichen beobachten, und der von den USA seit 2002 geführte global war on terror, der von der Bush-Administration ganz unverblümt mit imperialen und ökonomischen Motiven geführt wird und der als Militärstrategie erst im Jahr 2009 von Barack Obama für offiziell beendet erklärt wurde, bedürfen heute nicht mehr der visuellen Begründungen, die sich auf das Ereignis des 11. Septembers 2001 beziehen. 208 Literatur Aigner, Carl u.a. (Hg.). Tomorrow for Ever. Architektur / Zeit / Fotografie, Köln 1999. Andrieux, Jean-Yves / Frédéric Seitz. Le World Trade Center. Une cible monumentale, Paris 2002. Baldessari, John. While something is happening here, something is happening there. Works 1988-1999, Köln 1999. Baldessari, John u.a. (Hg.). John Baldessari. Pure Beauty, München 2009. Baudrillard, Jean. «Der Geist des Terrors. Herausforderungen des Systems durch die symbolische Gabe des Todes». In: Ders. Der Geist des Terrors, Wien 2002. Beuthner, Michael u.a. (Hg.). Bilder des Terrors – Terror der Bilder? Krisenberichterstattung am und nach dem 11. September, Köln 2003. Blänker, Reinhard / Bernhard Jussen (Hg.). Institutionen und Ereignis. Über historische Praktiken und Vorstellungen des gesellschaftlichen Ordnens, Göttingen 1998. Die erste Seite. Internationale Schlagzeilen nach dem 11. September 2001, Köln 2001. Erben, Dietrich. «Geschichtsüberlieferung durch Augenschein. Zur Typologie des Ereignisdenkmals». In: Achim Landwehr (Hg). Geschichte(n) der Wirklichkeit. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte des Wissens, Augsburg 2002, S. 219–248. Enzensberger, Hans Magnus. Aussichten auf den Bürgerkrieg, Frankfurt a.M. 1993. Enzensberger, Hans Magnus. Schreckens Männer. Versuch über den radikalen Verlierer, Frankfurt a.M. 2006. Franke, Ursula / Josef Früchtl (Hg.). Kunst und Demokratie. Positionen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Hamburg 2003. Fricke, Christel. «Kunst und Öffentlichkeit. Möglichkeiten und Grenzen einer ästhetischen Reflexion über die Terrorattacken auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001». In: Franke / Früchtl (2003), S. 1–18. 209 Gillespie, Angus Kress. Twin towers. The life of New York Citys World Trade Center, New Brunswick u.a. 2001. Hofmann, Wilhelm (Hg.). Bildpolitik – Sprachpolitik, Berlin 2006. Hölscher, Lucian. Neue Annalistik. Umrisse einer Theorie der Geschichte, Göttingen 2003. Hüppauf, Bernd. «Ground Zero und Afghanistan. Vom Ende des fotografischen Bildes im Krieg der Unschärfen». In: Fotogeschichte 22 (2002), S. 7–22. Jackson, Richard. Writing the War on Terrorism. Language, politics and counter-terrorism, Manchester / New York 2005. Jencks, Charles. The Language of Postmodern Architecture, London 1977. Klotz, Heinrich. Weitergegeben. Erinnerungen, Köln 1999. Koselleck, Reinhart / Wolf-Dieter Stempel (Hg.). Geschichte. Ereignis und Erzählung, München 1973. Koselleck, Reinhart. «Ereignis und Struktur». In: Ders. / Stempel (1973), S. 560–571. Kröner, Magdalena (Hg.). «New York nach 9/11». In: Kunstforum International 189 (2008). Leggewie, Claus. «11. September 2001 – wessen Niederlage? Die Entstehung eines globalen Erinnerungsortes». In: Horst Carl u.a. (Hg.). Kriegsniederlagen. Erfahrungen und Erinnerungen, Berlin 2004, S. 447–463. Mackiewicz, Wolf. Winning the War of Words. Selling the war on terror from Afghanistan to Iraq, Westport (CT) 2008. Marling, Karal Ann / John Wetenhall. Iwo Jima. Monuments, Memories and the American Hero, Cambridge (MA) u.a. 1991. Morrison, Toni u.a. Dienstag, 11. September 2001, Reinbek 2001. Mügge, Meike. Die «Helden» des 11. Septembers. Kritische Rekonstruktion eines Bildtyps, Magisterarbeit Ruhr-Universität Bochum 2005. Münkler, Herfried. Die neuen Kriege, Reinbek 2002. Pedahzur, Ami. Suicide Terrorism, Cambridge (MA) 2005. Rapoport, David C. Inside Terrorist Organizations, London 1988. Sageman, Marc. Leaderless Jihad. Terror networks in the 21st century, Philadelphia 2008. 210 Schicha, Christian / Carsten Brosda (Hg.). Medien und Terrorismus. Reaktio­n­en auf den 11. September, Münster 2002. Schmidt, Hans-Werner. Edward Kienholz. The Portable War Memorial. Moralischer Appell und politische Kritik, Frankfurt a.M. 1988. Schneckener, Ulrich. Transnationaler Terrorismus, Frankfurt a.M. 2006. Schulze, Rainer-Olaf. «Politik / Politikbegriffe». In: Dieter Nohlen (Hg.). Lexikon der Politikwissenschaft, Bd. 1, München 2010, S. 280–284. Schwerfel, Heinz Peter (Hg.). Kunst nach Ground Zero, Köln 2002. Scorzin, Pamela C. «Die US-Flaggenhissung als Engramm und Bildzeichen». In: Franke / Früchtl (2003), S. 19–44. Sellin, Volker. «Politik». In: Otto Brunner u.a. (Hg.). Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 4, Stuttgart 1997, S. 789–874. Sofsky, Wolfgang. Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg, Frankfurt a.M. 2002. Steger, Manfred B. The Rise of Global Imaginary. Political ideologies from the French Revolution to the war on terror, Oxford 2008. Steuter, Erin / Deborah Wills. At War With Metaphor. Media, propaganda, and racism in the war on terror, Lanham 2008. Suter, Andreas. «Theorien und Methoden für eine Sozialgeschichte historischer Ereignisse». In: Zeitschrift für historische Forschung 25 (1998), S. 209–243. Suter, Andreas / Manfred Hettling (Hg.). Struktur und Ereignis, Göttingen 2001. Verhein, Annette. Das politische Ereignis als historische Geschichte. Auslandskorrespondentenberichte des Fernsehens in historiographischer Perspektive, Frankfurt a.M. 1990. Waldmann, Peter. Terrorismus. Provokation der Macht, München 1998. Waldmann, Peter. Terrorismus und Bürgerkrieg. Die Staatsmacht in Bedrängnis, München 2003. Werckmeister, Otto Karl. Der Medusa-Effekt. Politische Bildstrategien seit dem 11. September 2001, Berlin 2005. Wolfe, Tom. From Bauhaus to Our House, New York 1981. Wright, Lawrence. Der Tod wird euch finden. Al-Qaida und der Weg zum 11. September, München 2007. 211 Narration und (De-)Legitimation: Der zweite Irak-Krieg im Kino Martin Seel Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob und inwiefern fiktionale Kinofilme unter heutigen Bedingungen die Rolle von Rechtfertigungsnarrativen übernehmen können. Beginnen werde ich mit einigen sehr knappen Bemerkungen über den generellen Zusammenhang von Erzählung und Rechtfertigung außerhalb und innerhalb der Künste. Danach werde ich einige Fragmente der filmischen Thematisierung des zweiten Irak-Kriegs (oder, in einer anderen Terminologie, des dritten Golfkriegs) kommentieren. Schließen werde ich mit vier Thesen über die Verbindung von Narration und Legitimation in den einschlägigen Filmen. I. Erzählung und Rechtfertigung Seit Platons Zeiten, man denke nur an die Opposition (oder scheinbare Opposition) zwischen Rhetorik und Dialektik oder an diejenige von Mythos und Logos, ist ein innerer Zusammenhang von Erzählung und Rechtfertigung immer wieder bestritten worden. Rechtfertigung, nach dieser Vorstellung (bei der man sich allerdings hüten sollte, sie geradewegs Platon zuzuschreiben), ist eine Sache der Gründe und also des Argumentierens oder Erklärens. Erzählung, nach dieser Vorstellung, ist eine Sache der Schilderung dessen, wie etwas geschehen ist oder geschehen könnte, und also eines Ausmalens von Begebenheiten, das als solches nicht – oder doch nicht hinreichend rational – erklären oder rechtfertigen kann, warum etwas so geschah, wie es geschah. Erzählungen hätten demnach bestenfalls einen explikativen oder explorativen, nicht aber einen explanativen Status. Sie gehörten allenfalls einem context of discovery, nicht aber einem context of justification an. 213 Freilich gehört es zu den Prämissen des Forschungsverbunds, innerhalb dessen meine Überlegungen entstanden sind, dass diese Vorstellung falsch ist. Sie führt schon deshalb in die Irre, weil Erzählungen im Alltag wie in Wissenschaft und Politik Beziehungen zwischen Ereignissen herstellen können, die durchaus zu erklären und/oder zu rechtfertigen vermögen, wie und warum es zu Veränderungen einer bestimmten Art kam: zu der Peinlichkeit eines verspäteten Erscheinens bei einer Konferenz oder zu der naturgeschichtlichen Entwicklung einer neuen Spezies. Insbesondere dann, wenn Unerwartetes und Unerwartbares bis hin zum schieren Zufall seine Hand im Spiel hat, zumal in der Form, in der Individuen oder Kollektiven etwas zum Ereignis wird, das die Koordinaten ihres bisherigen Begreifens und Handelns sprengt (oder doch zu sprengen scheint) – insbesondere dann können Erzählungen verständlich machen, oder es versuchen, wie eine Anzahl von Vorkommnissen kausal und/oder motivational miteinander verbunden war. Sie bieten – unter bestimmten Aspekten und bis zu einem gewissen Grad – Erklärungen dafür an, wie das, was aufeinander folgte, auseinander erfolgen konnte. Dabei gibt das Erzählen einen durchaus anderen Aufschluss als ein nomologisches Erklären, das das kontingent Erscheinende auf gesetzmäßige Verläufe zurückzuführen sucht. Denn, wie Michael Hampe in seiner Kleinen Geschichte des Naturgesetzbegriffs schreibt, «auch die Erzählung bewältigt Kontingenz, indem sie Einmaliges und Einzelnes in einen Zusammenhang einbettet, doch wird dies dadurch nicht zu einer Instanz von etwas Allgemeinem, sondern mit anderem Einzelnen verknüpft. Durch diese Verknüpfung wird die Veränderung, die das Auftauchen oder Verschwinden des Einzelnen darstellt, nicht irreal oder zum Epiphänomen, sondern zu einem Geschehnis in einem nachvollziehbaren Prozess, dessen Ausdehnung von der ‹Reichweite› der Erzählung abhängt».1 Eine Erzählung, mit einem Wort, kann Veränderungen auf eine spezifische Weise einsichtig machen – und somit auf ihre Weise Gründe dafür angeben, warum etwas so geschah, wie es geschah. «Insofern», sagt Hampe deshalb, «ist die Erzählung auch eine Art der Erklärung, aber eben keine, die das Neue auf das Alte oder das Verschiedene auf das Immergleiche zurückführt, sondern eine, die durch genaue Beschreibung die Aufmerksamkeit so 1 214 Hampe (2007), 26. lenkt, dass Sinnzusammenhänge, Übergänge, Plausibilitäten entstehen, die nicht die Übergänge deduktiver Schlüsse sein müssen».2 Eine wissenschaftstheoretische Rehabilitierung der Erzählung auf diesen Spuren reicht allerdings noch nicht aus, um die besondere Verbindung von Erzählung und Rechtfertigung zu verstehen. Hierzu ist es nötig, zunächst die Differenz zwischen Rechtfertigung und Erklärung ins Auge zu fassen. Denn ungeachtet der unscharfen Ränder zwischen den beiden Begriffen sowie der fließenden Übergänge zwischen den zugehörigen Praktiken, hat die Sache der Rechtfertigung einen charakteristischen Akzent. Eine Rechtfertigung kann nur aus einer tatsächlich oder advokatorisch eingenommenen Teilnehmerperspektive gegeben werden. Ob ein Wissenschaftler seine Hypothesen, ein Politiker seine Strategien, ein Unternehmer seine Planungen oder ein alltäglich Handelnder sein Vorgehen verteidigt, gleichviel: sie alle rechtfertigen aus jeweils ihrer Perspektive, was sie erkannt oder getan zu haben glauben. Entsprechend verfährt eine Kritik an den Rechtfertigungen anderer. Die Kritiker bringen aus jeweils ihrer Sicht Gründe gegen die Annahmen und das Selbstverständnis der anderen ins Spiel, oft auch, um nachzuweisen, dass die Gegenseite eine irreführende Haltung zu der jeweiligen Sache hat. Im Unterschied zu einer beobachtenden Erklärung von Vorgängen, in die man selbst gar nicht involviert ist, schließt eine Rechtfertigung stets eine Festlegung auf Standards mit ein, auf die man sich in ihrer Durchführung stützt. Wer etwas rechtfertigt oder eine gegebene Rechtfertigung kritisiert, mit anderen Worten, rechtfertigt immer auch sich – und damit die eigene Sicht auf das, worum es geht. So sehr insbesondere eine Rechtfertigung des eigenen Handelns oder desjenigen anderer meist eine Erklärung darüber mit einschließt, warum und inwieweit ihr Vollzug angemessen oder unangemessen, absichtlich oder unabsichtlich, planvoll oder zufällig war, ihre Pointe liegt stets auch in einer direkten oder indirekten Affirmation der Perspektive, aus der heraus sie erfolgt. Hier kommt die narrative Rechtfertigung ins Spiel. Denn sie kann dort, wo es um die Legitimation oder Delegitimation individuellen oder kollektiven Handelns geht, stärker als alle anderen Formen der Rechtfertigung, 2 Ebd., 26f. 215 zusammen mit einer Schilderung und Bewertung des jeweiligen Tuns und Widerfahrens, die normativen Einstellungen kommunizieren, aus denen heraus es sich ereignete. Während Erzählungen im allgemeinen faktische oder auch fiktive Verläufe auf unterschiedlich komplexe Weise in einen kausal wie motivational, sei es durchsichtig, sei es undurchsichtig gegliederten Zusammenhang bringen, leisten Rechtfertigungsnarrative mehr.3 Sie geben nicht nur dem Erzählten, sondern auch der Erzählung eine besondere Zuspitzung. Sie machen verständlich oder stellen infrage, wie recht oder gerecht in gegebenen Situationen gehandelt wurde, und auch, wie viel Recht oder Unrecht den aktiv wie passiv Beteiligten dabei widerfahren ist. Durch die Art, durch das Wie der Erzählung lassen sie dabei – mit der Wahl ihrer Worte, in der Komposition von Anfang und Ende, im Verweilen bei bestimmten Ereignissen und im Übergehen anderer, in der Verzögerung und Beschleunigung des Handlungsverlaufs und durch viele andere stilistische Mittel – ein spezifisches, auf die eine oder andere Weise wertend gefärbtes Licht auf das Was des dargebotenen Geschehens fallen. In diesem Modus artikulieren und modifizieren sie – und transformieren gelegentlich – die Perspektive, aus der diejenigen normativen Gründe für das individuelle und kollektive Handeln Kraft gewinnen sollen, die aus der Sicht der jeweiligen Erzähler oder Erzähl-Instanzen vor allem zählen. Dies leisten Rechtfertigungsnarrative bereits im Alltag – umso mehr aber in der Gestalt theologischer, historischer und politischer Großerzählungen bis hin zu denen des Mythos und der Kunst. 4 3 4 216 Rechtfertigungsnarrative, so nehme ich an, stellen eine Unterklasse des Erzählens dar, die von Erzählungen ohne (eindeutige) Rechtfertigungsdimension – wie etwa der Anekdote, dem Witz oder in Kontexten des Small Talks erzählten Geschichten – unterschieden werden müssen. Das komplexe Verhältnis von Sichtweisen und Gründen kann ich hier nicht eigens behandeln. Nur soviel: Gründe gewinnen ihre spezifische argumentative Kraft nur in jeweiligen Kontexten ihres Gebrauchs, und damit zugleich im Kontext der kognitiven und normativen Einstellungen, in dem sie vorgebracht werden. Sie sind in ihrer Gültigkeit aber nicht von bestimmten solcher Sichtweisen (und erst recht nicht von bestimmten Formen ihrer narrativen, metaphorischen oder auf andere Weise ästhetischen bzw. künstlerischen Präsentation) abhängig. Wenn dies zutrifft, leisten Rechtfertigungsnarrarive stets eine Arbeit an Kontexten des Verstehens, aus denen heraus bestimmte normative Gründe eine besondere Kraft gewinnen können. Diese Einbettung praktischer Rationalität in ein oft latent bleibendes Geflecht von Verweisungen ist vielleicht ihre entscheidende Leistung. Oder eben, in jüngerer Zeit, in der Gestalt des Films. Auf Grund seiner audio­visuellen Bewegtheit ist der Film in besonderer Weise zu erzählenden Darbietungen disponiert – nicht nur in seinen fiktiven, sondern auch in seinen dokumentarischen Genres (wobei die Grenzen zwischen diesen nicht selten fließend sind). Mehr noch als andere Erzählformen kann der Film die Situationen, durch die er führt, von innen heraus entfalten, und dies nicht zuletzt deshalb, weil sich alles, was in seinem Verlauf sichtbar und hörbar wird, in einem Horizont von Räumen und Zeiten vollzieht, die dem Geschehen auf Leinwand oder Bildschirm entzogen bleiben. Auf diese Weise vermag er die Wahrnehmung seiner Betrachter in eine virtuelle Welt zu führen – in eine Welt freilich, die mit der realen in sehr unterschiedlichen Graden verschwis­tert und in ebenso unterschiedlichen Maßen auf sie bezogen sein kann.5 Diese Disposition befähigt das filmische Medium auch, Situationen in besonderer Intensität aus der Perspektive der an ihnen Beteiligten zu präsentieren – oder aber, und meist zugleich, auf Situationen geschilderten Handelns und Widerfahrens eine Sicht zu eröffnen, und damit dem Publikum nahe zu bringen, die von derjenigen der handelnden Figuren oder Charaktere mehr oder weniger stark differiert. Dies ist einer der Gründe dafür, warum zumal in bedeutenden Spielfilmen das in ihnen dramatisierte Geschehen zwar einerseits verständlich gemacht, andererseits aber auch wieder verrätselt wird, wie es in den großen künstlerischen Erzählungen eigentlich immer geschieht. Eine Eigenart des filmischen Erzählens – wiederum: vor allem im Großgenre des Spielfilms – liegt überdies in seinem besonderen Zeitmodus. In den meisten Modi des Erzählens ist das, was erzählt wird, zum Zeitpunkt der Erzählung unwiderruflich vorbei. In der Ästhetik von Spielfilmen aber verhält es sich oftmals anders – selbst dann, wenn die Handlung in vergangenen Zeiten angesiedelt ist. Denn die Kunst des filmischen Erzählens kulminiert häufig darin, das Erzählte so zu gestalten, als ob es gerade gegenwärtig sei. Dadurch nämlich, dass die Zuschauer – zumal im Dunkel des Kinos – dem Geschehen auf der Leinwand unvermeidlich unterliegen, bleibt alles, was sich dort abspielt, von dem Hier und Jetzt des audiovisuellen Erscheinens abhängig, das einen starken Eindruck der Präsenz des Erscheinenden 5 Vgl. Seel (2008). 217 erzeugt – einschließlich der Unsichtbarkeiten und des Unhörbaren, von denen es fortwährend umhüllt ist. Darin liegt eine besondere Kraft nicht allein des Erzählens, sondern auch der Artikulation jeweiliger Perspektiven durch das Erzählen – und damit der potentiellen Rechtfertigung dieser Perspektiven sowie der normativen Einschätzungen, die sie enthalten. Unter den eher populären Künsten ist es daher das Kino, das – meist in Formen einer exemplarischen Darbietung – eine vergleichsweise große Macht der Legitimation oder Delegitimation werthafter Einstellungen zu existentiellen, sozialen, politischen oder moralischen Konstellationen und Konflikten in Geschichte, Gegenwart (oder auch in einer möglichen Zukunft) entfaltet.6 II. Der zweite Irak-Krieg im Film Nun aber zu der Präsenz des zweiten Irak-Kriegs in filmischen Erzählungen. Mein erstes Beispiel allerdings stammt nicht – oder zumindest nicht auf den ersten Blick – aus dem Kino. Am 1. Mai 2003, sechs Wochen nach Beginn der unter Führung der USA erfolgten Invasion der sogenannten «Koalition der Willigen» gegen das Regime des Saddam Hussein, trat der damalige Präsident George W. Bush auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln vor die Fernsehkameras und erklärte den Krieg für beendet. Mission accomplished, prangte auf einem großen Banner an der Kommandobrücke des Schiffes – eine Botschaft, die freilich in der Zeit danach zu einem ironischen Schlagwort für das Scheitern des alliierten «Kampfes gegen den Terror» wurde. 6 218 Hier wäre zusätzlich zu erörtern, inwiefern die Kontexte der Verwendung von Erzählformen und Erzählungen für ihren legitimatorischen Status entscheidend sind – nicht allein, aber auch im Kino, wofür ich sogleich ein Beispiel geben werde. Ferner müssten die potentiellen Verhältnisse ihrer wechselseitigen Verdrängung und Überlagerung, ihrer Koexistenz, Konkurrenz und Konsistenz, sowie ihrer Aktualisierung und Re-Aktualisierung untersucht werden, die für ihren rechtfertigenden Wert und ihre diesbezügliche Kraft oftmals ausschlaggebend sind. Schließlich wäre genauer zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen zu unterscheiden, einschließlich der speziellen Bedeutungen, die diese Unterscheidung in der Produktion von Filmen gewinnt. Dieser feierliche Auftritt des amerikanischen Präsidenten hatte ein spektakuläres Vorspiel, das in allen Nachrichtenbildern von diesem Tag einen ebenso breiten Platz einnahm wie die Erklärung danach. Denn Bush landete mit einem Kampf-Jet auf dem Flugzeugträger und entstieg diesem in der Montur eines Armeepiloten, so als sei er unmittelbar aus dem Einsatzgebiet herbeigeeilt, um die frohe Botschaft zu verkünden. In jovialer Siegerpose mischte er sich in dieser Verkleidung unter die Besatzung des Schiffes und nahm deren Ovationen entgegen.7 Dass es sich hierbei um die Inszenierung eines möglichst weltweiten Medienereignisses handelte, werden auch diejenigen erkannt haben (oder hätten auch diejenigen erkennen können), die nicht so genau darüber im Bilde waren, dass der jüngere Bush sich seinerzeit zeitweilig vor dem Militärdienst gedrückt hat, dass er im Unterschied zu seinem Vater nie dafür ausgebildet wurde, einen solchen Kampfjet zu fliegen, und dass der Flugzeugträger, auf dem diese reichlich voreilige Siegesparty stattfand, nur einige Seemeilen vor der amerikanischen Westküste unterwegs war. Zudem handelt es sich bei diesem Empfang eines Präsidenten durch seine Untergebenen um ein filmisches Zitat – um eines jener Zitate, die gerade dann um so wirksamer sind, je weniger es dem Publikum bewusst ist, dass hierbei auf Darstellungsformen zurückgegriffen wurde, die ihm aus anderen Kontexten wohlvertraut sind. Denn der Auftritt von George W. Bush auf der Abraham Lincoln ist ein kaum verhülltes Remake des Finales aus dem Hollywood-Blockbuster Independence Day von Roland Emmerich aus dem Jahr 1996. In der Rolle des Präsidenten Thomas J. Whitmore führt dort Bill Pullman als Pilot eines Kampfflugzeugs die Fliegerschwadron an, die das Mutterschiff der zerstörungswütigen Aliens ausschalten soll (Freilich gelingt dies in der Filmhandlung letztlich nur durch einen Kamikaze-Einsatz – und also ein Selbstmordattentat – eines anderen Piloten, der aufgrund seines Vietnam-Traumas im Leben gescheitert war und nun doch zum Helden wird). Am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten, gelingt die Befreiung auch des Rests der Welt von den 7 Die hier kommentierte Sequenz findet sich in dem Film Fahrenheit 9/11 (USA 2004, R: Michael Moore), dessen polemischen verbalen und musikalischen Kommentar ich aber unberücksichtigt lasse. – Meine Interpretation dieser Bildfolgen stützt sich auf eine Zusammenarbeit mit Angela Keppler. 219 außerirdischen Mächten des Bösen – und der Präsident kehrt aus dem von der Verdunklung durch die riesigen Ufos der Angreifer befreiten Himmel auf die Erde zurück. In Fliegermontur begibt er sich durch das Gedränge seiner begeisterten Mitstreiter zu seinem Hauptquartier. Wie im Film, so macht dieser komparative Seitenblick deutlich, haben die Regisseure des Bush-Auftritts ihren Präsidenten auf dem Flugzeugträger in Siegerpose auftreten lassen. Darin waren Anspielungen auf viele weitere Heldengeschichten des Kinos enthalten, etwa auf den Film Top Gun von Tony Scott aus dem Jahr 1986, in dem Tom Cruise am Ende als umjubelter Pilot auf einem ähnlichen Flugzeugträger landet, und nicht zuletzt auf den Film Air Force One von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1997, in dem Harrison Ford einen höchst tatkräftigen Präsidenten im Anti-Terror-Kampf gibt. Zwar ist die Ikonografie in diesem Film eine durchaus andere, immerhin aber wurde die Lockheed S-3 Viking, der der reale Präsident am 1. Mai 2003 entstieg, kurzerhand auf den Namen Navy One getauft. Über die politische Funktion dieser Anleihen beim populären Kino dürfte kaum ein Zweifel bestehen. Es ging darum, jene Bilder im kollektiven Unterbewusstsein vor allem des amerikanischen Publikums zu löschen oder doch zurückzudrängen, in denen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ein zunächst rat- und tatloser Präsident in der Rolle eines gedemütigten Opfers erschien. Man denke an die Nachrichtenbilder, in denen ein paralysierter George W. bei einem Besuch einer amerikanischen Grundschule die Nachricht der Attacken auf das World Trade Center empfing, oder an jene, in denen er – in volksnaher Zivilkleidung – auf dessen Trümmern die Rettungsmannschaften (und mit ihnen die Nation) zu trösten und zu ermutigen versuchte. Die Siegerposen anderthalb Jahre später sollten all dies vergessen machen – und, kaum weniger wichtig, Material für die kommende Kampagne zur Wiederwahl im Jahr 2004 bereitstellen, das dann freilich wegen der misslungenen Befriedung des Irak nicht zu gebrauchen war. Dennoch: Hier wurde, wie schon durch den embedded journalism während der ersten Phase des zweiten Irak-Kriegs, mit Bildpolitik Politik gemacht, mit dem von der Bush-Administration unterschätzten Risiko freilich, dass sich eine solche Bildpolitik über kurz oder lang auch gegen ihre Erfinder wenden kann. 220 Wie es in filmischen Nachrichtenbeiträgen auch ansonsten nicht unüblich ist, operierte diese Bildpolitik durchaus mit Elementen einer erzählenden Darstellung – jedoch in diesem Fall auf eine geradezu ostentative Weise. Die Parallelaktion der beiden Präsidenten in Independence Day einerseits und auf der realpolitischen Bühne des Flugzeugträgers andererseits betten die letztere in eine Tradition des kinematografischen Erzählens ein. Sobald dies erkannt ist, fallen freilich auch die Unterschiede der beiden Inszenierungen auf. Während sich der fiktive Präsident, der gerade die Rettung des überlebenden Teils der gesamten Erdbevölkerung befehligt hat, im Spielfilm in legerer Haltung und Militärkleidung unter seine Getreuen mischt, stolziert George Bush der Jüngere wie eine Werbefigur für Armeeausstattung durch die Reihen eines bestellten Jubelvolkes – denn um einen politischen Werbefilm handelt es sich hier durchaus. Zugleich aber reichen die Parallelen weiter. Denn sowohl die Spielfilm-Sequenz als auch diejenige aus den Fernsehnachrichten handeln – oder, wie in dem propagandistischen Auftritt von Bush, sollen han­deln – von Zuständen nach der Gewalt. Um der positiven Botschaft eines Happy Endings willen wurden deren verheerende Wirkungen sowohl im Spielfilm als auch in den durch eine aufwendige präsidiale Inszenierung lancierten Nachrichtenberichten ausgeblendet. Wie im Spielfilm: So wollte sich der Präsident der Vereinigten Staaten im Mai 2003 im Augenblick seines – wie sich bald herausstellte: vermeintlichen – Sieges der Welt präsentieren. Darin lag zugleich ein massiver Versuch der Rechtfertigung der amerikanischen – und alliierten – Kriegspolitik in den Jahren nach dem 11.09.2001. Dem weltweiten Publikum sollte eine – je nach seiner Perspektive – optimistische oder ernüchternde Sicht auf das Geschehen im Irak vermittelt werden. Ein weiterer Unterschied lässt eine weitere Gemeinsamkeit zwischen dem Kino-Original und seiner propagandistischen Adaption sichtbar werden. Die Formen kriegerischer Gewalt, die es in einem Spielfilm wie Independence Day reichlich zu sehen gibt, haben mit realpolitischen Verwicklungen zunächst einmal gar nichts zu tun. Hier wird Gewalt zu Unterhaltungszwecken lediglich imaginiert. Jedoch wird diese Imagination – wie in nicht wenigen anderen Fällen auch – mit einer durchaus ideologischen Affirmation der Einheit und Stärke der Vereinigten Staaten und ihrer furchtlosen Führung verbunden. Hiervon lebt auch das Zitat im medialen Vorspiel der Siegesrede des spä221 teren Kriegsherren George W. Bush, das seinerseits, wie gesagt, eine direkte Reaktion auf die Bilder von 9/11 darstellte. Zugleich aber wurde hier in der Erklärung des Endes der Kampfaktionen ein Zustand des realen Weltlaufs annonciert – eine Beschreibung der militärischen und politischen Situation im Irak, die sich deshalb auch als einigermaßen irrig herausstellen konnte, weswegen die Bilder vom 1. Mai 2003 bald darauf zu einem Dokument der gravierenden Fehleinschätzungen der dortigen Lage wurden. Und sie hat sich mittlerweile in unterschiedlichem Ausmaß gegen die eindimensionale Regie der diesen Krieg anführenden Mächte gewendet. Denn was im Irak seitdem geschah, vollzog sich eben nicht wie in den patriotischen oder propagandistischen Filmen, die von dem glorreichen Verlauf eines Kampfes um Unabhängigkeit erzählen – weswegen es mittlerweile über 30 Kinofilme gibt, die auf direkte oder indirekte Weise das Trauma dieses Krieges mit vorwiegend kritischer Intonation zu verarbeiten suchen.8 Jedoch: Nicht alle dieser Filme verhalten sich mehr oder weniger kritisch. Es gibt immerhin einige Spielfilme, die sich einigermaßen apologetisch vor allem mit den Folgen der Invasion in den Irak befassen.9 Einer von ihnen ist der amerikanische Spielfilm Home of the Brave von Irwin Winkler aus dem Jahr 2006. Wie die knappe Hälfte der in den USA seither produzierten Filme über das Geschehen im Irak spielt die Handlung vorwiegend in den Staaten. Erzählt wird die Geschichte von vier Heimkehrern von der Front im Nahen Osten – einer Frau und drei Männern. Sie alle kommen stark traumatisiert 8 9 Hierzu zählen Spielfilme wie: Lions for Lambs (USA 2007, R: Robert Redford); Battle for Haditha (UK 2007, R: Nick Broomfeld); Redacted (USA/CAN 2007, R: Brian De Palma); In the Valley of Elah (USA 2007, R: Paul Haggis); The Hurt Locker (USA 2008, R: Kathryn Bigelow); Generation Kill (USA 2008, HBO-Serie, P: David Simon / Ed Burns); The Messenger (USA 2010, R: Oren Moverman); Green Zone (USA/UK 2010, R: Paul Greengrass). Unter den dokumentarischen Filmen (alle mit eindeutig kritischer Intonation) seien genannt: Weltverbesserer auf dem Schlachtfeld (GER 2007, R: Teresina Moscatiello); Heavy Metal in Baghdad (USA/CAN 2007, R: Suroosh Alvi, Eddy Moretti); Standard Operating Procedure (USA 2008, R: Errol Morris); Life After the Fall (UK/Irak 2008, R: Kasim Abid). Z.B. Saving Jessica Lynch (USA 2003, R: Peter Markle); American Soldiers (CAN 2006, R: Sidney J. Furie); The Lucky Ones (USA 2008, R: Neil Burger); Stop-Loss (USA 2008, R: Kimberly Peirce). 222 nach Hause zurück – traumatisiert vor allem durch ihren allerletzten, sehr verlustreichen Einsatz in den Straßen einer Stadt im Irak (Al Hayy). Der schwarze Außenseiter dieser Gruppe dreht nach einer Weile durch und wird in einer Auseinandersetzung mit der Polizei erschossen. Die Frau hingegen, die ihren rechten Unterarm verloren hat, findet mit einem überaus netten Kollegen ins Bett, der schwarze Chirurg findet eine ebenso attraktive wie fürsorgliche – ebenfalls schwarze – Therapeutin, die ihm hilft, seine Konflikte in Beruf und Familie zu bewältigen. Das Trauma kann also überwunden werden. Die vierte Figur freilich entschließt sich gegen ihren ursprünglichen Willen für einen erneuten Einsatz im Irak. Der Film endet mit einem längeren inneren Monolog dieses nicht gebrochenen, aber doch erschütterten Helden, in dem er seinen Eltern, denen er dies von Angesicht zu Angesicht nicht zu sagen vermag, gleichsam vor und für sich selbst erklärt, warum er nicht anders kann, als sich erneut an einer ihm mittlerweile durchaus zweifelhaften Mission zu beteiligen. Diese innere Rede wird zu Bildern der Stationen seiner Reise zurück in den Irak, dem Training sowie dem Beginn des ersten Einsatzes dort gesprochen. Der Film endet mit einem zunächst in die letzte Szene eingeblendeten, dann auf schwarzem Grund erscheinenden Machiavelli-Zitat: «Wars begin where you will but they do not end where you please». Hier einige Auszüge aus diesem Monolog: Dear mom and dad, I know you don’t understand why I reenlisted. It is confusing and scary for all of us. I know that. But I have to go back. I don’t wanna die and Jordan didn’t want to die either. And maybe when we were getting over there the first time we didn’t know where we were getting into. Maybe the leaders of our country didn’t know where they were getting into. Maybe the people don’t want us there, maybe this whole thing is just making it worse. But even after all that I can’t stay behind, knowing there are soldiers over there getting attacked every day and dying every day. I don’t feel like it’s wrong with me for wanting to go back over there and help. (…) I hope this can make sense to you, because it makes perfect sense to me. These are my guys, and I need them, just as much as they need me. (…) I’m going back, and I’m going back to the best job I know how (…). 223 Die Rechtfertigung des jungen Soldaten klingt gewiss ganz anders als die siegesgewissen Töne seines Präsidenten im Mai des Jahres 2003 – dem Jahr, in dem auch die Handlung des Films angesiedelt ist. Dennoch entfaltet Home of the Brave eine durchaus apologetische Perspektive auf den zweiten Irak-Krieg. Es lohnt sich, so legt sie nahe, und trägt für diejenigen, die es aushalten, wenn auch mit Schmerzen, zur Charakterschulung bei, dem eigenen Land – und vor allem den eigenen Kumpels – unter Einsatz des eigenen Lebens beizustehen, wie immer es um die Legitimität dieses Kampfes gegen den Terror auch bestellt sei. Ein Übriges tut das abschließende MachiavelliZitat: Jedes Kriegsgeschehen ist nun einmal unwägbar – eine Unwägbarkeit, die seinen Initiatoren nicht – oder doch nicht zur Gänze – zum Vorwurf gemacht werden kann. Eine derartige, wie immer durchwachsene affirmative Wende gibt es in dem Spielfilm In the Valley of Elah von Paul Haggis aus dem Jahr 2007 nicht. Wie in manch anderem der einschlägigen Filme geht die Story auch hier auf eine wahre Begebenheit zurück. Er hat seinen Schauplatz ebenfalls fast ausschließlich in den USA. Die (von Tommy Lee Jones gespielte) Hauptfigur, ein Vietnam-erprobter ehemaliger Militärpolizist, ist der Vater eines seit seiner Heimkehr aus dem Irak vermissten Soldaten. Er macht sich auf die Suche nach diesem, und bald darauf, als sich herausstellt, dass sein Sohn grausam ermordet wurde, auf die am Ende erfolgreiche Suche nach den Tätern. Es waren nicht die üblichen farbigen Verdächtigen im Drogenmilieu, so stellt sich nach etlichen Windungen und Wendungen heraus, sondern die eigenen – weißen – Kameraden, die ihn im Affekt erstochen und seinen Leichnam anschließend zerteilt und verbrannt haben. Das zentrale dramaturgische Gelenk dieses Films aber sind die immer wieder – insgesamt 8 Mal – eingespielten, notdürftig restaurierten Ausschnitte von Aufnahmen mit der Handycam des Ermordeten, die nach und nach zwar nicht erkennen, aber doch erahnen lassen, was zu der moralischen Degenerierung der jungen Soldaten führte. Mit nur wenig Übertreibung lässt sich sagen, dass in diesen Sequenzen – es sind, von einigen Fotos abgesehen, die einzigen, in denen etwas vom Schauplatz der Kampfeinsätze im Irak sichtbar wird – die durch den gesamten Film vermittelte Einstellung auf die dortigen Ereignisse kulminiert. Wir dürfen, 224 dies besagt diese Perspektive, den Bildern und sonstigen Botschaften nicht trauen, die aus dem von den alliierten Truppen besetzten Land übermittelt werden. Denn diese geben eine ebenso beschönigende wie trügerische Sicht auf die Situation im Irak. Die verzerrten Aufnahmen werden so zu einer Allegorie des verzerrten, die tatsächlichen Vorgänge nicht wahrhabenwollenden Blicks auf das, was in der Fremde wie daheim mit den an diesem Krieg Beteiligten geschieht. Zugleich bewahren sie einen künstlerischen Respekt vor der Undarstellbarkeit der äußeren und inneren Grausamkeiten, von deren Folgen die Geschichte dieses Films berichtet. Durch diesen Gestus erhält der Titel des Films einen mindestens doppelten Sinn. Er spielt auf den im Alten Testament beschriebenen Kampf zwischen den Philistern und den Männern Israels im Tal von Elah an, der stellvertretend von David und Goliath ausgefochten wird. Der Titel hält zum einen fest, wie angreifbar die überhebliche Großmacht USA bei ihrer Kriegsführung ist. Zum andern aber, und für die Rhetorik dieses Films weitaus wichtiger, ist es die Perspektive des David, die den Zuschauern dieses Films nahegelegt wird. «That’s how you fight monsters», sagt der alte Mann, der nun auch seinen zweiten Sohn durch den Irak-Krieg verloren hat, einem kleinen Jungen namens David, dem er eine verstörende Gute-NachtGeschichte erzählt. «You look him in the eye». Die Figur des David steht unter diesem zweiten Aspekt nicht für die irakischen insurgents, sondern für diejenigen, die – wie der anfangs noch regierungs- und armeegläubige Vater des ermordeten Soldaten – den Monstern im eigenen Land ins Auge zu blicken vermögen. Zu diesen Monstern gehören, wie der Vater erkennen muss, nicht allein die Kameraden, die an der Ermordung seines Sohnes beteiligt waren, sowie diejenigen, die die jungen Soldaten in den Irak gesandt und dort allein gelassen haben, sondern auch der eigene Sohn selbst, der unter der Last der eigenen Schuld – denn er hat, den vorgeschriebenen Einsatzroutinen folgend, einen kleinen Jungen überfahren – massive sadistische Neigungen entwickelt hat. Der Krieg verroht alle, die an ihm beteiligt sind, und mit ihnen die Gesellschaft, der sie angehören. Deswegen hisst der alte Militär am Ende des Films die Flagge der Vereinigten Staaten umgekehrt – als Zeichen eines militärischen und mehr noch zivilen Notstands. 225 III. Vier Thesen 1. In dem Spektrum der sei es (eher) dokumentarischen, sei es (eher) fiktionalen Auseinandersetzung des gegenwärtigen Kinos überwiegt insgesamt eine kritische Perspektive auf das Geschehen im Irak. Zumal die US-amerikanischen Filme – und dies sind die allermeisten – führen zusammen mit der Achtlosigkeit, Grausamkeit, Inhumanität und manchmal Absurdität der militärischen Operationen im Irak eine mehr oder minder verstörende Selbstbefragung vor. Diese richtet sich weniger auf die Legitimität dieses Krieges selbst, sondern auf die zerstörenden Folgen der Kriegsführung, die nicht nur rechtliche und moralische Grundsätze, sondern vor allem die Integrität und Selbstachtung von Opfern und Tätern betreffen. 2. Trotz der Heterogenität der filmischen Erzählweisen, durch die das Geschehen im Irak und auf Seiten der Heimgekehrten in Fiktion und Dokumentation verarbeitet wird, lässt sich somit eine übergreifende Tendenz festhalten. Zu beobachten ist ein deutlicher Primat der Erschütterung gegenüber der Etablierung normativer Perspektiven. Dem geläufigen Pro und Contra angesichts der umstrittenen Rechtfertigung für den zweiten Irak-Krieg wird eine Sicht – und nicht selten: eine Verschränkung von Sichtweisen – gegenübergestellt, die das gängige Pro und Contra oft gleichermaßen unterlaufen. 3. Die einschlägigen Filme tragen dazu bei, den Bereich des normativ Vertretbaren und nicht Vertretbaren anhand exemplarischer Geschichten imaginativ auszuleuchten. Mit überwiegend kritischer Intonation wird die Situation seit der alliierten Invasion in den Irak im Jahr 2003 in ihren vielfach verheerenden und traumatisierenden Folgen durchgespielt. Dabei überwiegt – mit Ausnahmen, von denen ich eine kurz vorgeführt habe – eine Rechtfertigung des Zweifels an der Berechtigung und stärker noch an der Durchführung dieses Krieges, mitsamt seinen Folgen sowohl für die Zivilbevölkerung als auch für die militärischen Akteure zumal in den unteren Rängen. 4. Gerade dadurch, so steht zu vermuten, hat die Ästhetik des gegenwärtigen Kinos einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Modifikation und 226 Transformation weniger einer bestimmten normativer Ordnung, als des normativen Bewusstseins unserer Zeit – und dies nicht allein in einem nationalen, sondern in einem globalen Rahmen. Sie stellt die Frage nach der Legitimität dieses und vergleichbarer Kriege, und sie hält sie – wenigstens – offen.10 Literatur Hampe, Michael. Eine kleine Geschichte des Naturgesetzbegriffs, Frankfurt a.M. 2007. Seel, Martin. «Bewegtsein und Bewegung. Elemente einer Anthropologie des Films». In: Neue Rundschau 4 (2008), S. 129–145. 10 Meine Überlegungen in diesem Beitrag haben stark profitiert von einem im Wintersemester 2009/2010 an der Goethe-Universität Frankfurt/M. gehaltenen Seminar zum gleichen Thema; für ihre Unterstützung besonders danken möchte ich Daniel Feige, Frederike Popp und Jochen Schuff. 227 «Se non è vero, è ben trovato». Geschichtsklitterung in italienischen Doku-Soaps Aram Mattioli Es soll nun niemand kommen und sagen, man müsse jedem Geschmack etwas bieten, jetzt, da wir unterhalb jeglicher Geschmacksgrenze angekommen sind. Die Wahrheit ist, ganz im Gegenteil, dass die Krise des Kinos weniger ästhetischer als intellektueller Natur ist. Worunter die heutigen Filme vornehmlich leiden, ist Dummheit …1 In seiner Autobiographie Gefährliche Zeiten hielt Eric J. Hobsbawm vor ein paar Jahren fest, dass die moderne Mediengesellschaft der Vergangenheit zu einer beispiellosen Bedeutung und einem enormen Marktpotential verholfen habe, um gleich warnend anzumerken: «Heutzutage wird mehr Geschichte denn je von Leuten umgeschrieben oder erfunden, die nicht die wirkliche Vergangenheit wollen, sondern eine, die ihren Zwecken dient. Wir leben heute im großen Zeitalter der historischen Mythologie».2 Auf eine fast schon unheimliche Weise trifft diese Beobachtung auf das Geschichtsfernsehen der Gegenwart zu, für das nicht so sehr professionell ausgebildete Historiker, sondern Regisseure und Redakteure verantwortlich zeichnen. Seitdem die vierteilige US-Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss3 1979 weltweit eine neue Phase in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Deutschland einläutete, weil es ihr gelang, das monströse Geschehen in der populären Form einer Familiengeschichte zu erzählen, hat die durch das Fernsehen vermittelte Geschichte einen beispiellosen Aufschwung erlebt. Nirgendwo sonst erreichen gegenwärtig historische Themen wahrscheinlich ein größeres Publikum als im Geschichtsfernsehen. Durch 1 2 3 Bazin (2009), 25f. Hobsbawm (2003), 337. Näheres dazu in Reichel (2007), 250–264; Hickethier (2009), 300–317, v.a. 307ff. 229 kein anderes Genre werden die Geschichtsbilder der Menschen und die Erinnerungskulturen ganzer Gesellschaften vermutlich nachhaltiger geprägt als durch TV-Histotainment.4 Das ist in Italien, wo ein Großteil der Bürger ihre Informationen ohnehin aus dem Fernsehen bezieht, noch weit ausgeprägter der Fall als im übrigen Europa.5 Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht die Frage, ob und gegebenenfalls wie die von der Rai produzierten und ausgestrahlten Doku-Soaps die nationalen Selbstbeschreibungen und Identitätsdiskurse verändert haben. Um unzulässige Verallgemeinerungen zu vermeiden, wird die Miniserie Il cuore nel pozzo (2005) von Alberto Negrin einer genauen und möglichst dichten Fallanalyse unterzogen, die aller Eindeutigkeit der Befunde zum Trotz nur vorläufige Ergebnisse generieren kann. I. Historische Doku-Soaps in Italien Wie anderswo in Westeuropa besetzten historische Doku-Soaps rasch auch in den italienischen Fernsehprogrammen einen prominenten Platz. In den letzten zehn Jahren verdrängten sie die zeitgeschichtlichen Thematiken gewidmeten Spielfilme berühmter Regisseure (wie die von Roberto Rossellini, Francesco Rosi oder Bernardo Bertolucci) aus der Primetime.6 Doku-Soaps mit historischem Hintergrund erwiesen sich als besonders geeignet, das große Publikum für Fragen der Geschichte anzusprechen. Für diese neuen Quotengaranten war und ist eine undurchschaubare Mischung von Fiktion und Fakten typisch und die Tendenz, auf Emotionen statt auf Aufklärung zu setzen.7 In den neuen 4 5 6 7 Vgl. für Italien und Deutschland Grasso (2006); Anania (2008); Fischer / Wirtz (2008); Cippitelli / Schwanebeck (2009). Kritisch zur Rolle des Fernsehens im Italien Berlusconis etwa Ginsborg (2005), 42; Stille (2006), 60ff.; Camilleri (2010), 35f. und Eco (2007), 130. «Zählt man die Auflagen aller italienischen Zeitungen zusammen, kommt man auf eine lächerliche Zahl im Vergleich zur Anzahl derer, die nur fernsehen. Es kommt darauf an, das Fernsehen zu kontrollieren, dann mögen die Zeitungen schreiben, was sie wollen». Eine engagierte und meinungsstarke Annäherung an das Thema wagt der Dokumentarfilm Videocracy. When TV is the dream reality becomes a nightmare (ITA 2009, R: Erik Gandini). Vgl. Grasso (2000); und vor allem Anania (2003). Vgl. Wirtz (2008), 15. 230 Formaten wird die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht mehr als kritische Aufarbeitung betrieben, sondern kommt «hauptsächlich im Modus des subjektiven Erlebens, des emotionalen Erzählens und der persönlichen Erinnerung»8 daher. Dazu personalisieren, dramatisieren und emotionalisieren die Soaps ungehemmt, indem sie etwa starken Frauen oder Kindern Hauptrollen einräumen. Stets machen sie einen Anspruch auf historische Authentizität geltend und dienen letztlich doch nur der Unterhaltung. Der fernsehgerechten Passform wegen ist der Anteil des Fiktionalen in ihnen stets hoch, ohne dass die Programmmacher den Zuschauern reinen Wein über diese entscheidende Tatsache einschenken würden.9 Die hier zu Tage tretende Nonchalance erklärt sich wesentlich dadurch, dass diese neue Form des TV-Histotainment nur solange funktioniert, wie die Zuschauer die Fiktion nicht als solche durchschauen und damit an die vermeintliche «Echtheit» des Dargestellten glauben. Zeitgeschichtlichen Themen gewidmete Doku-Soaps wie Senza Confini (2001), Maria José – l’ultima regina (2002), La fuga degli innocenti (2004), Cefalonia (2005) und Il sangue dei vinti (2009) erreichten spielend ein Massenpublikum. Einige unter ihnen wie La guerra è finita (2002)10 von Lodovico Gasparini und Edda Ciano Mussolini (2005) von Giorgio Capitani, ganz zu schweigen von Perlasca – un eroe italiano (2002) und Il cuore nel pozzo (2005) – beide von Alberto Negrin – entpuppten sich als wahre Straßenfeger. Der Perlasca-Zweiteiler, der im Januar 2002 anlässlich des zweiten HolocaustGedenktages ausgestrahlt wurde, erreichte eine rekordverdächtige Einschaltquote.11 Immerhin fast 11 bzw. 13 Millionen Italiener saßen an den beiden Winterabenden vor den Bildschirmen – so viele wie vermutlich nie zuvor bei einem Film zu einem zeitgeschichtlichen Thema.12 Eine beeindruckend hohe Einschaltquote erreichte auch das Melodrama Il cuore nel pozzo (Das Herz am Abgrund), das am 6. und 7. Februar 2005 im Hauptabendprogramm 8 Fischer (2008), 33. 9 Vgl. Wirtz (2008), 29. 10 Vgl. «La Guerra è finita, lunedì oltre 9 milioni davanti alla tv». In: La Repubblica, 8. Mai 2002, S. 42. Den zweiten Teil des Films verfolgten 8.655 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen, was einer Quote von 31.84 Prozent entsprach. 11 Vgl. Marcus (2007), 125–137; Perra (2010). 12 Vgl. Grasso (2008), 581. Das entsprach einer Quote von 38.91 bzw. 43.81 Prozent. 231 über die Bildschirme flimmerte. Am ersten Abend saßen über 10 Millionen Menschen vor ihren Fernsehgeräten, was einem Marktanteil von 36.6 Prozent entsprach.13 In diesen beiden Fällen zumindest kann man von medialen Großereignissen sprechen. Der erste starke Boom der italienischen Doku-Soaps fällt in die Zeit der zweiten und dritten Regierung von Silvio Berlusconi (2001–2006).14 Bekanntlich steht Berlusconis Name unter anderem für den Aufstieg des Privatfernsehens und damit für eine seichte, politisch einlullende Unterhaltung, der sich inzwischen auch die Rai-Sender angepasst haben.15 Lediglich Rai Tre machte den Abschied vom Bildungsfernsehen nicht ganz so stark mit. Zudem gelang es dem vom Mailänder Medienmagnaten angeführten Rechtsbündnis, nach dem zweiten Wahlsieg von 2001 ihren Einfluss auf die Rai auszubauen, der sich auch in einem revisionistischen, das heißt anti-antifaschistischen Umgang mit der Mussolini-Diktatur, dem Bürgerkrieg und der Resistenza manifestierte.16 In der diskursiven Neuausrichtung der italienischen Erinnerungskultur wurde immer stärker die absolute Unvergleichbarkeit zwischen nationalsozialistischem Deutschland und dem faschistischen Italien betont, um die Mussolini-Diktatur positiv in die Kontinuität der Nationalgeschichte einordnen zu können. Viele Exponenten des Berlusconi-Bündnisses erklärten den alten Unterschied zwischen Faschismus und Antifaschismus für obsolet, und denjenigen zwischen Demokratie und Totalitarismus für entscheidend. Freilich lief diese Operation auf eine schleichende Aufwertung von Mussolinis angeblicher «Rosenwasserdiktatur» (Indro Montanelli) und auf eine weitere Diskreditierung der Resistenza und des bewaffneten Widerstands hinaus, der nach dem 8. September 1943 einen beachtlichen, wenn auch nicht entscheidenden Beitrag zur Befreiung des Landes vom nazifascismo leistete.17 Nach dem Machtwechsel von 2001 griffen manche von der Rai produzierte Miniserien erinnerungskulturelle Themen der regierenden Rechten auf. Mit dramaturgischem Geschick setzten diese nun die für das italieni13 14 15 16 17 Vgl. «Oltre 10 milioni per film sulle foibe». In: La Repubblica, 9. Februar 2005, S. 46. Vgl. Rusconi u.a. (2010). Vgl. Ginsborg (2005), 46f.; Feustel (2007), 95ff. Vgl. Stille (2006), 311ff. Ausführlich dazu jetzt Mattioli (2010). 232 sche Selbstverständnis wichtigen letzten 20 Monate des Zweiten Weltkriegs in einer Perspektive ins Bild, die mit dem lange Zeit vorherrschenden Resis­ tenza-Narrativ brach.18 Prominent traten darin etwa «gute Faschisten» als Judenretter und Beschützer von Waisenkindern auf. In Edda Ciano Mussolini wird das «tragische Schicksal» der Diktatorentochter geschildert, die durch die Arglist der Zeit zwischen ihren Vater und ihren Ehemann gerät, der schließlich 1944 als eine Art Widerstandskämpfer auf Wunsch der «bösen Deutschen» hingerichtet wird. In Cefalonia wird das schwere Massaker der deutschen Wehrmacht an ihren früheren Waffenbrüdern in eingängigen Bildern aufgerollt, ganz ohne auf die italienische Rolle in der Besatzung Griechenlands einzutreten. La guerra è finita thematisiert den inneritalienischen Bürgerkrieg zwischen 1943 und 1945, weckt Verständnis für die angeblich ehrenwerten Motive der «ragazzi von Salò» und ruft zum Schluss ganz im Sinne des rechten Erinnerungsdiskurses zur «nationalen Versöhnung» und damit zu einem endgültigen Schlussstrich auf. Kurz gesagt, mit aufwendigen Produktionen unterstützen die Rai-Sender die im Gang befindliche Neuvermessung des kollektiven Gedächtnisses und spielten in diesem Prozess sogar eine nicht unwichtige Rolle.19 In mani­fester Weise kann man diese Tendenz in Alberto Negrins Zweiteiler Il cuore nel pozzo nachweisen. Trotz der gegenteiligen Beteuerung des Regisseurs, der glauben machen wollte, mit seinem Film lediglich eine bislang noch nie erzählte Geschichte fernab jeder politischen Stellungnahme realisiert zu haben, handelte es sich bei diesem Streifen um einen eindeutigen Fall von TV-Revisionismus.20 Nicht nur dessen Inhalt, sondern auch dessen Entstehungsgeschichte lassen daran keinen Zweifel. II. Die Foibe-Massaker als neuer nationaler Erinnerungsort Ungeachtet der Tatsache, dass Italien vom 10. Juni 1940 bis zum 8. September 1943 als engster Verbündeter Deutschlands an Hitlers «Neuordnung 18 Vgl. ebd., 24–56. 19 Vgl. Anania (2003), 76. 20 Vgl. Alberto Negrin, Interview auf www.ilcuorenelpozzo.rai.it unter der Rubrik Intervista. 233 Europas» mitwirkte, sehen sich viele Italiener heute vorwiegend als Opfer von dramatischen Ereignissen, die die deutsche Besetzung Nord- und Mittelitaliens seit dem Herbst 1943 über sie brachte. Die kollektive Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wird durch die Erfahrung von materieller Not und Angst, aber auch durch die alliierten Städtebombardements und die deutschen Repressalien an der Zivilbevölkerung bestimmt. Zu den nationalen Tragödien des Zweiten Weltkriegs zählen viele mittlerweile auch die von Tito-Partisanen in den Karstschlünden, den so genannten Foibe, umgebrachten Italiener und den sich bis 1954 hinziehenden Exodus von rund 300.000 Landsleuten aus Istrien und Dalmatien. Die genaue Zahl der Foibe-Opfer lässt sich nicht mehr exakt bestimmen, weil nicht alle Leichname geborgen werden konnten und zum Teil auch Akten fehlen. Die seriöse Forschung schätzt, dass in den Karstschlünden bis zu 5.000 Menschen umkamen.21 Einige Historiker und Publizisten brachten jedoch eine überhöhte Opferzahl von bis zu 20.000 Toten in Umlauf.22 Dass die Foibe-Massaker und die Abwanderung aus den ehemaligen Ostgebieten nach 1989 zu einem nationalen Erinnerungsort aufstiegen, ging auf die Initiative der Postfaschisten zurück. Bei diesem Thema gelang es der Alleanza Nazionale die faschistische Tätergeschichte im Adria-Raum in eine nationale Opfererzählung umzukehren. Allerdings ließ sich diese Operation nur um den Preis durchführen, dass wesentliche Teile der Geschichte ausgeblendet wurden. Der Turiner Historiker Angelo Del Boca sprach in diesem Zusammenhang zu Recht von «halbierter Erinnerung».23 Denn die Gewalt, die die jugoslawische Partisanenbewegung seit Herbst 1943 an Teilen der italienischen Bevölkerung in Julisch Venetien, Istrien und Dalmatien verübte, muss immer auch als Folge jener rassistisch motivierten Unterdrückungspolitik Beachtung finden, die Slowenen und Kroaten zuvor während der faschistischen Herrschaft erlitten hatten. Wie die Wehrmacht und die SS in ihrer Zone zogen auch die italienischen Besatzer eine Spur von Tod und Verwüstung durch Jugoslawien. In den Partisanengebieten brannten sie zahlreiche Dörfer und Häuser nieder, 21 Vgl. Oliva (2007), 56. 22 Vgl. Verginella (2007), 45; Scotti (2005) 151ff. 23 Vgl. Di Francesco (2006). 234 plünderten und bereicherten sich schamlos, nahmen ungezählte zivile Geiseln und exekutierten Tausende von Menschen, unabhängig davon, ob es sich dabei um bewaffnete Kämpfer oder um unbeteiligte Dorfbewohner handelte. Für Anschläge der «Rebellen» nahmen sie die zivile Bevölkerung systematisch in Kollektivhaftung. Um dem Widerstand das Wasser abzugraben, wurden allein in Slowenien 30.000 Zivilisten deportiert und ins System der italienischen Konzentrationslager verschleppt. Über ganz «Großitalien» verstreut, existierten zwischen 1940 und 1943 mehr als 50 Konzentrationslager.24 In ihnen internierte das Regime, wie die Forschung erst in den letzten Jahren dokumentiert hat, nicht nur Antifaschisten und «feindliche Ausländer», sondern auch Angehörige unerwünschter Minderheiten. Neben Lagern für Juden und «Zigeuner» entstanden auch solche für slawische Männer, Frauen und Kinder, etwa bei Gonars und Visco in Julisch Venetien und bei Renicci in der Toskana. Mindestens sieben «Slawenlager» richteten die neuen Herren im besetzten Jugoslawien ein. Dabei handelte es sich meistens um improvisierte Zeltstädte, in denen es an allem mangelte: an Essen und Decken, aber auch an Matratzen, Waschgelegenheiten und medizinischer Versorgung. Zwar handelte es sich bei den Lagern in Melada, Zlarino, Mamula, Prevlaka, Buccari und Porto Re, deren Namen heute fast niemand mehr kennt, nicht um Vernichtungslager. Dennoch war die Todesrate hoch. Der berüchtigste Lagerkomplex befand sich auf der Insel Rab. Hier waren vorwiegend Bauern, Holzfäller, Arbeiter und Handwerker interniert. In überfüllten Zelten völlig unzureichend untergebracht, starben dort innerhalb eines Jahres mindestens 1.500, vielleicht sogar 3.000 der insgesamt 15.000 Insassen an den erlittenen Entbehrungen.25 Wie viele Tote die italienische Okkupation in Jugoslawien insgesamt gefordert hat, ist umstritten. Der in Turin lehrende Historiker Brunello Mantelli geht von mindestens 250.000 Opfern aus.26 Wenngleich sich die genaue Zahl nicht angeben lässt, steht fest, dass die italienischen Streitkräfte in Jugoslawien, Albanien und Griechenland schwere Kriegs- und Besatzungsverbrechen begingen. Jedenfalls stachelte die brutale Besatzungsherrschaft den Hass gegen die Italiener mächtig an. 24 Vgl. Capogreco (2004). 25 Näheres dazu in Kersevan (2008). 26 Vgl. Mantelli (2000), 57. 235 Als die faschistische Diktatur zusammenbrach, unterschieden viele Jugoslawen aufgrund des erlittenen Unrechts nicht mehr zwischen Italienern und Faschisten. Nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 brachte die Partisanenarmee von Marschall Tito in Istrien und Dalmatien einige Hundert Italiener um, in dem sie diese aneinandergefesselt in Foibe stürzten, wo sie elendiglich starben. Nachdem die jugoslawische Partisanenarmee im April 1945 Triest erreichte, das bis dahin unter deutscher Besatzung gestanden hatte, kam es zu einer zweiten Abrechnungswelle. Schätzungen zufolge kostete diese Säuberungswelle einigen Tausend Italienern das Leben. Nach Schnellprozessen wurden diese oft in die Karstschlünde gestoßen. Die Gewaltwelle endete am 9. Juni 1945. Nachdem der Pariser Friedensvertrag vom 10. Februar 1947 die früheren italienischen Provinzen Pola, Fiume und Zara sowie Teile des Gebiets um Triest und Görz Jugoslawien zuschlug, verschlechterten sich die Lebensbedingungen der dort lebenden Italiener. Bis 1954 gaben rund 300.000 von ihnen ihre Heimat auf und siedelten nach Italien über, wo sie zunächst in 109 Lagern Aufnahme fanden. Umstritten sind heute nicht so sehr die Fakten, sondern die Motive, weshalb die jugoslawische Partisanenarmee zahlreichen Italienern in Istrien und Julisch Venetien nach dem Leben trachtete. Festzustehen scheint: Die infoibiati waren überwiegend Faschisten und kroatische Kollaborateure, obwohl es auch unschuldige Italiener traf.27 Wissenschaftlich am überzeugendsten ist die Deutung, dass es sich bei den Foibe-Massakern um politische Säuberungsaktionen handelte, die durch Revancheabsichten und nationalen Groll motiviert waren.28 Damit steht nicht fest, dass es historisch korrekt ist, die Exzesse als «ethnische Säuberungen» der jugoslawischen Kommunisten zu deuten. «In diese Höhlen wurden nicht nur Italiener geworfen», betont die an der Universität Ljubljana lehrende Historikerin Marta Verginella, «sondern auch Deutsche, Slowenen, Kroaten, einige sogar lebendig. Alle Krieg führenden Parteien benutzten dieselben Höhlen, auch deutsche Truppen und faschistische Einheiten der Republik von Salò».29 27 Vgl. Scotti (2005), 14f. 28 Vgl. Oliva (2007), 54. 29 Verginella (2007), 58. 236 Im Kalten Krieg breiteten sowohl die staatstragenden Christdemokraten als auch die oppositionellen Kommunisten einen Mantel des Schweigens über dieses dunkle Kapitel aus. Die christdemokratischen Nachkriegsregierungen hatten kein Interesse daran, an ihre politische Verantwortung für den Pariser Friedensvertrag vom 10. Februar 1947 erinnert zu werden, der nach Ansicht vieler Bürger die «Würde Italiens»30 verletzt hatte und als nationale Schmach galt. Die Absicht, die Verantwortlichen für die Foibe-Massaker vor Gericht zu stellen, hätte mit Bestimmtheit die Gegenforderung provoziert, zuerst die schweren italienischen Kriegs- und Besatzungsverbrechen in Jugoslawien gerichtlich beurteilen zu lassen.31 Aus Gründen der Staatsräson zogen es die christdemokratischen Regierungschefs deshalb vor, keine schlafenden Hunde zu wecken und die Beziehungen zum Nachbarn nicht zusätzlich zu belasten. Umgekehrt warf die Angelegenheit auch für den PCI die unangenehme Frage auf, wie er denn zu Titos Partisanenarmee gestanden war.32 Während des Ost-West-Konflikts pflegten einzig einige Lokalhistoriker, die überlebenden Flüchtlinge und die Neofaschisten die Erinnerung an die Foibe und den Exodus aus Istrien und Dalmatien. Niemals verblasste sie in den Grenzstädten Triest und Gorizia. Regelmäßig sahen sich die Flüchtlinge auf ihren Treffen, auf denen sie der Ereignisse und ihrer Toten gedachten.33 Für sie stellten der Verlust der alten Heimat und der ungesühnte Massenmord offene Wunden der Geschichte dar. Schon 1980 wurde die nahe von Triest gelegene Foiba von Basovizza auf ihre Initiative hin zu einem Denkmal von nationalem Interesse erklärt. Des Themas nahm sich früh schon der MSI an, ohne damit bis zum Fall des Eisernen Vorhangs jedoch punkten zu können. Bei den Neofaschisten spielten dafür weiter bestehende Territorialansprüche gegenüber Jugoslawien und die Forderung nach Sühne für die von Titos Partisanen begangenen Verbrechen eine Rolle. Freilich instrumentalisierten sie das Thema für ihre politischen Zwecke. 30 31 32 33 Lorenzini (2007), 107ff. Vgl. Oliva (2005). Vgl. Oliva (2007), 58. Vgl. etwa Ballinger (2003), 140; und Mori (1987). 237 Nach dem Zerfall des kommunistischen Jugoslawiens änderten sich die Rahmenbedingungen des Erinnerns grundlegend. Im September 1992 erhob Staatspräsident Oscar Luigi Scalfaro die Foiba von Basovizza bei Triest zum Nationaldenkmal und damit auf die höchst mögliche Erinnerungsstufe.34 Mitte der neunziger Jahre, rund um den 50. Jahrestag der tragischen Ereignisse, fanden erstmals größere Gedenkanlässe statt. Den Foibe wurde nun die Bedeutung eines «nationalen Schreins»35 zugeschrieben. Die Erinnerung an die Gräueltaten von Titos Partisanenarmee hörte auf, eine alleinige Domäne der Opferkreise und der extremen Rechten zu sein. Auftrieb erhielt dieser Prozess durch den linksdemokratischen Kammerpräsidenten Luciano Violante, der dem Thema seit seiner Wahl 1996 eine hohe Bedeutung zumaß. Schon in seinen ersten Amtsmonaten verurteilte der Postkommunist – unter dem Beifall der Rechten – die jahrzehntelange «Verschwörung des Schweigens». In der von den Siegern geschriebenen Geschichte und in einem Klima der besonderen Nachsicht gegenüber Tito seien die Foibe, so Luciano Violante, während der Blockkonfrontation aus der nationalen Erinnerung getilgt worden.36 In einer Diskussion mit Gianfranco Fini, die am 14. März 1998 in Triest stattfand, ging der Kammerpräsident noch einen Schritt weiter. Den Opfern der Foibe sei die nationale Anerkennung zu lange versagt geblieben. Nun sei die Zeit gekommen, die Wunden der Geschichte zu schließen. Die Foibe könnten Teil einer gemeinsam geteilten nationalen Erinnerung werden.37 75 Historiker, darunter so bekannte wie Luciano Canfora, Enzo Collotti und Claudio Pavone, kritisierten Violantes Vorstoß heftig, weil der Kammerpräsident den Partisanen der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee die alleinige Schuld an den Foibe-Massakern gab, ohne auf die historische Verantwortung des Faschismus für den Krisenherd Adria hinzuweisen. Eine geteilte Erinnerung, wie sie Mussolinis Erben vorschlagen, sei grundsätzlich unmöglich. «Vergessen wir nie», stand im Protestschreiben der Historiker zu lesen, «dass der wahre Unterschied zwischen Antifaschisten und Faschis34 35 36 37 Vgl. «Il monumento della Foiba di Basovizza» auf www.foibadibasovizza.it/in-breve.htm. Ballinger (2003), 144. Vgl. «Violante. Sulle Foibe congiura del silenzio». In: La Repubblica, 26. August 1996, S. 8. Vgl. Longo (1998). 238 ten in der Tatsache bestand, dass Letztere faktisch ein System verteidigten, das die Gaskammern und das Krematorium von Auschwitz produziert hatte, während Erstere diese vom Antlitz der Erde tilgen wollten».38 Trotz dieser Mahnung ließ die Rechte nicht locker. Aus der Regierungsverantwortung heraus intensivierte das Berlusconi-Bündnis seinen Kampf, die dramatischen Ereignisse an der Nordostgrenze im kollektiven Gedächtnis fest zu verankern. Als treibende Kraft erwiesen sich erneut die Postfaschisten der AN, dabei unterstützt von Mandatsträgern von FI wie dem Triester Bürgermeister Roberto Dipiazza. Von der Tageszeitung La Stampa gefragt, was für Filme er gerne künftig im staatlichen Fernsehen sehen würde, regte der dafür zuständige Kommunikationsminister Maurizio Gasparri 2002 einen Spielfilm über die «Tragödie der Foibe» an. Mit einer Dokumentation, in der die Bergung von Skeletten gezeigt wird, würde nur Abscheu erregt. Um das Massenpublikum zu erreichen, sei eine fiktive Geschichte, die das Schicksal einer dieser armen Familien aus Istrien oder Dalmatien erzähle, weit wirkungsvoller. «Das sind große Tragödien. Wie die des Holocaust und die der Anne Frank»39 – ergänzte der Minister, womit er die Foibe-Massaker mit der Shoah in einem Atemzug nannte. Bereits geraume Zeit nach Gasparris Wunsch gab die Rai bei Alberto Negrin einen Zweiteiler in Auftrag, der seine rechtskonservativen Erwartungen mehr als nur erfüllte. III. Ein krasser Fall von TV-Revisionismus Negrins dreistündiger Fernsehfilm spielt 1944 auf der Halbinsel Istrien. Es handelt sich um eine reine Fiktion, die sich sehr frei an den historischen Ereignissen orientiert. Genretypisch suggeriert der Streifen jedoch, dass sich alles genauso zugetragen habe und bedient damit die Illusion von Authentizität.40 In simplester Schwarzweißzeichnung werden die jugoslawischen Partisanen als slawokommunistische Bösewichte und die Italiener als bedauernswerte 38 «Foibe: Contro Violante un appello per la verità». In: Il Manifesto, 18. März 1998. Vgl. auch «Scontro sulle foibe tra storici e Violante». In: La Repubblica, 19. März 1998, S. 12. 39 Martini (2002). 40 Eine kritische Analyse des Films findet sich in Verginella (2007), 44–54. 239 Opfer gezeichnet. Die Titokommunisten, die der deutschen Besatzungsherrschaft und ihren italienischen Helfershelfern bewaffneten Widerstand entgegensetzten, erscheinen darin als eine «Bande von Männern ohne Skrupel, Mörder, Trunkenbolde, Landdiebe, Vergewaltiger, die nur von der willkür­ lichen Rache und vom Hass auf die Italiener getrieben werden»41 und zielstrebig bis nach Triest vorrücken. Um die Dramaturgie zu unterstützen, staffiert Negrin diese mit Attributen wie Lederstiefeln und Schäferhunden aus, die in Filmproduktionen über den Zweiten Weltkrieg üblicherweise dazu verwendet werden, um SS-Männer darzustellen.42 Der Held des Films heißt Ettore, der als Salò-Milizionär zum Retter vieler italienischer Waisen wird, die ihre Eltern in den Karstschlünden verloren haben. Er verkörpert den «guten Faschisten» mit dem großen Herz, der wie der Waisenpriester Don Bruno von tiefer Vaterlandsliebe und heroischer Opferbereitschaft angetrieben wird. Das aus einer Kinderperspektive erzählte Rührstück reduziert Massenmord und Vertreibung auf die private Rache eines kleinen jugoslawischen Kommandanten, der von einer italienischen Frau abgelehnt wird und im Kampf um das gemeinsame Kind zur Bestie wird.43 Ein Rückblick auf die Jahre faschistischer Unterdrückungspolitik in Istrien unterbleibt ebenso wie ein solcher auf die Exzesse der deutschen Besatzung, so dass man von einer verpassten Gelegenheit sprechen muss, die am Ende des Zweiten Weltkriegs an Italienern begangenen Gräueltaten dem Publikum historisch auf wirklich ernsthafte Weise zu erklären.44 In Slowenien und Kroatien löste dieser Fall von TV-Revisionismus einen Sturm der Entrüstung aus. Der slowenische Schriftsteller Drago Jancar warf dem Film vor, alte Wunden aufzureißen und weit entfernt von Wahrheitsliebe und «moralischer Vivisektion» zu sein. Negrin hätte «ästhetischen und politischen Kitsch» produziert, der mehr zudecke als erhelle. Er belaste das Verhältnis zwischen Nachbarn. Und mahnend fügte er hinzu: «So wie das heutige Deutschland nicht der Erbe des nazistischen Wahnsinns ist, so kann auch das heutige Italien nicht die Geisel der historischen faschistischen Verirrungen sein. Doch Italien muss seine Verbrechen 41 42 43 44 Ebd., 50. Vgl. ebd., 54. Vgl. Haas (2005). Vgl. ebd. 240 kennen und verstehen, wenn es den Moloch des Nationalismus und der Verachtung des Nachbarn nicht noch einmal aus der Flasche lassen will».45 Der Zweiteiler erreichte nicht nur ein Riesenpublikum, er wirkte durch seine eingängige Dramaturgie prägend auf den Erinnerungsdiskurs ein. Bezeichnenderweise ließ ihn die Rai kurz vor dem ersten nationalen Gedenktag ausstrahlen, der am 10. Februar 2005 an die Foibe-Opfer und an den istrisch-dalmatinischen Exodus erinnerte. Ein Jahr zuvor hatten die beiden Kammern des Parlaments einen Gesetzesvorschlag des AN-Politikers Roberto Menia aus Triest gut geheißen. Die Deputiertenkammer stimmte der Einführung eines Giorno del ricordo mit 502 zu 15 Stimmen bei 4 Enthaltungen deutlich zu.46 Einzig die beiden kommunistischen Kleinfraktionen traten dagegen auf. Nach der Abstimmung jubilierten viele rechtsnationale Abgeordnete und sprachen von einem «sehr schönen Akt des Parlaments», ja von «einer großen Anerkennung nach zu vielen Jahren des Vergessens».47 Innerhalb eines Jahrzehnts wanderten die Foibe-Massaker und der Exodus aus Istrien und Dalmatien von der Peripherie ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatten. Mit der Einführung des Foibe-Gedenktages wurde 2004 nichts weniger als ein neuer nationaler Erinnerungsort etabliert. Allerdings trug die Erinnerungsoffensive der Rechten kaum dazu bei, das historische Wissen um die Vorgänge an der Nordostgrenze Italiens zu vertiefen. Mehr und mehr wurden die Foibe im nationalen Erinnerungsdiskurs zu einem «Ort des Martyriums der Italiener» und zu einem Synonym für einen lange verleugneten Genozid der jugoslawischen Kommunisten umfunktioniert.48 Die neuen Meinungsmacher in Politik und Medien brachten weit überhöhte Opferzahlen in Umlauf und schreckten nicht davor zurück, die Foibe-Massaker als Resultat einer vom Tito-Regime systematisch betriebenen «ethnischen Säuberung» zu deuten. «Während Italien das Ende des Krieges erlebte», schrieb das Nachrichtenmagazin Panorama im Sommer 2004 beispielsweise, «löschten die jugoslawischen Partisanen mit dem roten Tito-Stern grausam ganze Famili45 Jancar (2006). 46 Vgl. «Foibe, una Giornata della memoria». In: La Repubblica, 12. Februar 2004, S. 27. 47 «Giorno del Ricordo per le foibe. Approvata la legge». In: La Repubblica, 17. März 2004, S. 18. 48 Vgl. Verginella (2007), 54. 241 en aus, Männer und Frauen und mit ihnen oft Kinder, nur weil sie sich der Slawisierung der Gebiete erklärtermaßen oder bloß potenziell entgegenstellten».49 IV. Schluss Aller gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz besteht die Hauptfunktion der «Foibe»-Erzählung nicht darin, die tragischen Ereignisse in der multiethnischen Grenzregion dem Vergessen zu entreißen, um damit das Bild der jüngeren Vergangenheit vollständiger zu zeichnen. Dagegen wäre nichts einzuwenden. Der regierenden Rechten ging und geht es darum, den Mythos von den italiani brava gente, die in den verlorenen Ostgebieten zu unschuldigen Opfern einer kommunistischen Vergeltungsorgie geworden seien, auf neue Weise zu beschwören und durch die Behauptung, dass es sich dabei um eine lange Zeit verschwiegene nationale Tragödie handle, die Herzen zu rühren. Faschisten und Salò-Milizionäre seien doch auch nur bravi ragazzi und antikommunis­ tische Patrioten gewesen, die endlich den Dank des Vaterlands verdienten, und die Kommunisten die wahren Bestien – darauf läuft die rechte Umdeutung der Geschichte hinaus.50 Dass es sich dabei um eine sehr selektive und einseitige Sicht auf die Ereignisse handelt, muss nicht eigens betont werden. Es kann nicht der wissenschaftliche Wert dieser Doku-Soap sein, der Rai Uno am 10. Februar 2010 bewog, die Schmonzette ein zweites Mal auszustrahlen – ohne damit dieses Mal wie noch 2005 eine öffentliche Kontroverse auszulösen. Das Primetime-fähige Geschichtsfernsehen sagt auch im italienischen Fall wenig über die Vergangenheit aus, die sie zu behandeln vorgibt. Interessieren muss es uns jedoch im Hinblick auf das neue Selbstverständnis im Land und die anti-antifaschistischen Imaginationen, die von einem immer beachtlicheren Teil der heutigen Italiener geteilt werden. So gesehen, erweisen sich die zahlreichen von der Rai seit 2001 ausgestrahlten Doku-Soaps in der Tat als wirkungsmächtiges Medium, das ein neues nationales Erinnerungsnarrativ flankiert und zu seiner Festigung beigetragen hat. 49 «A Tivat, sul set di ‹Il cuore nel pozzo›». In: Panorama, 22. Juli 2004. 50 Vgl. Mattioli (2010), 99ff. 242 Literatur Anania, Francesca. Immagini di storia. La televisione racconta il Novecento, Rom 2003. Anania, Francesca. I mass media tra storia e memoria, Rom 2008. Ballinger, Pamela. History in Exile. Memory and identity at the borders of the Balkans, Princeton 2003. Bazin, André. Was ist Film?, Berlin 2009. Camilleri, Andrea. Was ist ein Italiener?, Berlin 2010. Capogreco, Carlo Spartaco. I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista, 1940 – 1943, Turin 2004. Cippitelli, Claudia / Axel Schwanebeck (Hg.). Fernsehen macht Geschichte. Vergangenheit als TV-Ereignis, Baden-Baden 2009. Di Francesco, Tommaso. «La tragedia delle foibe e i crimini fascisti». In: Il Manifesto, 14. Februar 2006. Eco, Umberto. Im Krebsgang voran. Heiße Kriege und medialer Populismus, München 2007. Feustel, Dirk. One Man Show. Silvio Berlusconi und die Medien, Marburg 2007. Fischer, Thomas / Rainer Wirtz (Hg.). Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fernsehen, Konstanz 2008. Fischer, Thomas. «Erinnern und Erzählen. Zeitzeugen im Geschichts-TV». In: Fischer / Wirtz (2008), S. 33–50. Ginsborg, Paul. Berlusconi. Politisches Modell der Zukunft oder italienischer Sonderweg?, Berlin 2005. Grasso, Aldo. Storia della televisione italiana, Mailand 2000. Grasso, Aldo (Hg.). Fare storia con la televisione. L’immagine come fonte, evento, memoria, Mailand 2006. Grasso, Aldo. Enciclopedia della televisione, Mailand 2008. Haas, Franz. «Italiens wunde Ostgrenze». In: Neue Zürcher Zeitung, 11. Februar 2005, S. 41. Hickethier, Knut. Nur Histotainment? Das Dritte Reich im bundesdeutschen Fernsehen, München 2009. Hobsbawm, Eric J. Gefährliche Zeiten. Ein Leben im 20. Jahrhundert, München / Wien 2003. 243 Jancar, Drago. «Der Verbrecher, mein Nächster». In: Neue Zürcher Zeitung, 25. Februar 2006, S. 69. Kersevan, Alessandra. Lager italiani. Pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941 – 1943, Rom 2008. Longo, Alessandro. «Chiudiamo le ferite della storia». In: La Repubblica, 15. März 1998, S. 2. Lorenzini, Sara. L’Italia e il trattato di pace del 1947, Bologna 2007. Mantelli, Brunello. «Die Italiener auf dem Balkan 1941 – 1943». In: Christof Dipper u.a. (Hg.). Europäische Sozialgeschichte, Berlin 2000, S. 57–74. Marcus, Millicent. Italian Film in the Shadow of Auschwitz, Toronto / Buffalo 2007. Martini, Fabio. «Il ministro delle comunicazioni. Deciderà il CDA, esprimo solo il mio pensiero di telespettatore». In: La Stampa, 18. April 2002. Mattioli, Aram. «Viva Mussolini!». Die Aufwertung des Faschismus im Italien Berlusconis, Paderborn 2010. Mori, Anna Maria. «Giorni di tensione a Trieste. I profughi ricordano l’Istria». In: La Repubblica, 20. September 1987, S. 9. Oliva, Gianni. Profughi. Dalle foibe all’esodo. La tragedia degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia, Mailand 2005. Oliva, Gianni. «Die Foibe. Die Gründe eines Schweigens». In: Renato Cristin (Hg.). Die Foibe. Vom politischen Schweigen zur historischen Wahrheit, Berlin 2007. Perra, Emiliano. «Legitimizing fascism through the Holocaust? The reception of the miniseries Perlasca. Un eroe italiano in Italy». In: Memory Studies 3 (2010), S. 95–109. Reichel, Peter. Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater, Frankfurt a.M. 2007. Rusconi, Gian Enrico u.a. (Hg.). Berlusconi an der Macht. Die Politik der italienischen Mitte-Rechts-Regierungen in vergleichender Perspektive, München 2010. Scotti, Giacomo. Dossier foibe, San Ceario di Lecce 2005. Stille, Alexander. Citizen Berlusconi, München 2006. Verginella, Marta. «Geschichte und Gedächtnis. Die Foibe in der Praxis der Aushandlung der Grenzen zwischen Italien und Slowenien». In: Luisa Accati / Renate Cogoy (Hg.). Das Unheimliche in der Geschichte, Berlin 2007, S. 25–77. Wirtz, Rainer. «Alles authentisch». In: Fischer / Wirtz (2008), S. 9–32. 244 Der «Hintersinn» der Bilder. Embleme barocker Klosterbibliotheken: Rätsel und Argument Hans-Otto Mühleisen I. Emblem als kunstvolles Denkspiel Die Dichotomie im Verständnis der Bilder, einerseits dem auf sich selbst zeigenden Original und andererseits dem als Instrument genutzten Abbild, ist ein Zugang der Moderne. Während Ersteres unabhängig von übergeordneten Mustern sein soll, ist Letzteres abhängig von einer übergeordneten Wirklichkeit, in der Referenz dieses Projekts Bildverlust in der Wissensgesellschaft also kein authentisches Bild, das man eher in Museen als Ort des kulturellen Gedächtnisses zu finden vermutet. Die bildliterarische Kunstform des Emblems barocker Klosterbibliotheken scheint gegenüber dieser Dichotomie widerständig zu sein. Geschaffen ist jedes einzelne als authentisches Unikat, obwohl es in der Regel nach einer Vorlage entstand und ihm gleichzeitig der Charakter des Instrumentalen eignet. Freilich gehören diese Embleme einer Zeit an, in der – wenigstens in der Rückschau – Absichtslosigkeit noch kein Kriterium von authentischer Kunst war. Es könnte jedoch auch sein, dass die zentrale Dichotomie der Bildunterscheidung nicht nur eine Sonde für moderne Zeiterscheinungen wie die Bilderflut ist, sondern zumindest seit der Möglichkeit zur Druckgrafik eine durchgängige Zäsur benennt. Walter Benjamin, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts beeindruckt durch die Bilderflut seiner Zeit, durch Film und Foto, zitiert in seinem Essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zu Beginn Paul Valéry: «Man muss sich darauf gefasst machen, dass so große Neuerungen die gesamte Technik der Künste verändern, dadurch die Invention selbst beeinflussen und schließlich vielleicht dazu gelangen werden, den Begriff der 245 Kunst selbst auf die zauberhafteste Art zu verändern».1 Es könnte sein, dass eine Relativierung der rigiden Abgrenzung von authentischer Kunst durch eine Kunstform, für die Absichtslosigkeit kein Kriterium der Authentizität war, auch Maßstäbe zur Wertung moderner Kunst in anderem Licht erscheinen lässt. Drei Schritte werden im Folgenden an das Objekt «Bibliotheksemblem» hinführen. Zunächst soll ein Überblick beispielhafter Funktionen der Kunst, wie ihn Franz von Kutschera vor einiger Zeit vorgetragen hat, als hilfreiche Einordnung der Emblematik genutzt werden.2 Eine der wesentlichen Funktionen der Kunst sei die Feier und Deutung des Lebens: Bildende Kunst und Musik geben Freude und Trauer Ausdruck, machen Jahreszeiten anschaulich und begleiten Lebensabschnitte von der Geburt bis zu unterschiedlichen Weisen des Sterbens. Eine zweite Funktion der Kunst ist die Erinnerung in Gemälden, Skulpturen oder Installationen wie das Mahnmal, das in Berlin an Gräuel der deutschen Geschichte erinnert. Kunst kann drittens unterhalten und viertens in der Konstruktion von Gegenwelten emotional gefangen nehmen. Letzteres gilt in gleicher Weise für Architektur unterschiedlicher Zeiten wie für Musiktheater oder Ballett. Die fünfte Funktion, die Vergegenwärtigung von politischen oder religiösen Ideen etwa in Schlössern, Kathedralen, Triumphbögen oder Aufmarschplätzen rührt in vielen Teilen an Werbung, und Propaganda, einer Funktion von Kunst, die für manche eben den Kunstcharakter in Frage stellt. Die Diskussion, welches Verständnis von Autonomie das Merkmal von Kunst determiniert, soll hier nicht weiter geführt werden. Nachvollziehbar ist jedenfalls die Position Franz von Kutscheras, dass mit der Verabsolutierung der Autonomie, d.h. der Reduktion der Kunst auf ihren ästhetischen Wert, diese für das allgemeine Leben bedeutungslos wird. Der Kunstform der Emblematik, von der hier zu verhandeln ist, kommt gleichsam eine gattungsübergreifende Funktion zu, deren Kern die Vermittlung von Wissen durch das Medium des intellektuellen Spiels der Mehrdeutigkeit und dem Ziel der Belehrung ist. Diese kognitive Funktion, die des Verstandes wie der Erfahrung bedarf, bekommt bei dem Emblem einer Klosterbiblio1 2 Benjamin (1963). Zum Folgenden: Kutschera (2002). 246 thek des 18. Jahrhunderts eben durch den Raum der Gelehrsamkeit und die den Klöstern widrigen Zeitumstände nochmals einen ganz eigenen Rang.3 Die Kunstform des Emblems, dies als ein zweiter Schritt der Hinführung, geht auf antike Vorbilder bis hin zur Hieroglyphik als vermeintlicher Geheimsprache zurück. Als Geburtsstunde der kanonisierten Form des Emblems gilt das von Jörg Breu illustrierte, in Augsburg 1531 erschienene und bis 1781 über 150mal neu aufgelegte Emblematum Liber des Mailänder Rechtsgelehrten und Humanisten Andreas Alciatus.4 Mit ihm wurden in Abgrenzung von Devisen oder Impresen die drei Elemente «Imago», «Inscriptio» und «Subscriptio» als kennzeichnende Merkmale des Emblems definiert.5 Die Subscriptio, also die Auslegung ist fester, ja zentraler Bestandteil der Bücher, die, wie z.B. Picinellis Mundus Symbolicus Emblemsammlungen enthalten oder auch von Emblembücher, die der religiösen Unterweisung oder zur politischen Erziehung von Fürstenkindern dienen sollten.6 Hier wird die Inscriptio, also das Motto, mehr zur Überschrift und das Bildmotiv zur anregenden Illustration.7 Anders ist dies bei der angewandten Emblematik, der die hier betrachteten Bibliotheksembleme zugehören.8 Motto und Imago stehen dabei in der Regel allein, während die auf den ersten Blick fehlende Interpretation die Gelegenheit bot, dem Besucher einer Bibliothek im Gespräch über die Raffinesse der Beziehung von Wort und Bild den Sinn des Raumes und Denkweisen eines Klosters näher zu bringen. Mit dem Emblem verbundene Begriffe wie das «offene Kunstwerk» oder der ihrer «zweiten Sprache» indizieren deren Funktion als Ausgangspunkt eines belehrenden Diskurses, in dem «der Mitteilungscharakter der Bilder Vorrang vor ihrer künstlerischen Ausführung»9 hat. 3 4 5 6 7 8 9 Zur Einführung: Lechner (1977), 8f. Hierzu das Kapitel Sinnbildkunst in Büchern der Frühen Neuzeit, in: Gier / Janota (1991), 281–284. Zum Entstehungszusammenhang: Buck (1971). Mühleisen (1982). Zur frühen Entwicklung der Emblematik verlässlich: Warncke (2005). Weitgehend unstrittig ist in der Forschung die Trias des Emblems. Dazu Zymner (2002), 12: «Die wichtigsten Unterschiede zeigen sich aber immer dort, wo es um die Art und Weise geht, in der die einzelnen Teile des Emblems miteinander zusammenhängen». Bannasch (2007), 27. 247 Entscheidend dabei ist, dass weder das Bild noch die Inscriptio allein den Sinn ausmachen und erkennen lassen, den der Inventor eines Emblems dem Betrachter vermitteln wollte. Erst im wechselseitigen Verweis, also in einem Bezug, der hinter den vordergründigen Ebenen von bildhafter Anschaulichkeit und wortgemäßem Verstehen liegt, entfaltet sich der Sinn, man könnte auch sagen die Qualität dieses Kunstwerks.10 In diese «Hintersinnigkeit» einzudringen, setzt freilich die Einbeziehung weiterer Kriterien oder Ebenen voraus. So können Sonne und Mond, Schiffe oder Muscheln je nach Ort, Kirche, Schloss11 oder eben Bibliothek, ebenso unterschiedlichen Sinn ergeben, wie z.B. das Thema der Freiheit in den zweieinhalb Jahrhunderten, in denen das Emblem in der Kunst fast allgegenwärtig war, mit ganz unterschiedlichen Wortverbindungen ins Bild gesetzt werden konnte. Um das an einem Beispiel zu konkretisieren: Die Darstellung einer Gartenanlage in der Imago eines Emblems kann an sich bereits ein qualitätvolles barockes Kunstwerk sein. Gerade Gartenbilder sind ein beliebtes Sujet der Barockzeit. Wenn jedoch als Inscriptio darüber steht Varietate placet, erhält es seinen eigentlichen Sinn als Aussage für eine Vielfalt, die den Menschen erfreut – und wenn dieses Emblem nun in einer Klosterbibliothek angebracht ist, wird es zum Ausweis der Vielfalt der hier versammelten Bücher und damit zum Argument gegen den Vorwurf der Aufklärer von der Einfältigkeit des «Mönchtums». Für das politische Emblem eines Rathauses oder Fürstensaales kann man ohne Frage den Begriff «Propaganda»12 verwenden, für den klösterlichen Schauraum der Bibliothek ist wenigstens der Ausdruck der Eigenwerbung nicht übertrieben. Wenn die «Glückseligkeit des Staates» im Verständnis aufgeklärter Philosophie13 von Bildung und Erziehung abhing, konnte man hier seine Offenheit für dieses Denken und seine Nützlichkeit für den Staat demonstrieren. Angesichts der unterschiedlichen Besucher einer Bibliothek, denen man die eigene Denkweise demonstrieren wollte, war das Emblem ein besonders geeignetes Medium, da es einerseits verständliche Belehrung für Gebildete und Unge10 Zu Verweiszusammenhängen vgl. Kemp (1981), 45. 11 Beispielhaft für die reiche Emblematik einer Kirche sei die ehemalige Augustiner-Chorherren-Kirche in Ranshofen, für ein Schloss, Eggenberg genannt. 12 Warncke (2005), 134–147. 13 Seibt (1771). 248 bildete war, man aber andererseits im Hinblick auf die «Qualität der Lehre» den gemeinten Sinn differenziert vortragen konnte.14 Freilich lässt sich schon die Vielfalt einer Bibliothek ihrerseits auf ganz unterschiedliche Weise in einem Emblem fassen, wie eine Pictura mit Musikinstrumenten und ähnlicher Überschrift zeigt.15 Bei Raum schmückenden Elementen kann man grundsätzlich davon ausgehen, «dass diese sich auf den Raum (seinen Sinn, seine Funktion, seine Tugenden), seine Benutzer (...) und/oder die in ihm versammelten Gegenstände (hier die Bücher und die durch sie vertretenen Wissenschaften) beziehen».16 Als Frage im Kontext unserer Tagung: Verliert ein Kunstwerk seine Authentizität, wenn es durch kontextuelle Einbindung zusätzlichen Sinn und Hintersinn erhält und schließlich als, modern gesprochen, Werbung oder Propaganda verwendet wird? Kann es nicht auch wechselseitige Inspiration werden, wenn der Künstler den Auftrag zu einem Gartenbild erhält, in dem insbesondere Vielfalt sichtbar werden soll, und andererseits ein Autor, der über Pluralität und Beziehung der Wissensbereiche schreibt, die systematische Anlage eines französischen Gartens vor Augen hat? Im 18. Jh. gehörte die Chance, die das Emblem auf zusätzliche Einsichten bot, zum enzyklopädischen Wissen: «Der Künstler stellt in einem Emblem dem Auge Dinge vor, die eigentlich demselben nicht vorgestellt werden können; er malt nicht sowohl für das Aug, als vielmehr für den Verstand».17 Man verwendete daher den Begriff einer Gemäl-poesy.18 Als Gegenstand der Imago konnte dabei alles Natürliche genommen werden, da es vom Schöpfer der Welt stammte und so in ihm grundsätzlich die Verweiskraft auf den Sinn der Schöpfung gesehen wurde. Damit waren zugleich Vieldeutigkeit und Rätselhaftigkeit inhärent. Bei der Inscriptio kam es darauf 14 Bannasch (2007), 243. Zu Übereinstimmung und Differenz in der Beziehung von Gegenstand und Bedeutung in der Geschichte des Emblems vom Humanismus zum Barock vgl. Scholz (2002), Kap. III, 4, 335–367. 15 Grundsätzlich zum Emblem als «offenem Kunstwerk»: Zymner (2002). 16 Wischermann (2000), 19. 17 Deutsche Encyklopädie (1783), 321. 18 Lucas Jennis als Verleger im Vorwort zu Cramer (1624), A IIII: «Emblemata, durch welche als mit einem redenden Gemählte / unter einer schlechten Figur / allerhandt verborgene Lehren vorgestellet werden». 249 an, dass sie sowohl den Bezug zum Gegenstand des Bildes als auch zu dem mit dem Bild gemeinten Sinn herstellte. Die Beziehung und damit auch das Verstehen konnte ganz unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben: War das Emblem zur politisch-moralischen Erziehung bestimmt, musste es möglichst eingängig sein. War es dagegen Teil eines intellektuellen Spiels, indizierte dies von vorneherein einen höheren Grad an Komplexität, um die Fähigkeit zu intermedialem Transferdenken, zum originellen Kombinieren, auf die Probe zu stellen. Das Emblem sollte einprägsam aber nicht eingängig sein. In jedem Fall war die Verweiskraft eines Emblems nie abgeschlossen. Während man die Frage, ob ein Bienenkorb «richtig» wiedergegeben sei19 und auch – trotz allem künstlerischem Geschmackswandel – die Frage nach der ästhetischen Qualität seiner Darstellung abschließend festschreiben kann, eignet der darüber hinaus gehenden Verweiskraft des Bienenkorbs insofern eine grundsätzliche Offenheit, als die mit ihm gemeinten Themen wie Fleiß, Ordnung, Nützlichkeit aber auch die Warnung vor Gewaltanwendung ihrerseits einem sich immer wieder ändernden gesellschaftlichen Diskurs unterliegen. II. Die Bibliotheken von Ottobeuren, St. Peter auf dem Schwarzwald und St. Peter in Salzburg Im dritten Schritt werden drei Klosterbibliotheken entsprechend der Programmausführung in chronologischer Reihung vorgestellt, in deren Gesamt­ ikonographie die unten zu vergleichenden Embleme zwar eher marginal erscheinen, und dennoch zu einem Schlüssel des Verständnisses für diesen Raumtypus allgemein wie für die einzelne Bibliothek im Kontext der jeweiligen Abtei werden können. Die großen Stifte des 18. Jahrhunderts stehen in der Folge einer weltlich-imperialen Architektur und stellen «gesellschaftsgeschichtlich gesehen, die Verbindung zwischen einer geistlichen Institution mit Kirche im alten Stil und einer weltlichen Herrschaft» dar.20 Seit 1700 wird dem «Kloster-Kirchengebäude» in den Formen des Kaisersaales und 19 Anregend dazu: Boehm (2001). 20 Hierzu: Sedlmayer (1938), 139. 250 des repräsentativen Stiegenhauses quasi ein Fürstenschloss einverleibt. Mit dem Schloss wächst in den «Stiften noch eine dritte Sphäre, die zwischen der kirchlichen und kaiserlichen Sphäre vermittelt»: die Sphäre der Bildung, der Künste und Wissenschaften. Sie findet ihren baulichen Ausdruck in der Bibliothek, die zu jedem vollständigen Stift des neuen Typus gehört.21 Die Äbte, die die Bauten vorantrieben, waren mit den Machtspielen der Adelsgesellschaft ebenso vertraut, wie sie das Medium politischer Ikonographie zu nutzen wussten. Diente der Kaisersaal als Ort repräsentativer Hofhaltung, so war die Bibliothek der Schauraum, mit dem man der gelehrten wie der höfischen Welt Anschauungen und Standpunkte des Klosters demonstrieren konnte. Zum Verständnis solcher Bildprogramme sind neben den klassischen Mitteln der Interpretation wie Stil und Inhalt auch der jeweils intendierte Adressat und der ideengeschichtliche Moment wichtige Zugänge. Diese Bibliotheken, oft der Stolz äbtlicher Bauherren, waren in der Regel ohne Heizung, also keine Arbeitsräume, sondern vielmehr der Ort, an dem sich das Kloster als wissenschaftlich aufgeschlossene Institution zeigen konnte. Als Hintergrund zum Verständnis der Ikonographie muss man zwei Dinge auf jeden Fall im Blick behalten: zum einen sind diese Bildprogramme in der Hochzeit der Aufklärung entstanden, die das «Mönchtum» quasi zum Lieblingsfeind erkoren hatte, so dass man die Texte eines Montesquieu, Voltaire oder Rousseau als Folie mitdenken muss. Zum anderen war es wie zur Zeit des Humanismus auch in der Epoche der Aufklärung in den Klöstern selbst höchst umstritten, ob und wie viel Wissenschaft dem Klosterleben bekömmlich wäre. Während die einen etwa in der Tradition eines Trithemius Gebet und Wissenschaft für das Klosterleben als gleich wichtig ansahen, meinten andere, dass ein Studium den jungen Mönch für ein Klosterleben ungeeignet werden ließe. Die Bibliothek als «Seelenapotheke» anzusehen, wie es über deren Tür in St. Gallen steht, war sicher keine gemeinsame Überzeugung. Das älteste der im Folgenden behandelten Bildprogramme ist das vor 1720 fertig gestellte der Bibliothek in der Allgäuer Benediktinerabtei Otto­ 21 Zur Bedeutung des Emblems im Kontext des Verständnisses von Bildung, insbesondere auch zur aufklärerischen und demokratisierenden Dimension des Emblems: Bannasch (2007). 251 beuren.22 Sie gehört zum verbreiteten Typus der Saalbibliothek mit umlaufender Empore. Die für Süddeutschland noch dem früheren Barock zuzuordnende Bauzeit zeigt sich in der grundsätzlich rechteckigen, durch die geschwungene Galerie nur überspielten Grundform sowie in der auf einzelne Felder begrenzten Deckenmalerei. Das dementsprechend auf drei größere Flächen verteilte und einseitig zu lesende Bildprogramm der Decke beginnt im Hauptbild mit einem Lamm Gottes als Sitz göttlicher Weisheit, neben und unter dem in elf weiblichen Allegorien die von ihr inspirierten Künste und Wissenschaften zu finden sind. Im unteren Teil des Bildes begegnet man der Gegenseite, den erfolgreich bekämpften Irrlehrern und einem hlg. Benedikt, der ein heidnisches Apolloheiligtum durch eines ersetzen konnte, das Johannes dem Täufer gewidmet ist. In St. Peter wird dieses kämpferische Thema später Teil des die Mönche belehrenden Benediktszyklus, aber nicht mehr Darstellung der Bibliothek sein. In den beiden ovalen Bildern seitlich davon sind auf der einen Seite Verteidiger der Dreifaltigkeit, auf der anderen Verehrer Mariens zusammengeführt. An der östlichen Schmalseite befindet sich eine Inschrift des Bauherren und vermutlich auch Erfinder des Bildprogramms, Abt Ruppert, die ein Schlüssel zum Verständnis des Raumes sein kann: Musis Palatium, Religioni Monimentum, Sui Monumentum. Bemerkenswert ist, dass die Bibliothek an erster Stelle ein Palast der Musen, erst dann ein Bollwerk der Religion und schließlich Erinnerung an den Bauherren sein soll. Vorsichtig interpretiert deutet sich hier, wie in dem Emblem mit Musikinstrumenten, im Sinne der Aufklärung eine Öffnung zur Vielfalt von Wissenschaft und Kunst an, die auch in dem in Ottobeuren kurz danach erbauten Theatersaal ihren Ausdruck findet.23 Dennoch bleibt es ein gegenüber Irrlehren kämpferisches Programm, wie man es ähnlich in der fast zeitgleichen Bibliothek von Metten findet. Dort erhält der hlg. Hieronymus (nach der Legenda Aurea) eine Strafe, weil er ein Ciceronianus und kein Christianus sei und dem hlg. Odo wird als Bild für seine Vergillektüre ein Becher mit giftigem Gewürm gezeigt. Mit beiden Bildern wird somit nicht nur nachdrücklich vor dem Studium der Profan22 Wischermann (2000). 23 Auf die Sichtbarmachung der bleibenden Spannung zwischen weltlichem und göttlichem Wissen hat Warncke (1992) auch für zeitgenössische Darstellungen der Bibliotheken verwiesen. 252 wissenschaften gewarnt, sondern mit der Wahl gerade dieser Heiligen auch die Chance zur Überwindung der von weltlichem Wissen ausgehenden Gefahren angezeigt.24 «Damit wird in dem Programm der Bibliothek zu Metten dem frühaufklärerischen Gedankengut des 18. Jh. eine strikte Absage erteilt».25 Die Bibliothek der vormaligen Abtei St. Peter auf dem Schwarzwald,26 oberhalb der Küche27 idealtypisch zwischen Kirche und Fürstensaal gelegen, ist kunstgeschichtlich ein Sonderfall, da sie nicht als Ausdruck geistiger und politischer Strömungen in einem Zug gebaut und ausgestattet wurde. Vielmehr war sie während der Entstehung über ein Jahrzehnt lang eine Bauruine und, folgt man den Archivalien, dem Umbau in Gastzimmer oft näher als ihrer Vollendung in der heutigen Form als «schönstem Rokokoraum des Breisgaus». Nachdem trotz aller Widrigkeiten die Weihe der Kirche nach erstaunlich kurzer Bauzeit im September 1727 erfolgt war, brachte Abt Bürgi im November 1728 den Vorschlag für umfangreiche Bauvorhaben in das Kapitel ein, wozu nach einem Plan von Peter Thumb auch die Bibliothek gehören sollte. Doch erst ein Jahrzehnt später konnte der Abt unter Zustimmung des Konvents den Vertrag mit ihm abschließen. Beim Tod Bürgis im Juli 1739 war erst der Rohbau der Bibliothek, also die Außenmauern «ohne Fenster und Türen», geschützt von einem vorläufigen Dach, fertig gestellt. Unter seinem Nachfolger blieb dies eine Bauruine. Als dieser nach zehn Jahren starb, hatte sich der Wind gedreht. Andere Klöster wie Wiblingen hatten ihre Bibliotheken fertig gestellt und nach dem Amtsantritt von Maria Theresia waren aus Wien die Signale deutlicher geworden, dass auf Dauer wohl nur die Klöster, die im Sinne der Aufklärung nützlich und offen für neues Denken wären, fortexistieren könnten – und eben Letzteres zu demonstrieren, war der Sinn einer Bibliothek als Schauraum.28 24 25 26 27 Wrangel (1983), 61. Friedrich (1995), 43. Mühleisen / Wischermann (1980), 69f.; Mühleisen (2011), 58–61. Bei der Reise durch süddeutsche Barockbibliotheken hört man, dass diese Position an das Übereinander von Bauch und Kopf erinnern solle. 28 Ganz dezidiert vertritt diese Position für das Admonter Bildprogramm: Mannewitz (1992). Sein Argument, dass in Admont mit Aurora und Apoll neben der christlichen Weisheit die Fülle des Wissens in der Antike verkörpert sei, lässt sich insofern auf St. Peter übertragen, als sich hier die Antike in dem mit dem Bibliotheksaal korrespondierenden, wenig entfernten Gartensaal von Schloss Ebnet findet. Vgl. Mühleisen (2003). 253 Die Wahl eines dementsprechenden Abtes war quasi zur Überlebensfrage geworden. Der 1749 – völlig ungewöhnlich – einstimmig im ersten Wahlgang gewählte Abt Steyrer holte Peter Thumb zurück, der nun zeitgleich mit der Birnau am Bodensee den rechteckigen Rohbau der Bibliothek mit einer geschwungenen Galerie als authentischen Rokokoraum vollendete. Das ikonographische Programm der Bibliothek, das trotz mehrfacher Bearbeitung der letzten Jahrzehnte in Details geheimnisvoll bleibt, ist in seiner Grundidee und in vielen Teilaspekten in einer durch die Aufklärung dem Mönchtum Abb. 1 254 gegenüber kritischen bis feindlichen Umwelt eine geniale Demonstration klösterlichen Selbstverständnisses. Der Ausgangsgedanke des Bildprogramms ist überliefert: «Der Vater der Lichter und der heilige Geist», als Quelle göttlicher Weisheit. Von dort werden «den Verfassern des Alten und Neuen Testamentes wie auch den Vätern der Kirche ihre Bücher» eingegeben. Im Gang durch die Zeit, hier durch den Raum, wird die Weisheit weitergegeben, bis sie sich in der untersten Reihe auch bei den hier porträtierten Bauherren der Bibliothek, sowie Reformäbten unterschiedlicher Zeiten und eben in den zwischen ihnen positionierten Emblemen wiederfindet. Eine zweite Idee bestimmt dieses Programm ebenso konsequent. Der Grundgedanke der Aufklärung, dass man sich, um zur Fülle des Wissens zu kommen, neuen Methoden und Wissensfeldern öffnen müsse, führt ebenso von oben nach unten durch dieses Programm und findet den intellektuell anregendsten Ausdruck in den acht Emblemen. In deren Mehrdeutigkeit wird ihre alte Funktion der Vermittlung göttlicher Weisheit mit der Chance zur Präsentation modernen Denkens genial verknüpft.29 Dass der Aufklärung ein anderer Stellenwert zukommt, wird vor allem daran deutlich, dass im st. petrischen Programm keine Feinde vorkommen, die bekämpft werden müssen oder, wie kurz danach wieder in Schussenried, auf dem Weg in die Hölle sind. Die baugeschichtlich älteste der hier einbezogenen Bibliotheken ist die 1706/1707 neu gestaltete, aber erst um 1770 als letzte mit einem Bildprogramm ausgestattete der Erzabtei St. Peter in Salzburg (Abb. 1).30 Ihre Besonderheit liegt darin, dass sie nicht als Gesamtkonzept neu gebaut wurde, sondern im Umbau vormaliger Noviziatsräume als Zellenbibliothek von sieben aufeinander folgenden Zimmern entstand. Dem entspricht die Einteilung der Wissensgebiete in I. Manuskripte und Libri Prohibiti, II. Philologie und Grammatik, III. Philosophie, IV. Historia, V. Jurisprudenz, VI. Theologie, VII. hlg. Schrift und Vätertexte. Ausgerechnet im ersten, einzig heizbaren Raum waren Arbeitsplätze eingerichtet, wobei die verbotenen Bücher vormals mit durchsichtigen Drahtgittern verschlossen waren. Die Themen der 29 Bannasch (2007) hat für die Entwicklung des Emblems bis hin zur Verwendung als Illustration herausgestellt, dass sich in den Gegenständen der Pictura immer, wenn auch verschieden, göttliches Wissen wiederfinden lässt. 30 Hierzu die beste Literatur: Hahnl (1977). 255 Deckenbilder, damals «Oberbodenbilder» genannt, entsprachen den jeweiligen Wissensgebieten. Der Raum der verbotenen Bücher zeigt im Deckenbild die Allegorie der über den Drachen des Unglaubens triumphierenden Kirche, die Furien der Zwietracht und einige von der Hölle verschlungene Irrlehrer. Im Raum der Philologie findet man an der Decke die Allegorie der alles Wissen umfassenden Universitas, wo neben Vertretern der Antike sowie Instrumenten von Geographie und Astronomie auch Symbole von Musik und bildender Kunst für ein umfassendes Wissen stehen. Auf dem Bild im Raum der Philosophie steht eine bekrönte Frau vor einem auf einem Thron sitzenden Mann, nach bisheriger Interpretation die hlg. Katharina, die vor dem Kaiser die heidnischen Philosophen besiegt, angesichts des Patronats Katharinas für die Philosophie eine gut nachvollziehbare Deutung. Aus der Bildkomposition lässt sich jedoch auch schließen, dass die Frau mit dem Mann auf dem Thron und nicht mit den Gelehrten um sie herum im Gespräch ist. Dann könnte es sich bei dieser Darstellung eher um die Prüfung König Salomons31 durch die Königin von Saba handeln, ein Ereignis, in dem die Aufklärung den frühesten Nachweis sah, dass es neben der von Gott gegebenen Weisheit der Propheten eine ebenso qualitätvolle Weisheit der Welt, der autonomen «Selbstdenker» gebe. In einigen anderen Programmen (St. Peter, Schussenried, Ochsenhausen, Admont) taucht eben dieses Thema auf und die zwei Schlüssel als Attribut der Philosophie weisen darauf hin, dass mit ihr die Weisheit von Himmel und Erde eröffnet wird. Dieser, der Aufklärung näher kommenden Interpretation wird für Salzburg auch deswegen der Vorzug gegeben, weil hier z.B. auch die Lektüre Ciceros positiv gesehen wird, die in konservativen Programmen wie in Metten als schädlich dargestellt wird. Im Raum der Geschichte verwehrt Ambrosius als Bischof von Mailand Kaiser Theodosius I, wegen dessen Blutbad von Thessaloniki den Zugang zur Kathedrale. Im Deckenbild der Jurisprudenz findet man den hlg. Ivo, einen Juristen, der sich für das Recht der Armen eingesetzt hat, und im Raum der Theologie die Kirchenlehrer Hieronymus, Augustinus, Thomas von Aquin und den Gelehrten Beda Venerabilis. Im Raum der hlg. Schrift 31 Zur zentralen Funktion König Salomons in einer Bibliotheksemblematik vgl. Lesky (1970), 83f. und Abb. 36. 256 legt der zwölfjährige Jesus im Tempel von Jerusalem den Schriftgelehrten das Erste Testament aus. Diesen sieben Themenbildern sind nun jeweils Embleme zur Seite gestellt, von denen einige vergleichend in den Blick kommen sollen. In einem kursorischen Vergleich der drei Gesamtprogramme wird man im Laufe eines halben Jahrhunderts durchaus eine Öffnung gegenüber der Vielfalt der Wissenschaften und Künste und zumindest auch in Ansätzen gegenüber einer aufgeklärten Toleranz feststellen können. Dass dies nicht eine einfache Entwicklung ist, zeigt sich etwa in dem Programm von Schussenried, wo das Judentum wieder unter die Ketzer eingereiht ist, während es fünf Jahre zuvor im st. petrischen Programm als positives Attribut der Geschichte erscheint.32 III. Muscheln, Bienenkorb, Granatäpfel, Brunnen und Mond (Abb. 2) Mit dem Vergleich solcher Embleme, die jeweils in mindestens zwei der drei ausgewählten Bibliotheken vorkommen, sollen nun unterschiedliche Formen der kognitiven Funktion deutlich gemacht werden. Mit wenigen Hinweisen auf mögliche Vorlagen kann die genaue Quelle nicht im Einzelnen nachgewiesen werden. Eine kursorische Durchsicht der über 2.000 Embleme in dem 1702 von dem Jesuiten Boschius herausgegebenen Band ergab, dass sich darin alle hier behandelten Bildgegenstände, einige, z.T. wenig veränderte Lemmata und schließlich auch komplette Embleme nachweisen lassen.33 Sicher ist, dass die Erfinder der Bildprogramme in ihren Bibliotheken unter den Hunderten von Emblembüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts einschlägige Literatur fanden.34 32 Für Admont hat Mannewitz (1989) das Konzept eines aufklärerischen Bildprogramms überzeugend dargelegt: «Es war der ‹programmatische› Versuch, den Ansichten der Aufklärung und des Staates entgegenzukommen und dem scheinbaren Widerspruch zwischen Vernunft und Glaube im Vorfeld entgenzutreten» (ebd., 254). 33 Boschius (1702). 34 Nachgewiesen für St. Peter von Wischermann (1977), 121. Hinweis auf Emblemliteratur in: Lechner (1977), 3. Die Frage, ob die Inventoren der jeweiligen Bibliotheksemblematik sich vornehmlich an Emblembüchern eigener Ordensmitglieder (vgl. ebd., 7) orientierten, muss offen bleiben. 257 Ein Motiv, das sich in allen drei Bibliotheken, z.T. mehrfach findet, ist die Perlmuschel. Gerade dieser Gegenstand hat in der Emblematik ein breites Bedeutungsspektrum von der List einer Muschel, die Fische fängt oder den Schnabel der Möwe hält, die sie aussaugen will, bis zur Empfängnis göttlicher Gnade, wenn der Strahl der Morgensonne auf sie trifft. In Ottobeuren ist die Muschel an der Decke in zwei Emblemen nebeneinander präsent: Im ersten ist sie nur soweit geöffnet, dass man das göttliche Geschenk der Perle sehen, aber nicht entnehmen kann, im andern Bild sieht man die Perlen als Erfolg menschlicher Arbeit in den offenen Muscheln. Die Idee, dass die von Gott gegebene Weisheit der Arbeit des Menschen bedarf, um für ihn fruchtbar zu werden, lässt sich schon in der antiken Mythologie finden und ist ein Thema eben gerade der Bibliotheken der Aufklärungszeit. Im Emblem unter der Empore der Ottobeurer Bibliothek liegt die geschlossene Muschel am Rand des Meeres, über dem auf einem Hügel eine Kapelle steht. Das Schiff im Hintergrund ist wohl eher schmückendes Beiwerk, wenngleich gerade das Segelschiff häufig ein emblematisches Motiv ist. Die Inscriptio besagt Latet intus – Innen bleibt es verborgen, das Innere bleibt ein Geheimnis. Nimmt man als Vorbild das Motto bei Boschius Latent res eximiae, d.h. dass die außergewöhnlichen Dinge verborgen bleiben, so wird man dieses Emblem durchaus vieldeutig als Hinweis auf Grenzen wissenschaftlichen Arbeitens verstehen können. Das Geheimnis des Innenraums könnte auch auf die darüber sichtbare Kapelle anspielen. Die Muscheln in St. Peter liegen dagegen in einem prächtigen Barockraum auf einem Tisch und das Motto Pretiosa latent, das auf die umhüllten Kostbarkeiten verweist, scheint, wenn man mit ihnen die Bücher assoziiert, geradezu als Einladung, sich an deren Enthüllung zu wagen. Wenn man die acht st. petrischen Embleme insgesamt als Lob dieser Bibliothek deutet, wird hier die Humilitas oder Modestia angesprochen, die Zurückhaltung des kostbaren Raumes im Gesamt des prächtigen barocken Klosterbaus. Und in der Tat, geht man über den oberen Gang der Klausur, so lässt die im Vergleich mit anderen Klöstern unscheinbare Tür den dahinter verborgenen Schatz nicht ahnen. Die Muscheln können jedoch auch hier unmittelbar auf die Bücher und die in ihnen verborgenen Kostbarkeiten verweisen, was sie der Hochschätzung der Buchweisheit durch die Aufklärung näher brächte. 258 Abb. 2 259 In Salzburg findet man die im Meer liegende Perle im Raum der hlg. Schrift und der Kirchenväter. Das ganz ähnliche Motto Intus Pretiosa recondit, wird sich, folgt man Alfred Hahnl,35 auf die in diesem Raum versammelten Bücher der hlg. Schrift beziehen: «Nur wer sie öffnet, wird den Schatz gewinnen, der darin verborgen ist». Nimmt man die Sonnenembleme auf der Gegenseite hinzu, gewinnt man eine Verbindung von Sonnenaufgang als Hervorkommen göttlicher Gnade zu der von ihr beschienenen Kostbarkeit der hlg Schrift in der Muschel. Schon der Vergleich des an sich einfachen Muschelmotivs dazu noch mit ganz ähnlichen Inschriften, in den drei Räumen, macht die Raffinesse der emblematischen Vieldeutigkeit sichtbar. Nicht Details der Pictura, sondern der Ort im Raum und das Gesamtkonzept einer Emblematik führen zu einem angemessenen Verständnis, das jedoch immer wieder neu zu diskutieren ist. In zwei Bibliotheken, in Ottobeuren und St. Peter, findet man jeweils einen Bienenkorb auf einem tischähnlichen Gestell. Biene und Bienenkorb gehören sicher zu den vielfältigst verwendeten Bildmotiven.36 Das reicht von der Warnung, dass wenn man anderen Übles zufügt, man selbst darunter am meisten leidet – Bienen sterben bekanntlich nach dem Stechen – über die Warnung, dass beim Gewinn des Honigs wegen der Gefahr gestochen zu werden, Süßes mit Bitterem vermischt sei – Dulcia Mixta Malis, – bis zur politischen Verwendung als Mahnung an den Fürsten, dass man die mittleren Ratschläge fliehen soll (Abb. 3) – wenn man an den Honig will, ist falsche Milde unangebracht: Man muss den Korb schon ganz eintauchen, sonst wehren sich die Bienen in einer Weise, dass man nicht nur nicht an den Honig kommt, sondern auch noch gestochen wird.37 In der Bibliothek von Ottobeuren wird mit diesem Motiv der sprichwörtliche Bienenfleiß angemahnt: Hinc procul ignavi – hier ist man von Faulheit weit entfernt.38 Mit diesem recht einfachen, an Volksweisheit orientierten Emblem wird sowohl 35 Hahnl (1977), 34. 36 Schon in einem der ältesten Embleme mit einem Bienenkorb wird dieser zum Bild wechselseitigen Nutzens: Camerarius (2009), 312f. und 570–572. 37 Mühleisen (1982), 39–41. 38 Möglicherweise sind die Inskriptionen in Ottobeuren entstanden in Anlehnung an: Boschius (1702). 260 Abb. 3 der Raum als Ort des Fleißes wie auch dessen Nutzer dazu gemahnt und dafür gelobt. Das Vorbild bei Boschius enthält eine ähnliche Mahnung: Discedite Segnes – Geht weg vom Trägen. In der Bibliothek von St. Peter, wo neben dem Bienenkorb eine Landschaft zu sehen ist, deutet die Inscriptio eine ganz andere Richtung des Verstehens an: Distendunt Nectare Cellas – Prall füllen sie die Vorratskammern mit Honig.39 Dieses aus der Georgica von Vergil 39 Für die Beschreibung der Embleme von St. Peter: Wischermann (1977). 261 stammende Motto bezieht sich also nicht auf die Benutzer, sondern bringt in der Verbindung mit der Pictura eine Tugend dieses Raumes zur Anschauung: Wie die Bienen den Honig in Waben sammeln, so trägt das Kloster die Bücher in den Regalen zusammen, nicht für sich selbst, sondern für alle, die das zu nutzen wissen. In der Verbindung von Motto und Bild wird somit einer der Hauptvorwürfe der Aufklärer, die Selbstsucht des Mönchtums, zurückgewiesen und die eigene Uneigennützigkeit herausgestellt. Ein auf den ersten Blick schwieriger zu verstehender Gegenstand ist der in St. Peter und in Salzburg zu findende Granatapfel. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts als emblematisches Motiv bekannt, bezieht sich die mit ihm intendierte Aussage traditionell auf seinen eigenartigen doppelten Geschmack. So kann er zum grundsätzlichen Bild menschlichen Lebens werden: «Es gibt für das menschliche Leben keine reine Freude, es mischt sich bald irgendein Schmerz hinein». In der Bibliothek von St. Peter liegen mehrere geöffnete Granatäpfel auf einem Tisch wiederum in einem prächtigen Barockraum. Das fast wörtlich aus Picinellis Mundus Symbolicus übernommene Motto Nulli Sua Munera Claudunt will sagen, dass, der Granatapfel niemandem seine Gaben vorenthält, die nach der Auffassung der Zeit süß und bitter waren. Mit diesem Emblem sind gleich zwei Vorwürfe der Aufklärer widerlegt und zugleich Versprechen abgegeben, das eine, dass hier nicht nur die apologetische, sondern eben auch die bittere Literatur gesammelt wird und dass diese Büchersammlung im Sinne einer Liberalitas für niemanden verschlossen bleiben soll. In Salzburg befindet sich der einzelne, ebenfalls offene Granatapfel im Raum der Philosophie (Abb. 4). Die dazu gehörende Inscriptio Vulneribus Profundit Opes – Durch die Wunden lässt er die Schätze hervorströmen, ist nach der bisherigen Deutung ein Hinweis auf Christus, in dem nach dem Kolosserbrief alle Schätze der Welt verborgen sind. Nimmt man freilich das Deckenbild mit der Königin von Saba als Verweis auf den Wert auch der weltlichen Philosophie und erinnert man sich an die Allegorie der Philosophie mit den zwei Pfeilen, so könnte sich hier andeuten, dass das Eindringen auch in die weltliche Philosophie der Aufklärung zwar Wunden schafft, zugleich aber neue Schätze eröffnet. Nimmt man dazu noch in den Blick, dass in diesem Raum der kurz zuvor verstorbene Aufklärer Christan Wolff positiv dargestellt ist, wird man der Ikonographie in diesem Raum 262 vielleicht eine andere, etwas irdischere und aufgeklärtere Richtung als bislang geben können. Dies wird auch unterstrichen, wenn man die Salzburger Brunnenembleme zu verstehen sucht. Wiederum ist der Brunnen ein Motiv, das seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zum Standardrepertoire der Emblematik gehört. Auch dieses Bild konnte in seiner Geschichte ganz unterschiedliche Bedeutungen verkörpern, vom «Heylbrunnen»,40 von dem Glück und Gesundheit ausgehen, oder der Stärkung der Begabung durch immer wieder neues Schöpfen aus dieser Quelle bis zum Motiv für die Dummheit, wenn einer einen neuen Brunnen gräbt und nicht darauf achtet, dass es daneben schon längst einen gibt – ein Motiv, mit dem man in einer Bibliothek sicher auch manche wissenschaftliche Arbeit anschaulich machen könnte. Während der Brunnen in Kirchen ein Mariensymbol (Bsp. Oberthingau) ist, kann er wie in der Emblematik der Kirche hlg. Geist in Neuburg a.D. selbst zum Bild für den Heiligen Geist als Quelle der sieben Gaben werden.41 Die dafür gewählte, der st. petrischen ähnlichen Inscriptio FONS OMNIBUS UNUS – eine Quelle für alle, könnte ebenso als Motto des Brunnenemblems einer Bibliothek stehen – nur bekommt es dort durch den räumlichen Kontext und den spezifischen Adressatenkreis eine andere Bedeutung. In einem der ältesten Embleme mit einem Ziehbrunnen wird dieser mit dem Motto motu clarior (durch Bewegung reiner) «als Sinnbild für die Notwendigkeit gedeutet, den Geist durch ständige Übung zu schulen»,42 um ihn klar wie das Wasser zu halten. Abb. 4 40 Cramer (1624), Pars II, Emblem XI. 41 Warncke (2005), 131–133. 42 Camerarius (2009), 26f. sowie 425f. 263 Abb. 5 Der Springbrunnen von Salzburg im Raum der Philosophie steht in einem Formalgarten, darüber das Motto Erigor et Mundor – Ich werde aufgerichtet und gereinigt (Abb. 5). Könnte es nicht sein, dass man statt an den sündigen, von Christus aufgerichteten Menschen in diesem Brunnen ein Bild der neuen Philosophie sehen kann, die von dem gegenüber dargestellten Philosophen aufgerichtet und im Wortsinn entschuldigt wurde? Und, könnte es nicht sein, dass gerade in Salzburg, wo die Universität der Benediktiner auch mit Naturwissenschaften für ein modernes Denken stand, dieser Brunnen für den Typus einer «katholischen Aufklärung» steht: aufgerichtet, gereinigt und als Leben spendende Quelle für einen Garten nach französischem Vorbild, also dem Land, wo die Aufklärung am weitesten fortgeschritten war? Auch das zweite Brunnenemblem von Salzburg, im Raum der Geschichte ist einer wissenschaftlich-weltlichen Deutung zugänglich. Wenn mit dem Mot264 to Refert Quo Fonte Bibatur zwar die Warnung vor falscher Lektüre verbunden sein kann, so lässt sich doch nicht in Abrede stellen, dass dies auch eine Aufforderung sein kann, sich auch in der Geschichte der richtigen Quellen zu bedienen, also der schon aus dem Humanismus herrührenden Option zu folgen. Gegenüber diesen sicher mehrdeutigen in Salzburg ist das zwanzig Jahre früher konzipierte st. petrische Brunnenemblem im Kontext der bisherigen Argumentation eher leicht zu entschlüsseln (Abb. 6). Hier steht der Springbrunnen, der aus mehreren Röhren Wasser gibt, vor dem Barockbau und das Motto Se Se Sitientibus Offert ist eine klare Einladung, dass diese Bibliothek für jeden Wissensdurstigen ebenso offen steht, wie der Brunnen vor dem barocken Schlosskloster, der in der Realität kurz zuvor aufgestellt worden war. Das Emblem, das in der Tradition von Picinelli für die Hospitalitas, die Gastfreundschaft steht, weist ebenso eindeutig den Vorwurf der Aufklärer zurück, dass die Klöster nur für sich sorgten und handelten. Abb. 6 265 Ein letztes Motiv, das unter allen drei Bibliotheken eine vergleichende Deutung zulässt, ist der Vollmond, der in seinen Deutungsmöglichkeiten quasi natürlich vom religiösen Symbol über die Liebe bis zur Politik reicht. Der Inventor von Ottobeuren hat das Motto Acceptum Communicat Orbi wörtlich aus dem Emblembuch von J. W. Zincgreff (1501) übernommen, wo das von der Sonne an den Mond gegebene und von diesem der Erde vermittelte Licht als Weitergabe der Gnade durch Christus gedeutet wird. Dies wird so auch für das frühe Programm in Ottobeuren zu übernehmen sein. Man könnte dies als Variante auch als die göttliche Weisheit (Sonne) deuten, die über das Buch der Welt (Mond) vermittelt wird. In St. Peter wird aus dem Vollmond mit dem Motto Plena Sibi Ac Aliis, wiederum eine Aussage über die Bibliothek – bei Boschius ist dies ein Emblem für die Jungfrau Maria. Wenn der Mond für sich selbst voll ist, behält er das Licht nicht für sich, sondern gibt es an die Welt ab – ebenso ist es mit der Bibliothek, die das Licht der Weisheit, das in ihren Büchern steckt, an die anderen weiter gibt. Bedenkt man, dass das Grundthema dieses Raumes das Licht der Weisheit ist, in der göttliche Sapientia und Licht der Aufklärung zusammen kommen, ist diese Idee hier nochmals ganz subtil aufgenommen: die Fülle des Lichts schließt keine Bereiche aus. Der Mond in Salzburg leuchtet im Raum der Handschriften und der verbotenen Bücher mit der Inschrift: In Tenebris Lucet und wird damit als leuchtendes Gegenbild gegen die häretischen Schriften gedeutet (Abb. 7). Doch so ganz klar wird nicht, wer hier wem in der Dunkelheit leuchtet, zumal im gegenüberliegenden Emblem ein Morgenstern den neuen Tag ankündigt. Gerade wenn für die Texte Vorlagen in Dies Irae gefunden werden, könnte es nicht auch sein, dass diese beiden Embleme, der Mond und der Morgenstern, so etwas wie Gegenbilder sind und in der Dunkelheit der verbotenen Bücher zu Vorboten einer neuen, helleren Zeit werden? Embleme sollen schließlich verbergen und entbergen. «Die eigentliche Aussage des Emblems (...) bleibe immer dem Adressaten überlassen. Mit seiner Eigenleistung sei er geradezu am Emblem beteiligt, und selbstverständlich sei der Witz der Sache umso größer, je mehr Geist vom Adressaten gefordert werde».43 43 Zymner (2002), 21. 266 Abb. 7 Als ein Ergebnis dieses Vergleichs kann man auf jeden Fall festhalten, dass nicht nur Inscriptio und Pictura einen Zugang zur Deutung eines Emblems geben, sondern dass der Kontext des jeweiligen Raumes und hier insbesondere dessen generelles ikonographisches Thema unterschiedliche Zugänge der Interpretation eröffnen. Auf diese Weise lassen sich über dieses Medium Rückschlüsse nicht nur auf Denkweisen des jeweiligen Klosters, sondern in größerem Rahmen auch Entwicklungsverläufe übergreifender Denkströmungen aufspüren.44 In einer Bibliothek ist alles enthalten, wie ein Emblem im ersten Raum in Salzburg erzählt, man kann sich in ihr auf eine Entdeckungsreise begeben. In einem Emblem des letzten Raumes ist ein Mönch dargestellt, der eben dies getan und sich durch die Lektüre verändert hat (Abb. 8). Wenn auf seinem Schreibtisch ein Globus mit astronomischem Gerät steht, scheint das ein typisch emblematischer Hinweis zu sein, dass man auch dieses Programm aufgeklärter interpretieren kann, als es auf den ersten Blick erscheint. 44 Gregor Lechner OSB machte darauf aufmerksam, dass die Bildprogramme der Bibliotheken gerade durch Konstanz und Differenz zur sensiblen Sonde für den Gang von Denkweisen werden. Siehe Lechner (1996). 267 Abb. 8 Auch wenn die Kunst des Emblems in der hier vorgestellten Form eine Zeiterscheinung vor allem des 16. bis 18. Jahrhunderts war, so können dennoch die mit ihr aufgeworfenen Fragen auch dem aktuellen Diskurs über Originalität, Authentizität oder Funktionalität von Kunstwerken Impulse geben. Wenn der Mond hier kein Mond ist, sondern für eine Bibliothek steht, bieten sich Vergleiche mit der Moderne, etwa Joseph Beuys an. Die Installation der «Schlitten», die offenkundig den Kombi fluchtartig verlassen – er nannte sie Mäuse – lässt unmittelbare Assoziationen zu einem Emblem über Guillaume de la Perrière aus dem Jahr 1553 über den Schmeichler zu, mit dem zusammen die Ratten das einstürzende Haus verlassen. Man sagte über die Kunstwerke von Beuys, dass sie zum Denken verführen und letztlich immer auch ein Beitrag zum Gesellschaftsdiskurs sein wollten. Eben das wollten auch die 268 Embleme barocker Klosterbibliotheken sein, Rätsel und Argument. Die hier angedeutete Möglichkeit, ein Emblem unterschiedlich verstehen zu können, kann nicht nur zu einer differenzierteren Auseinandersetzung mit der Aufklärung anregen, sondern lässt es in «seiner Entwicklung von allegorischen zu concettistisch-spielerischen Deutungsmodi»45 geradewegs zum modernen Kunstwerk werden.46 Literatur Bannasch, Bettina. Zwischen Jakobsleiter und Eselsbrücke, Das ‹bildende Bild› im Emblem- und Kinderbilderbuch des 17. und 18. Jahrhunderts, Göttingen 2007. Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt a.M. 1963. Boehm, Gottfried. «Das Bild als Medium der Erkenntnis». In: Schriften des Cusanuswerks 14 (2001), S. 11–18. Boschius, Jacobus. Symbolographia Sive De Arte Symbolica Sermones Septem. Quibus accessit Studio & Operâ Ejusdem Sylloge Celebriorum Symbolorum In Qvatvor Divisa Classes Sacrorum, Heroicorum, Ethicorum, Et Satyricorum Bis Mille Iconismis Expressa (...), Augsburg 1702. Buck, August. «Die Emblematik». In: Ders. Beiträge zum Handbuch der Literaturwissenschaft, Frankfurt a.M. 1971, S. 36–54. Camerarius d. J., Joachim. Symbola et emblemata tam moralia quam sacra (1587), Tübingen 2009. Cramer, Daniel. Emblemata Sacra, Frankfurt 1624. Deutsche Encyklopädie oder Allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften, Bd. 8, Frankfurt a.M. 1783. Friedrich, Verena. Benediktinerabtei Metten, Passau 1995. 45 Zymner (2002), 24. 46 Warncke (2005), 167: «Im spielerischen Bemühen, die Sprache der Kunstwerke als Angebot zu begreifen, ihre Mitteilungen aufzufinden und weiterzudenken, bezeugten die Zeitgenossen ihren Respekt vor dem Bilde als einem eigenen Medium der Erkenntnis». 269 Gier, Helmut / Johannes Janota (Hg.). Von der Augsburger Bibelhandschrift zu Bertolt Brecht, Weißenhorn 1991. Hahnl, Adolf. «Conservando cresco – Die Bibliotheksräume von St. Peter in Salzburg». In: Johannes Graf von Moy (Hg.). Barock in Salzburg, Salzburg 1977, S. 9–56. Kemp, Cornelia. Angewandte Emblematik in süddeutschen Barockkirchen, München 1981. Kutschera, Franz von. «Kunst und Erkenntnis». In: Zur Debatte 6 (2002), S. 12–14. Lechner, Gregor Martin. Emblemata. zur barocken Symbolsprache, Furth 1977. Lechner, Gregor Martin. «Zur Ikonographie der barocken Stiftsbibliotheken Österreichs und Süddeutschlands». In: Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken, Jg. 43 (1996), S. 73–84. Lesky, Grete. Die Bibliotheksembleme der Benediktinerabtei St. Lambrecht in der Steiermark, Graz 1970. Mannewitz, Martin. Stift Admont. Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte, Ausstattung und Ikonographie der Klosteranlage, München 1989. Mannewitz, Martin. «Origo, progressus et fructus sapientiae. Das Bibliotheks­ programm des Stiftes Admont als aufklärerisches Bildprogramm». In: Carsten-Peter Warncke (Hg.). Ikonographie der Bibliotheken, Wiesbaden 1992, S. 271–307. Mühleisen, Hans-Otto / Heinfried Wischermann. «Die Klosterbibliothek im Schwarzwald – Raum und Programm». In: Freiburger Universitätsblätter 19 (1980), S. 61–84. Mühleisen, Hans-Otto. Die Friedensproblematik in den politischen Emblemen Diego de Saavedra Fajardos, München 1982. Mühleisen, Hans-Otto. «St. Peter und Schloss Ebnet. Von den Chancen eines ikonographischen Vergleichs». In: Ders. (Hg.). St. Peter auf dem Schwarzwald, Lindenberg / Beuron 2003, S. 115–131. Mühleisen, Hans-Otto. «Im Licht des Geistes. Wie die Bilderwelt der barocken Klosterbibliothek St. Peter auf dem Schwarzwald auf die Herausforderung der Aufklärung reagierte». In: Christ in der Gegenwart 6 (2011), S. 58–61. 270 Scholz, Bernhard F. Emblem und Emblempoetik, Berlin 2002. Sedlmayer, Hans. «Die politische Bedeutung des deutschen Barocks». In: Gesamtdeutsche Vergangenheit, München 1938, S. 126–140. Seibt, Karl Heinrich. Von dem Einfluss der Erziehung auf die Glückseligkeit des Staates, Prag 1771. Warncke, Carsten-Peter. «Bibliotheksideale, Denkmuster der architekto­ ni­ schen Gestaltung und abbildlichen Darstellung frühneuzeitlicher Bibliotheken». In: Ders. (Hg.). Ikonographie der Bibliotheken, Wiesbaden 1992, S. 159–197. Warncke, Carsten-Peter. Symbol, Emblem, Allegorie. Die zweite Sprache der Bilder, Köln 2005. Wischermann, Heinfried. «Die Embleme der Klosterbibliothek von St. Peter». In: Hans-Otto Mühleisen (Hg.). St. Peter im Schwarzwald, München 1977, S. 113–123. Wischermann, Heinfried. Die Klosterbibliothek von Ottobeuren – Studien zu Raum und Ausstattung, Freiburg 2000. Wrangel, Martina Gräfin. Der Bibliotheksaal des Klosters Metten, MA-Arbeit, Freiburg 1983. Zymner, Rüdiger. «Das Emblem als offenes Kunstwerk». In: Wolfgang Harms / Dietmar Peil (Hg.). Polyvalenz und Funktionalität der Emblematik, Frankfurt a.M. 2002, S. 9–24. 271